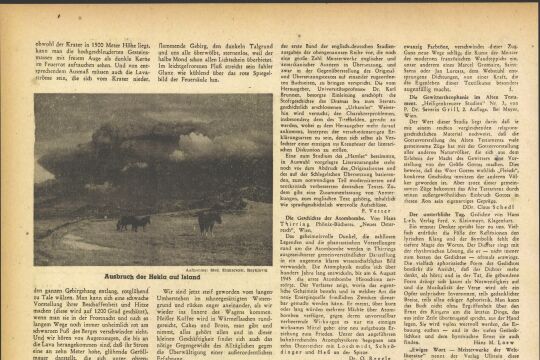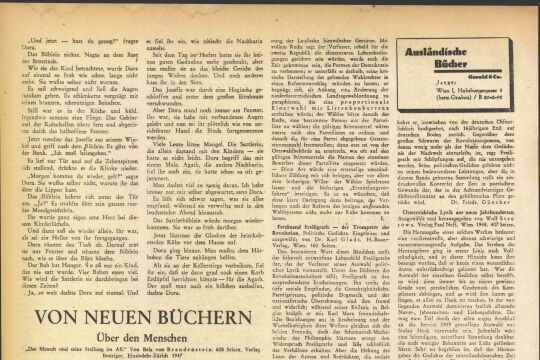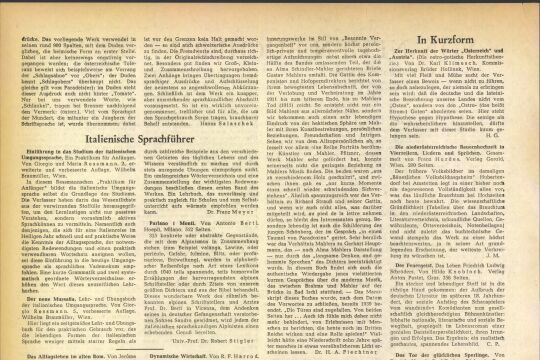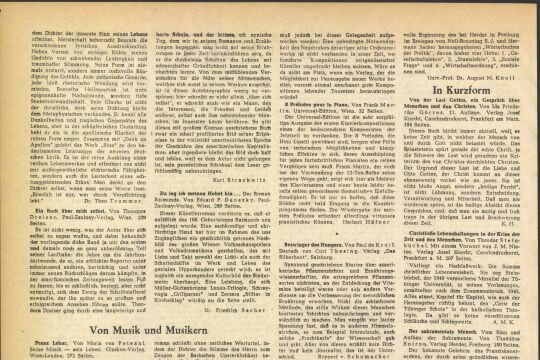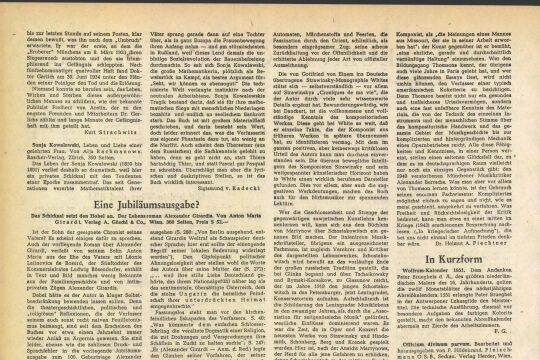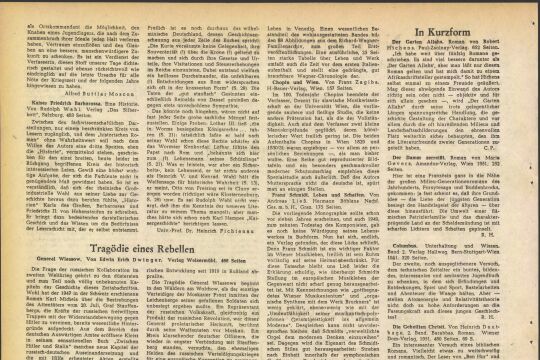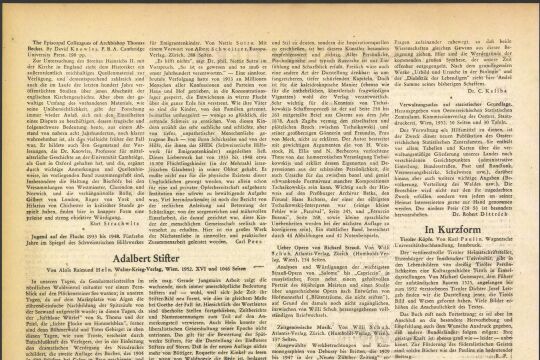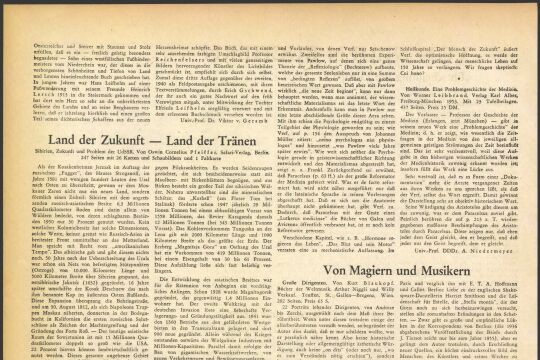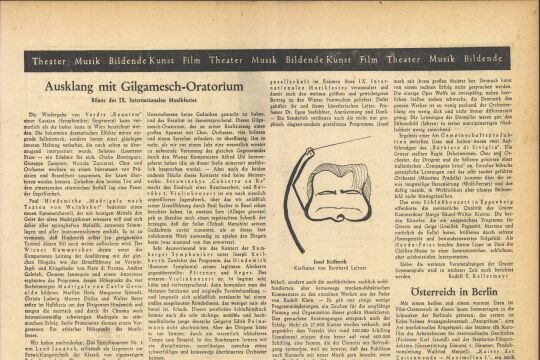Alban Berg. Versuch einer Würdigung. Von
H. F. Redlich. Universal Edition, Wien-Zürich-London. 393 Seiten. Preis 270 S.
Der Autor dieses Buches ist der Sohn des bekannten ehemaligen österreichischen Finanzministers und Universitätsprofessors losef Redlich, ist Inhaber des Lehrstuhles für Musikgeschichte an der Universität Edinburgh und wurde durch zahlreiche musikwissenschaftliche Arbeiten, die insbesondere Monteverdi, Mahler und der „Wiener Schule“ galten, bekannt. Mit dieser Monographie hat Alban Berg eine Würdigung erfahren, wie sie bisher keinem der großen zeitgenössischen Komponisten, weder Strawinsky noch Schönberg, Hindemith oder Bartök, in deutscher
Sprache zuteil wurde. Das bezieht sich nicht nur auf den Umfang des Buches, sondern vor allem auf die lückenlose Darstellung des Werks, die gründlichen Analysen, angefangen von der Sonate op. 1 (der 82 „frühe Lieder“ aus den lahren 1900 bis 1909 vorausgehen) bis zur unvollendet gebliebenen „Lulu“-Partitur und dem Violinkonzert. Eingangs gibt Redlich eine interessante Untersuchung über Mythus und Realität der zweiten Wiener Schule, indem er die Personalstile von Schönberg. Webern und Berg definiert und voneinander abgrenzt. Als Grundelemente
der Musik Alban Bergs erseheinen: die wichtige Rolle der Quart und der Sext, die multiple Variation als Formprinzip (Vernachlässigung der Sonatenform), Vorliebe für aphoristische Gestaltung und für musikalische Anagramme, Abschwächung der Kadenzwirkung, das historische Zitat und schließlich die Technik der Reihenkomposition. Einwände im einzelnen gegen manche von Redlichs Deutungen sind kaum von Belang und gehören in ein Fachblatt. — Die gute Absicht, alles, was Berg tat, als zwingend und naturnotwendig zu begreifen, veranlaßt den Autor wohl auch, die Sujets von „Wozzeck“ und „Lulu“ in allzu enge Verbindung mit Oesterreich und seiner inneren Entwicklung zu bringen. Hierüber hätte der Tiefenpsychologe und der Analytiker mehr Aufschlußreiches zu sagen, und zwar über Berg, als der Kulturhistoriker. Zwangsläufig fragmentarisch mußte Redlichs Darstellung von Alban Bergs Lebensgang (S 287—308) bleiben, solange ein Großteil der Korrespondenz nicht zugänglich ist. — Sehr sorgfältig sind die „Anhänge“ betreut. Hier findet man den vollständigen Text von Alban Bergs „Wozzeck“-Vortrag von 1929, eine genaue Bibliographie der Originalkompositionen, Bearbeitungen und musikliterarischen Arbeiten Bergs, eine Discographie, ein Quellenverzeichnis, einen reichhaltigen Anmerkungsapparat (S. 3 51—3 86) sowie die Erstpublikation der frühen Klaviervariationen über ein eigenes Thema. Im Text stehen 3 50 Notenbeispiele, Photos und unbekannte Briefe. — Der vorliegenden Berg-Biographie war ein Berg-Buch von Willi Reich vorausgegangen, zu dem Redlich seine Stellung im Vorwort präzisiert. Die Arbeit an dem hier besprochenen Werk hat sich über Jahre erstreckt, und auch die Drucklegung und Fertigstellung zog sich jahrelang hin( das Vorwort des Buches, das vor kurzem erschienen ist, datiert vom Oktober 1953. Man kann die Schwierigkeiten nur ahnen). Wie immer: wir haben eine in jeder Hinsicht repräsentative Alban-Berg-Monographie, die man bestens empfehlen darf.
*
Igor Strawinsky. Leben und Werk — von ihm selbst. — Im Gemeinschaftsverlag Atlantis-Verlag, Zürich, und B. Schotts Söhne, Mainz. 344 Seiten mit über 100 Bildern. Preis 21 DM.
Das handliche, schön ausgestattete Werk enthält Strawinskys Schriften: die „Lebenserinnerun-g e n“ („Chroniques de ma vie“ von 1935, frei übersetzt von Richard Tüngel, 1937 bereits deutsch erschienen, aber längst vergriffen), die „M u s i k a 1 i* sehe Poetik“ nach den Vorlesungen 1939/40 an der Harvard University (deren erste deutsche Ausgabe, übersetzt von Heinrich Strobel. erstmalig 1948 erschien) und die „Antworten auf 35 Fragen“, ein Gespräch, das Strawinsky 1957 mit seinem jungen Freund und Mitarbeiter Robert Craft führte, schließlich einen umfangreichen biographischen Bildbericht. Hier findet man zahlreiche Skizzen und Werkaufnahmen von szenischen Darstellungen, Photos von Tänzern und anderen Künstlern, die Strawinsky nahestanden: Diaghilew, Cocteau, Satie, Dcbussy, Ramuz. Matisse, Milhaud — eine noble Gesellschaft, “der Parnaß ffterer ersten Jahrhunderthälfte. Hierfür ist man besonders'dankbar. Im Textteil vermissen wir: Strawinskys umfangreiche Erinnerungen an Diaghilew, das Radiointerview anläßlich der venezianischen Uraufführung von „The Rakes Progress“ und manches andere, wie programm-matische Erklärungen, Kommentare usw. Ein schmaler Ergänzungsband wäre sehr erwünscht.
*
Othmar Schoeck. Bild eines Schaffens. Von Hans C o r r o d i. Verlag Huber & Co., Frauenfeld, Schweiz. 429 Seiten. Preis 19.80 sfrs.
Vor diesem sorgfältig und reich ausgestatteten Monumentalwerk steht der Kritiker ein wenig ratlos. Er hat darin gelesen, geblättert und wieder gelesen, die Bilder und die 198 Notenbeispiele angesehen, er war gerührt von dem grenzenlosen Enthusiasmus des Biographen und beeindruckt durch dessen gründliche Kenntnis von Leben und Werk seines Idols, er hat verfolgt, wann sich der Meister wo aufgehalten hat, was und in welcher Stimmung er geschaffen, wie er auf das Echo dei' rauhen Welt reagierte, wie er über sich und die Kunst seiner Zeit dachte — aber der Rezensent hat keinen rechten Zugang zu all dem gefunden. Einmal, weil ihm nur ein Bruchteil dessen bekannt ist, was Othmar Schoeck bis zu seinem Opus 70 geschaffen hat, dann aber auch, weil er über das ihm Bekannte anderer Meinung ist als der Biograph „Es ist ein Werk der Liebe und Begeisterung, des unbedingten Jasagens“, schrieb Hermann Hesse über eine frühere Ausgabe. Und damit hat es ohne Zweifel seine Richtigkeit. Was von dem Riesenwerk Schoecks bleiben wird, den über 400 Liedern, den Orchesterkompositionen, den Chor- und Bühnenwerken (u. a. „Venus“, „Penthesilea“, „Massimilia Doni“, „Das Schloß Dürande“), darüber wird die Zeit entscheiden — und damit auch über das Werturteil von Hans Corrodi.
Franz Schmidt. Ein Meister nach Brahms und Bruckner. Von Carl N e m e t h. Amalthea-Verlag, Zürich-Leipzig-Wien. 291 Seiten. Preis 130 S.
Der junge Musikhistoriker Carl Nemeth hat als Schmidt-Biograph einige Vorgänger: Andreas Liess vor allem und Albert Arbeiter. Aber er hat viel neues Material zusammengetragen, vor allem biographisches: Aufzeichnungen, Briefe, Zeugnisse aller Art, Kritiken usw. Der umfangreiche Stoff, chronologisch angeordnet, ist in sieben Teile gegliedert, die wieder nach der Art der Amalthea-Musikbücher in zahlreiche Kapitel aufgeteilt sind. Leben und Werk, Beruf und Schaffen werden in ihrer Wechselwirkung dargestellt, und so wird dem aufmerksamen Leser manches klar. Ein Stück Wiener Musikgeschichte rollt vor ihm ab, gesehen aus einem ganz bestimmten Blickwinkel. Man lernt den Freundeskreis Franz Schmidts kennen, die Wunderer und Nowak, Dengler und Marx, Kabasta, Schütz und
Wührer und viele andere: gute, zum Teil ausgezeichnete Musikanten. Aber man wünscht Schmidt, diesem genial begabten Musiker, doch auch noch anderes. Die Phantasie beginnt zu spielen: Was wäre gewesen, wenn . .. wenn Schmidt zum Beispiel das Leben Strawinskys oder Hindemiths geführt hätte, wenn es ihm vergönnt gewesen wäre, sich jahrelang im Ausland aufzuhalten, mit den führenden Köpfen seiner Zeit Kontakt zu bekommen usw. Liest man zum Beispiel die Textbücher, an denen er hängenblieb (mit einer großen Ausnahme): „Nötre-Dame“ und „Fredigurtdis“, die letzte Kantate und den Briefwechsel mit Wunderer über einen phantastischen Plan, die Vertonung von dessen philosophischem Zyklus „Welt und Leben“, bedenkt man die Sklaverei seines Berufes und den frühen Tod — so faßt einen der Menschheit ganzer Jammer an. Daß Schmidt zu guter Letzt geehrt und n\it dem Ehrendoktor der Wiener Universität ausgezeichnet wurde (welch £in Text der Ehrenurkunde! S. 236/237 bei Nemeth) und daß er in Wien, in Oesterreich auch aufgeführt wird, ist nur ein geringer Trost angesichts der fast unvorstellbaren Möglichkeiten seines Talents. Das vorliegende Buch enthält 67 Notenbeispiele, 29 Abbildungen, 7 Faksimiles, ein vollständiges Werkverzeichnis mit Discographie, ein Literatur- und Namensregister sowie eine Liste mit allen Aufführungen Schmidtscher Werke durch die Philharmoniker. Für all das ist man dem Autor zu Dank verpflichtet.
*
Fritz Kreisler. Von Louis P. L o c h n e r. Bergland-Verlag, Wien. 3 30 Seiten. Preis 138 S.
Das vorliegende Buch, mit 8 Abbildungen, zahlreichen Themenzitaten und einem vollständigen Werkverzeichnis versehen und repräsentativ aufgemacht, ist eine quasi Autobiographie durch die Feder eines Freundes. Er erzählt das Leben eines Wunderkindes, eines komponierenden Virtuosen und eines liebenswürdigen Menschen. Nach einer kurzen Jugend in Wien und noch kürzerem Studium in Paris treibt ihn sein Beruf durch die Welt. Auch dem, der Kreisler
nicht mehr gehört, sein zauberhaft-schnelles Vibrato nie vernommen hat, bietet das Buch des Interessanten und Amüsanten genug — obwohl man nicht jeden Satz auf die Goldwaage legen darf. So etwa bei der Schilderung des „Cafe Größenwahn“ alias „Grien-steidl“, das hier aber immer als „Grünsteidel“ figuriert, mit seinen Habitues, zu denen auch Hugo Wolf und Hofmannsthal gehörten (ob der letztere der Mitautor von „Komm mit mir ins Chambre separee“ aus Heubergers „Opernball“ ist, muß mit einem Fragezeichen versehen werden). Eine andere Geschichte stimmt auf jeden Fall: wie Kreisler die Musikwelt und vor allem die allwissenden Kritiker mit der fingierten Entdeckung alter Musikstücke an der Nase herumgeführt hat, wie 1936 der Schleier gelüftet wurde und wie die musikalische Welt darauf reagierte. Oder wie — am Rande erzählt — Hawaii zu seiner Nationalhymne kam, die identisch ist mit „Ja da fahrn wir halt nach Nußdorf raus“. Kreisler war österreichischer Hauptmann im ersten Weltkrieg, er war der Freund und Günstling großer Männer, von Einstein bis Mussolini, und er war der Mann seiner Frau, der energisch wohltätigen Amerikanerin Harriet Lies, die sein Leben beschützte und dirigierte. Er war ein kenntnisreicher Sammler alter Musikinstrumente, alter Handschriften und seltener Bücher, und er zögerte nicht, seine Schätze für wohltätige Zwecke, zur Milderung der Nachkriegsnot, versteigern zu lassen. Er liebte seine Geige und die Musik, mit der er aufgewachsen war. Daher wiegen seine etwas summarischen Urteile über die Musik der Gegenwart nicht schwer („Die Zukunft der Musik liegt in Amerika“ — 1924, und „... eine Musik, die keine Rücksicht auf Wohlklang und Tonart nimmt und die mit offenbarer Absicht geschaffen wird, in Kakophonien zu schwelgen“). Die Diktion mag man auf das Konto des Uebersetzers H. R. Nack setzen, aber es wäre besser gewesen, solche Schiefheiten zu supprimieren. Sie nützen niemandem — und sie machen Kreisler nicht größer.