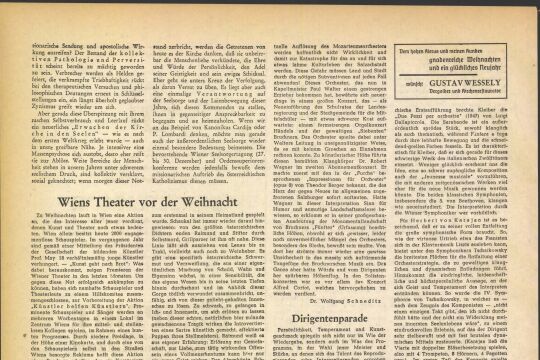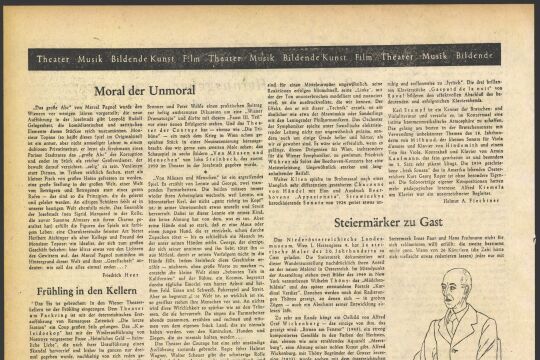Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von Schönberg zu Kont
Während der vergangenen Woche gab es eine solche Fülle von Konzerten, daß man den Eindruck gewinnen konnte, die Wiener Konzerthausgesellschaft wolle noch vor Beginn der Festwochen ein Mini-Festival veranstalten, bei dem neue und neueste Musik das Übergewicht hatten. Zu diesem Programm gehören auch die drei Abende des BBC-Orchesters, London, über die wir in der nächsten Folge der „Furche“ berichten werden.
Während der vergangenen Woche gab es eine solche Fülle von Konzerten, daß man den Eindruck gewinnen konnte, die Wiener Konzerthausgesellschaft wolle noch vor Beginn der Festwochen ein Mini-Festival veranstalten, bei dem neue und neueste Musik das Übergewicht hatten. Zu diesem Programm gehören auch die drei Abende des BBC-Orchesters, London, über die wir in der nächsten Folge der „Furche“ berichten werden.
Ein Konzert im Mozartsaal war ausschließlich Arnold Schönberg gewidmet. Mitglieder des Ensembles „Kontrapunkte“ unter der Leitung von Peter Keuschnig waren die Ausführenden. — „Pierrot Lunaire“ für Sprechstimme und sieben Instrumente, 1912 entstanden, ist ein Meisterwerk, das als solches frühzeitig von so verschiedenartigen Musikern, wie Ravel, Strawinsky und Milhaud, erkannt wurde. Vom Publikum etwas später. Aber heute ist es ein Erfolgsstück. Absolut neuartig und originell ist die Behandlung der „Solopartie“, einer rhythmisch, melodisch und dynamisch genau fixierten Sprechstimme, die dreimal sieben Gedichte von Albert Giraud in der Übersetzung Otto Erich Hartlebens rezitiert. Diese Gedichte sind, künstlerisch betrachtet, Halbseide und von jugendstilhafter Verruchtheit. Man kann diese Elemente, etwa durch das Kostüm der Solistin, den Vortragsstil und die Gesten unterstreichen — oder man kann sie soweit wie möglich ignorieren. Margaret Baker, die in Italien lebende Australierin mit der akzentfreien deutschen Aussprache, tat, in Übereinstimmung mit dem Dirigenten, das letztere. In schwarzem, elegantem Abendkleid, ohne Requisiten, mit sparsamen Gesten — entfaltete sie eine um so reichere stimmliche Ausdrucksskala. Differenziert, klangschön und mit Schwung musizierte auch das siebenköpflge Instrumentalensemble: lauter ausgezeichnete Musiker, von denen wenigstens Rainer Keuschnig, der jüngere Bruder des Dirigenten, hervorgehoben sei. Peter Keuschnig nahm sich bei der Interpretation von Schönbergs Meisterpartitur einige Freiheit. Aber als guter Musiker darf er sich das Das gleiche gilt von der Kammersymphonie, Schönbergs op. 9 aus dem Jahr 1906. Man kann das einsätzige Werk als verkappte vierteilige Symphonie oder als einen sehr erweiterten Sonatensatz betrachten: Beim unbefangenen Hörer entsteht eher der Eindruck einer freien, rhapsodischen Form, die motivisch verklammert ist und die der „großen kammermusikalischen Besetzung“ für 15 Soloinstrumente, die vielfach nachgeahmt wurde, vollkommen entspricht. Es gab langanhaltenden, wohlverdienten Beifall für alle Ausführenden.
Um das Ausmaß des Mißlingens anzudeuten und das Gefühl der Enttäuschung zu begreifen, das die Uraufführung von Paul Konts fast einstündiger Kantate „Vom Manne und vom Weibe“ nach Dichtungen von Josef Weinheber auslöste, muß man an die Entstehungsgeschichte des Werkes erinnern. 1941/42 an der russischen Front wurde eine neue Deklamationsmethode konzipiert, 1943 der Plan einem Freunde dargelegt, „ein universalistisches, symmetrisches und hieratisches Musikwerk“ zu schaffen, „in dem die Mann-Weib-Antinomie vokal wie instrumental, metrisch, tonsprachlich, klanglich, in der Gesamtarchitektur wie in der Einzelheit ausgetragen werden sollten“. Dann hat das große Projekt den Wiener Komponisten über 20 Jahre lang beschäftigt, bis es 1963/64, größtenteils in Rom, ausgeführt wurde. Als Auftragswerk der Wiener Konzerthausgesellschaft. Nun hat der Fünfzigjährige am vergangenen Freitag die Uraufführung durch die Wiener Symphoniker, den Wiener Kammerchor und die Solisten Gertrude Jahn (Alt) und Kurt Widmer (Bariton) erlebt,
und man gäbe etwas drum, zu wissen, was die Hauptbeteiligten an dieser Aufführung, der Komponist und sein Auftraggeber, dabei gedacht und empfunden haben. Der Stil Konts ist schwer zu beschreiben und ist vor allem durch Widerborstigkeit gekennzeichnet. Von all dem, was er sich methodisch zurechtgelegt hat und worüber ein umfangreiches Programmheft ausführlich Auskunft gibt, bekommt der Hörer nur die rauhe Schale zu spüren. Die besten homophonen Chorsätze erinnern entfernt an Hauer (aber nur so, wie Weinheber an Hölderlin); am härtesten klingen die rein instrumentalen Vor-, Zwischen- und Nachspiele, vom Komponisten als „Konzerte“ bezeichnet.
Dirigent, Chor und Orchester hatten auch insofern eine undankbare Aufgabe übernommen, als der 2. Teil des Konzertes bei dem 55 Minuten lang strapazierten Publikum kauim mehr richtig „ankam“. Dabei gab sich Peter Keuschnig mit den Symphonikern alle Mühe, Weberns etwas blasses op. 1, die Passacaglia d-Moll, wie ein Stück aus Bergs Meisterjahren erklingen zu lassen. Und Joan Carroll, die in vier Sprachen und 17 Inszenierungen 120mal die Lulu gesungen hat, gestaltete den für sie geschriebenen 11< -olog mit Orche-sterbegleitung von Arxbert Reimann intensiv, abwechslungsreich und dramatisch. Boi diesem musikalischen Expressionismus von gestern und dem ebenso unklaren wie unsympathischen Text von Manuel Thomas hat Schönbergs „Erwartung“ Pate gestanden. Merkwürdig, wie gerade ein junger Berliner, Schüler von Blacher und Pepping, auf so etwas Ausgefallenes kommt... Viel Beifall für die Solistin vor allem.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!