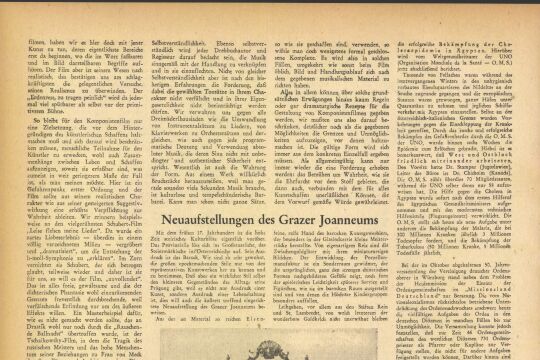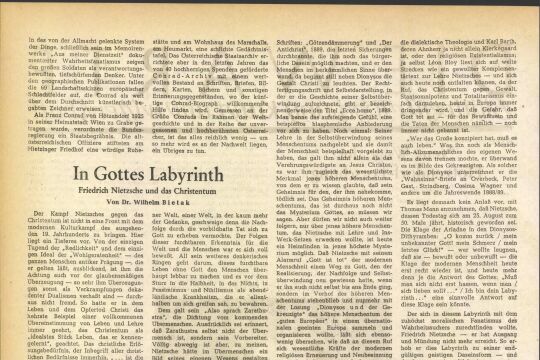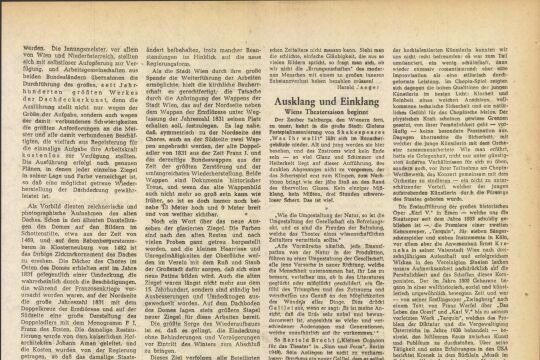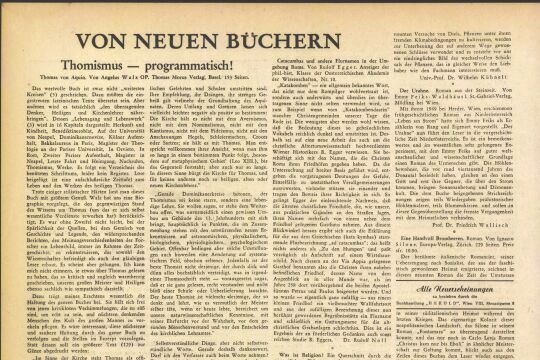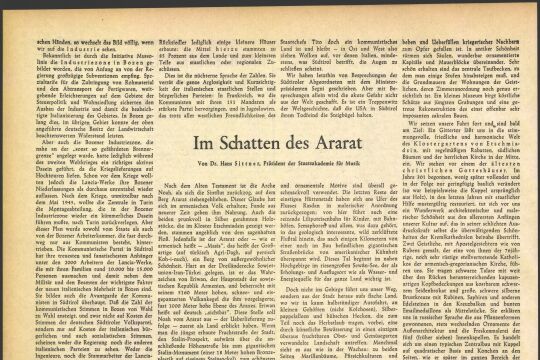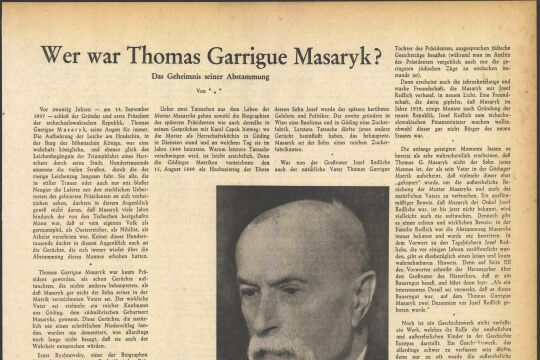Wir wissen von Asien nicht vie mehr als die Leute, die Marco Pole einen Lügner nannten, als er aus dei Residenz Kublai Khans nach Venedig zurückkehrte, aus der Residenz des Herrschers, der Papst Gregor X. urr 100 römische Kleriker bat, weil ei sich erklären lassen wollte, waruir Jesus Christus ein größerer Prophet isein sollte als die anderen drei: Mohammed, Moses und Sakya Muni, Da man ihm die Kleriker niemals sandte, fuhr er fort, alle vier Propheten, wie er sagte, gleichermaßen zu verehren.
Um künftig mehr zu wissen, kann man nach Zürich fahren und im Kunsthaus die „Historischen Schätze aus der Sowjetunion“ ansehen. Das ist eine Gelegenheit, etwa den Skythen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, in deren Erbe wir uns mit einer noch kaum bekannten Zahl von Kulturen teilen, ohne es recht zu wissen. Aber dann beginnen die ersten Enttäuschungen. Die Skythen nehmen zwar einen breiten Raum in der Ausstellung ein, und man erfährt, daß sie und nicht ein legendärer Waräger namens Rurik am Anfang von Kiew-Rußland stehen. Aber wie Rurik zu seinem also korrekturbedürftigen Ruhm kam, sagt dem Besucher niemand. Man verrät dem Besucher auch nicht, daß die Skythen auf dem Umweg über die keltische Kunst bis in unseren Jugendstil hineinwirkten oder daß die ostgotischen Goldschmiede, die den Krönungsmantel Karls des Großen schmückten, sich an die Vorbilder des skythischen Tierstils hielten. Und doch wären solche Hilfen hochwillkommen; denn wie soll man sich sonst in wenigen Stunden unter über 400 Nummern oder weit über tausend Objekten zurechtfinden?
Kiew-Rußland oder Kiew-Rus, wie es die russischen Archäologen nennen, hat seinen Namen also von einem slawischen, skythisch durchsetzten Stämmebund am mittleren Dnjepr, der im sechsten und siebenten Jahrhundert entsteht und sich nach einem Nebenfluß des Dnjepr, Ros, benennt. Nachzulesen in einem Buch des Archäologen Rybakow, das 1965 in englischer Sprache in Moskau erschien. Teile der Skythen werden übrigens, wie an einer anderen Stelle des Katalogs steht, für die Vorläufer der Slawen gehalten. Was denn ein slawischer, skythisch durchsetzter Stämmebund ist, mag enträtseln, wer will.
Mängel
Es war überhaupt auf keiner kulturhistorischen Ausstellung des Kunsthauses Zürich so schwer, ein Bild von dem zu gewinnen, was da gezeigt wurde. Ein halbes Dutzend Landkarten (für eine Zeit von 100.000 Jahren) zeigt die Fundorte der einzelnen Kulturen. Sie zeigen alle Fundorte, nicht nur die, deren Funde zu sehen sind. Wer sehr aufmerksam ist (und sich nicht selber des Irrtums bezichtigt), merkt, daß die älteste Bauernsiedlung auf sowjetrussischem Boden, die von Dsheitun in Turkmenien, nur im Katalogtext vorkommt, ebenso der älteste Teppich der Welt, aus einem Grab im Altaigebirge, datiert in das fünfte Jahrhundert vor Christus. Man sieht weder Photos der Grabungen noch der Landschaft, in der die
Fundorte liegen, von Luftaufnahmen, die in der Archäologie in letzter Zeit immer wichtiger wurden, ganz zu schweigen. Man sieht Kopien von Höhlenbildern, aber keine Aufnahmen des Originals, so daß man vergeblich darüber nachdenkt, ob die Aquarellmanier der Kopie auch dem Original eigen ist und es damit von allen ähnlichen Funden des frankokantabrischen Kreises (Altamira, Lascaux) unterscheidet, oder ob der Kopist lediglich sich die Freiheit nahm, zum Pinsei zu greifen. Auch hier wird weder die Datierung (30. Jahrtausend) noch die Gestaltung zu schon bekannten Zeichnungen Westeuropas in Beziehung gesetzt. Die Eidetiker-Theorie wird angegriffen, weiter nichts, und auch das geschieht ohne Angabe von Gründen.
Die vier Bilder aus der Kapowa-Höhle im Ural zeigen Mammut, Pferd und Nashorn. Das vierte, kammähniliche Sujet bezeichnet der Katalog kurzerhand als „stilisiert“. Was da stilisiert worden ist, wird nicht mitgeteilt. Dabei wären diese Zeichnungen für unsere Vorstellung von der frühen Kulturgeschichte Europas von großer Bedeutung. Man nimmt bis jetzt an, daß der Crö-Magnon-Mensch zwischen dem 30. und 25. Jahrtausend aus dem Osten nach Westeuropa einwanderte. Daß seine Malerei an einem früheren Punkt der Wanderung entdeckt wird, könnte bedeuten, daß er sie nach Europa fertig mitbrachte. Oder daß ein Teil der Bevölkerung im Ural zurückblieb und dort eine ähnliche Kunst entwickelte.
Nachdenklichkeit tut not
Die Hilflosigkeit des Besuchers wird dadurch noch gesteigert, daß die Ausstellung auf alle Möglichkeiten der optischen Akzentuierung verzichtet, die man seit der Etrusker-ausstellung im Jahre 1955 als „Zürcher Ästhetizismus“ zu bezeichnen pflegt. Kein Spotlight hebt einzelne Objekte oder bestimmte Aspekte der Objekte heraus. Nicht einmal die Farben der Rückwände sind mit Rücksicht auf die Stimmung ausgesucht, die sie im Betrachter auslösen: schwarz, stumpf-grau und milchig giftgrün sind die Wände angestrichen, die bis dicht an die Beleuchtungskörper hochgezogen sind und dem Besucher das Gefühl geben, zwischen den engen Zickzackwegen eines Labyrinths zu gehen. Die Russen haben das so gewünscht. Sie wünschten eine objektive Darbietung der Stücke. Aber sie sind über das Ziel hinausgeschossen. Statt wie bisher dem Besucher vorzuschreiben, welche Seite einer Plastik er als Schauseite zu akzeptieren hat und wie sich ihm ein Relief darbietet, stehen ihm die Objekte dieser Ausstellung in diffusem Licht so neutral gegenüber, daß sie kaum reizvoller erscheinen als ein Blinddarm in Spiritus. Nur im letzten Raum, bei den Ikonen, hat man eine Ausnahme gemacht, und am Eingang, für ein paar päläothische Werkzeuge und die beiden weiblichen Statuetten (ä la Venus von Willendorf), die in ihren Vitrinchen vor einem dreiteiligen Frisierspiegel stehen, um auf einen Blick alle ihre Seiten zu zeigen.
W a s in dieser Ausstellung gezeigt wird, ist viel fir uns West- und
Mitteleuropäer, die wir oft dazu neigen, Asien und die Sowjetunion, teils als Wiege der Menschheit, teils als Ursprung ihres Untergangs ansehen. Was da aus der Ermitage in Leningrad, dem Puschkin-Museum in Moskau, dem Miklucho-Maklai-Institut und den Museen in Baku, Gomel, Jerewan, Kiew, Kischinew, Lwow, Nowosibirsk, Odessa, Riga,
Saratow und Woronesch zusammengetragen ist, erfüllt allein durch die Präsenz dieser Namen den heilsamen Zweck, in unserem Bewußtsein die Worte Asien und Sowjetunion mit dem Begriff Kulturgeschichte zu verknüpfen und so eine Nachdenklichkeit auszulösen, die in dieser Zeit der Wortschablonen doppelt nottut. Um so schlimmer, daß diese Ausstellung diesem Nachdenken nicht mehr faßbaren Stoff anbietet, daß sie im 17. Jahrhundert endet und nicht im 19. Würde sie zwei Jahrhunderte weitergeführt, man würde vielleicht einen Überblick über die Tendenzen gewinnen. die aus der Vergangenheit in die Gegenwart hineinreichen, die Gegenwart so in angemessene Relationen rückend.
Fadenscheinige Verknüpfung
Immer wieder diese sorgsam vermiedenen Relationen. Die Maikop-Kultur aus dem vierten Jahrtausend, östlich des Schwarzen Meeres, mit ihren Stadtmauern ihrem getriebenen Goldschmuck voll Löwen und Stieren, wird bisher bei uns in die zweite Hälfte des dritten Jahrtausends datiert. Wenn die neue Datierung stimmt, ist diese Kultur älter als die mesopotamisehen Hochkulturen. Die Perversion der Arbeitsteilung in eine Aufteilung der Gesellschaft nach Schichten unterschiedlichen Rechts wäre dann nicht mehr ins Zweistromland zu verlegen. Die Verknüpfung der Abwertung des Individuums mit den Notwendigkeiten einer mathematisch geordneten Bewässerungswirtschaft fiele dahin.
In der Frühen Eiszeit, im ersten Jahrtausend vor Christus konstatierten die russischen Archäologen von Mittelasien bis zum Schwarzen Meer eine Reihe von „Sklavenhalter-Zivilisationen“. Damit sind in unserer Ausdrucksweise Formen von geschichteten Gesellschaften gemeint, deren abhängigste Schicht sowohl in sozialer Sicherheit wie auch in völliger Rechtslosigkeit leben könnte. Das hängt davon ab, was eine Gesellschaft unter einem Sklaven versteht. Hingegen wäre es interessant zu sehen, wie sich bereits in diesem Jahrtausend die Technik der Hochkulturen in dem ihnen so entfernten Waldgürtel Nordasiens auswirkt. Man vermißt Proben der jakutischen
Bronzen vom Lenafluß und Bronzen aus der Taigakultur am oberen Jenissei. Beide würden demonstrieren, wie lebhaft auf dem Wegenetz Asiens in diesem ersten Jahrtausend der Kupferhandel und die Gußtechnik sich ausbreiteten. Man vermißt die Völker des Waldgürtels insgesamt. Für die russischen Archäologen sind die Skythen, die im Zentrum der Ausstellung stehen, Träger einer Kultur, in der vermutlich manche Schlüssel zur Weltgeschichte verborgen liegen. Wohl mit Recht. Sie stehen am Schwarzen Meer im Austausch mit der Kultur Griechenlands, im Atlasgebirge mit der chinesischen Kultur. In den Gräbern, die der ewige Frost im Altaigebirge bis in die Gegnwart konservierte, fanden sich kostbare chinesische Seiden. Seit dem siebenten Jahrhundert vor Christus entfalten sie ihre Wirkung als Anreger, Mittler, Störenfriede. Sie richten das Partherreich auf und beherrschen es eine Zeitlang. Dem Reich von Choresmien leihen sie ihre Vorstellungs- und Formwelt. Das Fürstentum von Buchara trägt ihren Stempel, und der Anfang von Kiew-Rußland steht unter ihrem Zeichen. Man müßte untersuchen, ob der skythische Tierstil nicht auch in China Einfluß gewann und welche Impulse er von dort empfing.
Dschingis-Khan und Ikonen
Im Abschnitt Kiew-Rußland ist übrigens auch von Dschingis-Khan die Rede, und nicht eben sachlich. Darnach hart die Goldene Horde nichts vermocht, außer „entsetzliche Verwüstungen“, die das Ende von Kiew-Rus waren. Aber vor 1000 oder 900 Jahren blühte Kiew-Rus. Auf Birkenrinde ist es bewahrt: „Gruß von Semen an die Schwiegertochter. — Wenn du vergessen hast, wo das Malz ist, es ist im Keller, nimm es. Das Fleisch liegt im Vorderhaus ...“ Der Brief ist um 1100 geschrieben, im alten Nowgorod. Es gibt andere, aus dem elften Jahrhundert. Sie sind neben dem Modell der Straßenkreuzung Welikaja-Cholopjastraße zu sehen, neben der Kopie des Freskos „Fürst Jaroslaw bringt Christus eine Kirche dar“ aus dem Westschiff der Spas-Nerediza-Kirche in Nowgorod, entstanden im Jahre 1246, in der Zeit der Goldenen Horde also.
Am Schluß der Ausstellung stehen die Ikonen und Stickereien. Die Stickereien trugen im alten Kiew-Rußland die Bezeichnung „Nadelkunst“ und galten wie andere Künste. Nur wenige Proben sind zu sehen, ein Epitrachelion (= Stola) aus dem 13. Jahrhundert, eine Porutschi (— Händbinde eines Priesters), beide Stickereien mit Email und Perlen versehen.
Die Ikonen aus dem Dunkel. Da sind die kühlen, linearen aus Nowgorod, die differenzierten aus Ples-kau (Pskow), die pathetischen der Moskauer Schule. Im Moskauer Andrej-Rublow-Museum ist eine ganze Schar von Restauratoren, so steht es im Katalog, damit beschäftigt, neu aufgefundene Ikone von Übermalungen zu befreien und zu konservieren. Die Stroganow-Meister fehlen zwar, aber Rubljow ist wenigstens in einer Kopie zu sehen: seine „Heilige Dreifaltigkeit“, über der eine mystische Stille liegt. Hier bedauert man besonders, daß diese Ausstellung lückenhaft ist. In Europa kursieren so viele epigonale, süßliche Versionen von „Ikonen“, die diesen Namen nur in Gänsefüßchen verdienen und ein falsches Bild vom Sinngehalt dieser sakralen Malerei verbreiten.
Über 1000 Objekte und doch kein Bild der Kulturgeschichte auf dem Boden der Sowjetunion. Es wäre klüger gewesen, die Ausstellung ganz den Skythen oder ganz dem alten Kiew-Rußland zu widmen und Leihgaben aus nichtrussischen Museen , dazuzunjehmen. So birgt die Ausstellung Ansätze zu fünf neuen Ausstellungen, wirft Fragen auf, die sie nicht beantworten kann oder mag.
Oder steckt die Hoffnung dahinter, der Besucher möge selbst in die Museen der Sowjetunion fahren, die in Zürich nur mit Lockvögeln vertreten sind?