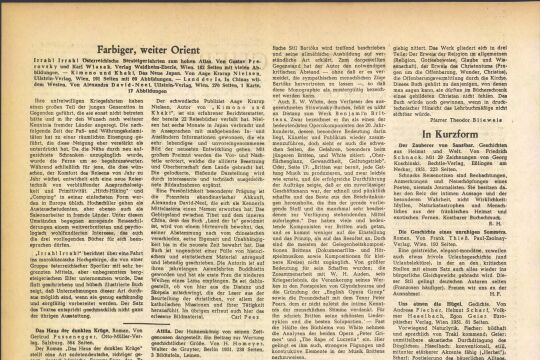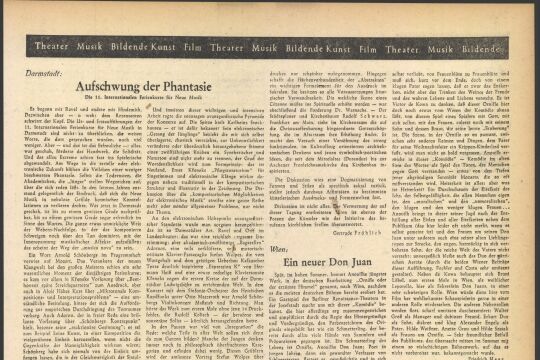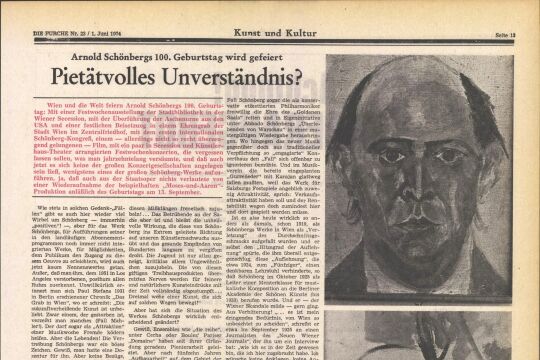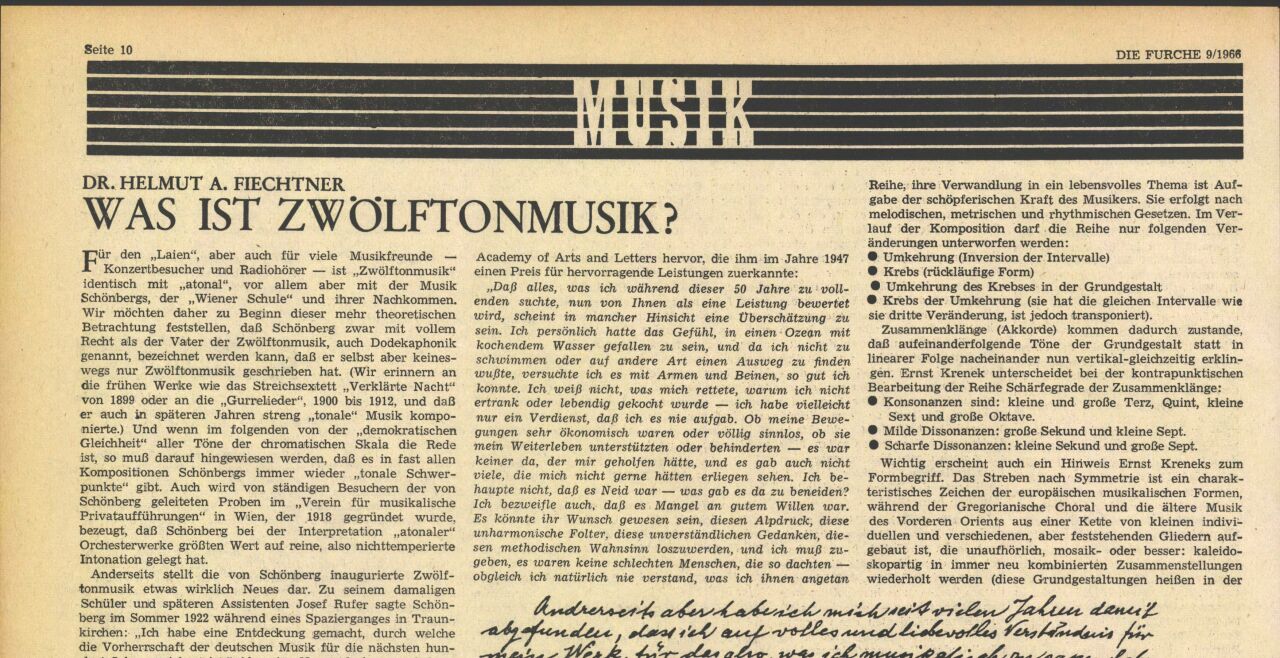
Für den „Laien”, aber auch für viele Musikfreunde — Konzertbesucher und Radiohörer — ist „Zwölftonmusik” identisch mit „atonal”, vor allem aber mit der Musik Schönbergs, der „Wiener Schule” und ihrer Nachkommen. Wir möchten daher zu Beginn dieser mehr theoretischen Betrachtung feststellen, daß Schönberg zwar mit vollem Recht als der Vater der Zwölftonmusik, auch Dodekaphonik genannt, bezeichnet werden kann, daß er selbst aber keineswegs nur Zwölftonmusik geschrieben hat. (Wir erinnern an die frühen Werke wie das Streichsextett „Verklärte Nacht” von 1899 oder an die „Gurrelieder”, 1900 bis 1912, und daß er auch in späteren Jahren streng „tonale” Musik komponierte.) Und wenn im folgenden von der „demokratischen Gleichheit” aller Töne der chromatischen Skala die Rede ist, so muß darauf hingewiesen werden, daß es in fast allen Kompositionen Schönbergs immer wieder „tonale Schwerpunkte” gibt. Auch wird von ständigen Besuchern der von Schönberg geleiteten Proben im „Verein für musikalische Privataufführungen” in Wien, der 1918 gegründet wurde, bezeugt, daß Schönberg bei der Interpretation „atonaler” Orchesterwerke größten Wert auf reine, also nichttemperierte Intonation gelegt hat.
Anderseits stellt die von Schönberg inaugurierte Zwölftonmusik etwas wirklich Neues dar. Zu seinem damaligen Schüler und späteren Assistenten Josef Rufer sagte Schönberg im Sommer 1922 während eines Spazierganges in Traunkirchen: „Ich habe eine Entdeckung gemacht, durch welche die Vorherrschaft der deutschen Musik für die nächsten hundert Jahre gesichert ist.” Also eine Neuentdeckung auf theoretischem Gebiet, ein Sprung — und nicht nur eine Evolution, wie immer wieder von Adepten und Interpreten Schönbergs behauptet wird. Aber er benützte diese „Entdeckung” als Musiker, als Künstler, also freizügig. Wie es ja auch unter seinen Schülern und Enkeln kaum einen gibt, der nicht versichert, daß er die Zwölftontechnik keineswegs „streng”, das heißt schulmäßig handhabe.
Doch: um was geht es bei dieser kompositorischen Technik? Was ist „Zwölftonmusik”? Wie sieht dieses Neuland aus? Und gibt es eine Verbindung zwischen ihm und der uns vertrauten Musik der Klassik, der Romantik und des Impressionismus?
In seinem Buch „Die Zwölfordnung der Töne” stellt zum Beispiel Hermann Pfrogner diese Frage. Ausgangspunkt seiner Untersuchung ist das Tonmaterial: unsere aus fünf ganzen und zwei Halbtönen bestehende diatonische Tonleiter und die sie umgreifende zwölftonige chromatische Reihe, die sich in ihrer heutigen Gestalt bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen läßt, im 18. Jahrhundert gefestigt und im 19. voll ausgeschöpft wurde. Diese Reihe und die aus ihr gewonnenen Themen und Akkorde sind, bis einschließlich Hindemith und Baitök, „tonal”. Infolge der temperierten Stimmung hat jede Taste auf dem Klavier durch enhar- monische Verwechslung oder „Verwandlung” nicht nur drei verschiedene Namen, also etwa c, his und deses, sondern auch drei verschiedene Funktionen, die vom Komponisten als solche behandelt und vom Ohr entsprechend wahrgenommen werden.
Das Umstürzende, gewissermaßen die kopernikanische Wendung, welche die Lehre Schönbergs vollzieht, besteht darin, daß die enharmonische Zwölfordnung durch eine abstrakttemperierte ersetzt wird, wodurch sich der gemeinsame Tonort der Noten c, his, deses in einen neutralen Tonwert C verwandelt. Damit ist Tonwert = Tonhöhe, Tonordnung = Tastenordnung.
Die „demokratische Gleichheit” aller Töne der Skala hat zur Folge, daß es weder Grund- noch Leitton, weder Dissonanz noch Konsonanz — wenigstens theoretisch — geben kann. Damit sind eigentlich auch die bisherigen, auf eben diesen Elementen basierenden musikalischen Formen, von der Fuge bis zum Sonatensatz, unbrauchbar geworden. Daß sie von Schönberg und seinen Schülern gelegentlich trotzdem angewendet wurden, ist eine jener vielen Inkonsequenzen, die jedem System anhaften — und die den Primat des Künstlerischen und Schöpferischen bezeugen.
In einer Vorlesung an der Universität von Los Angeles am 26. März 1941 hat Schönberg eine gewissermaßen wissenschaftlich-philosophische Fundierung seiner Lehre gegeben: „Die Einheit des musikalischen Raums fordert eine absolute und einheitliche Erfahrung (perceptio). In diesem Raum, wie in Swedenborgs Himmel — beschrieben in Balzacs „Seraphita” —, gibt es weder ein absolutes Unten noch Rechts noch Links, Vor- oder Rückwärts. Jede musikalische Konfiguration, jede Tonbewegung ist hauptsächlich zu verstehen als eine Wechselbeziehung von Klängen, von oszillierenden Schwingungen, die örtlich und zeitlich differierend auftreten. Für die Vorstellungs- und Schöpferkraft aber sind Beziehungen in der materiellen Sphäre ebenso unabhängig von Richtungen und Ebenen, wie materielle Gegenstände in ihrer Sphäre es für unsere Erfahrungskraft sind. So wie unser Verstand beispielsweise stets ein Messer, eine Flasche oder eine Taschenuhr wieder erkennt, ohne Hinblick auf ihre Lage, und diese vorstellungsmäßig in jeder Lage reproduzieren kann, so kann auch der Verstand eines Tonschöpfers unterbewußt mit einer Tonreihe operieren, ohne Hinblick darauf, wie ein Spiegel die Wechselbeziehungen zeigen würde, die eine gegebene Größe bleiben… Bekanntlich findet die Reihe in Spiegelform Anwendung (Grundreihe, Umkehrung, Krebs und Umkehrung des Krebses). Die Anwendung dieser Spiegelform entspricht dem Prinzip der absoluten und einheitlichen Erfahrung des musikalischen Raumes.”
Damit ist der einzelne Ton aus seiner räumlichen und zeitlichen Fixierung innerhalb der Skala herausgelöst und im Sinne eines Weltbildes, wie es die moderne Naturwissenschaft uns zeigt, gleichzeitig verselbständigt und — als Eigenwert — relativiert, indem er den übrigen elf Tönen gleichgesetzt wird.
Wie sich Schönberg selbst gesehen hat, als Mensch und als Schaffender, geht aus einem Dankbrief an die American
Academy of Arts and Letters hervor, die ihm im Jahre 1947 einen Preis für hervorragende Leistungen zuerkannte:
„Daß alles, was ich während dieser 50 Jahre zu vollenden suchte, nun von Ihnen als eine Leistung bewertet wird, scheint in mancher Hinsicht eine Überschätzung zu sein. Ich persönlich hatte das Gefühl, in einen Ozean mit kochendem Wasser gefallen zu sein, und da ich nicht zu schwimmen oder auf andere Art einen Ausweg zu finden wußte, versuchte ich es mit Armen und Beinen, so gut ich konnte. Ich weiß nicht, was mich rettete, warum ich nicht ertrank oder lebendig gekocht wurde — ich habe vielleicht nur ein Verdienst, daß ich es nie aufgab. Ob meine Bewegungen sehr ökonomisch waren oder völlig sinnlos, ob sie mein Weiterleben unterstützten oder behinderten — es war keiner da, der mir geholfen hätte, und es gab auch nicht viele, die mich nicht gerne hätten erliegen sehen. Ich behaupte nicht, daß es Neid war — was gab es da zu beneiden? Ich bezweifle auch, daß es Mangel an gutem Willen war. Es könnte ihr Wunsch gewesen sein, diesen Alpdruck, diese unharmonische Folter, diese unverständlichen Gedanken, diesen methodischen Wahnsinn loszuwerden, und ich muß zugeben, es waren keine schlechten Menschen, die so dachten — obgleich ich natürlich nie verstand, was ich ihnen angetan hatte, sie so boshaft, so wütend, so fluchend, so aggressiv zu machen. Noch immer bin ich sicher, ihnen niemals etwas genommen zu haben, das ihnen gehörte. Ich hatte niemals in ihre Rechte, ihre Privilegien mich eingemischt, niemals unbefugt ihren Besitz betreten. Ich wußte nicht einmal, wo er lag, welche die Grenzen ihres Grundstücks waren, und wer ihnen das Recht auf diese Besitzung gegeben hatte. — Ich bin stolz, diese Auszeichnung unter der Voraussetzung empfangen zu haben, daß ich etwas vollendet habe. Bitte nennen Sie es nicht falsche Bescheidenheit, wenn ich sage: Mag sein, daß etwas vollendet worden ist, aber ich bin es nicht, der dafür Achtung verdient. Diese Achtung muß meinen Gegnern gezollt werden. Sie waren es, die mir wirklich halfen.”
Nachdem die alte Ordnung aufgegeben war, galt es, eine neue zu begründen. Schönberg hatte schon lange bevor er seine „Entdeckung” bekanntgab mit der Reihenkomposition experimentiert. Schon frühzeitig hatte er Schüler, aber er hat nie Zwölftonkomposition unterrichtet. Das System wurde erst später von seinen Adepten ausgearbeitet, vor allem von Emst Krenek.
Vor Beginn der Komposition wählt sich der Musiker die „Reihe” oder „Grundgestalt” (früher: Thema oder Themen-
gruppen). Sie muß alle zwölf Töne der chromatischen Skala enthalten, denn das erst ergibt eine Ganzheit (Hanns Jelinek), aber jeden Ton nur einmal. Zuviel gleichartige Intervalle müssen vermieden werden. Verboten ist auch die Aufeinanderfolge von mehr als zwei großen oder kleinen Terzen (damit nicht der Eindruck bestimmter Tonarten entsteht). Die Reihe ist lediglich das thematische Material. Die Entwicklung der Melodie aus der Grundgestalt, die Übertragung der Reihe, ihre Verwandlung in ein lebensvolles Thema ist Aufgabe der schöpferischen Kraft des Musikers. Sie erfolgt nach melodischen, metrischen und rhythmischen Gesetzen. Im Verlauf der Komposition darf die Reihe nur folgenden Veränderungen unterworfen werden:
• Umkehrung (Inversion der Intervalle)
• Krebs (rückläufige Form)
• Umkehrung des Krebses in der Grundgestalt
• Krebs der Umkehrung (sie hat die gleichen Intervalle wie sie dritte Veränderung, ist jedoch transponiert).
Zusammenklänge (Akkorde) kommen dadurch zustande, daß aufeinanderfolgende Töne der Grundgestalt statt in linearer Folge nacheinander nun vertikal-gleichzeitig erklingen. Ernst Krenek unterscheidet bei der kontrapunktischen Bearbeitung der Reihe Schärfegrade der Zusammenklänge:
• Konsonanzen sind: kleine und große Terz, Quint, kleine Sext und große Oktave.
• Milde Dissonanzen: große Sekund und kleine Sept.
• Scharfe Dissonanzen: kleine Sekund und große Sept.
Wichtig erscheint auch ein Hinweis Ernst Kreneks zum Formbegriff. Das Streben nach Symmetrie ist ein charakteristisches Zeichen der europäischen musikalischen Formen, während der Gregorianische Choral und die ältere Musik des Vorderen Orients aus einer Kette von kleinen individuellen und verschiedenen, aber feststehenden Gliedern aufgebaut ist, die unaufhörlich, mosaik- oder besser: kaleidoskopartig in immer neu kombinierten Zusammenstellungen wiederholt werden (diese Grundgestaltungen heißen in der persisch-arabischen Musik Maquam, in der indischen Raga, in der javanischen Patet). Mit der atonalen Musik der Wiener Schule um Arnold Schönberg erhält das Prinzip der Wiederholung der Grundgestalt erneute Bedeutung, ja Vormachtstellung. Dem orientalischen Formbegriff entspricht auch die Rhythmik der freien Artikulation des Wortes, während in der abendländischen Musik das symmetrisch-skandierende Prinzip vorherrscht (den gereimten Versen und den geschlossenen Strophen entsprechend; man vergleiche etwa die Textdeklamation Schuberts, des klassischen Meisters der Liedform). Im späten 19. Jahrhundert, etwa im Musikdrama Wagners oder bei Hugo Wolf, durchdringen sich beide Kräfte. In der atonalen Musik hat das Prinzip der prosaartigen freien Artikulation entschieden den Vorrang.
Sosehr, auch von den Theoretikern der Zwölftonmusik, die Bedeutung der Persönlichkeit des Komponisten und des schöpferischen Ingeniums betont wird, so entschieden werden alle folkloristischen Elemente abgelehnt. So entsteht eine übernationale Musiksprache, eine Art Welt-Esperanto — wie die Kritiker der neuen Musik sagen. Indem sie den Ausdruck der individuellen Emotion (Espressivo-Stil) aufs äußerste steigert, ist sie zugleich Symbol der Einsamkeit des Menschen. Der unaufhörliche kaleidoskopische Wechsel der Grundgestalt, die beständig kreisende Bewegung der Reihe oder ihrer Teile suggeriere „einen fragmentarischen Sektor der Ewigkeit”. Schließlich: zwischen tonaler und atonaler Musik bestehe die gleiche Parallele (und der gleiche Unterschied) wie zwischen der klassisch-mechanischen und der modernen Physik.
Durch das menschliche Vorbild Schönbergs, die Sprengkraft seiner neuen Erkenntnisse, den Glaubenseifer ihrer Verkünder, nicht zuletzt durch die kontinuierliche und faszinierende Wirkung der Musik von Alban Berg ist die Zwölftonmusik längst nicht mehr — wie zu Beginn — eine esoterische Lehre. Davon zeugen die Werke zahlreicher Komponisten in aller Welt, die sich zu Schönberg bekennen: Henze, Fortner und Hartmann in Deutschland; Leibowitz und seine Schüler in Paris; Liebermann, Martin und Vogel als „Angeregte”; Krenek in den USA; Apostel und Jelinek in Wien; Dallapiccola in Italien, wo anläßlich der skandalumwitterten Premiere von Nonos „Intolleranza 1960” der junge Komponist sich sehr ausdrücklich zu Schönberg und dem durch das Monodram „Erwartung” und die Oper „Die glückliche Hand” inaugurierten musikdramatischen Stil bekannte.
Solche musikalische Ereignisse und künstlerische Bekenntnisse müssen uns eigentlich davor warnen, die Wirkung Schönbergs als abgeschlossen zu betrachten, obwohl bekanntlich unter den Jungen und Jüngsten Schönbergs Freund und Schüler Anton von Webern mit seinen Modellen in höherem Ansehen steht. Die von Webern praktizierte serielle und punktuelle Technik, mit deren Hilfe ein neuer Klang- raum entdeckt wurde, hat eine Weltbewegung in der Musik ausgelöst, die von New York über Paris und Warschau bis Tokio reicht. Aber das ist bereits die zweite Phase der zeitgenössischen Musikentwicklung und „eine andere Geschichte”.
Auf den Einwand, daß trotz aller Anstrengungen die meisten Zwölftonwerke auf den Elfenbeinernen Turm und sein Publikum beschränkt blieben, könnte man entgegnen, daß die Elfenbeinernen Türme von heute vielleicht die Zentren der Fora von morgen sein werden. Und gesetzt den Fall, diese Werke erreichten nie die Popularität der Schubert- Lieder oder des „Rosenkavalier”-Walzers:… Allgemeingültigkeit, Gemeinverständlichkeit ist wohl ein wünschenswertes Akzidens, aber keineswegs die conditio sine qua non der großen Kunst, wie uns eine Reihe bedeutendster Musikwerke bestätigt, von der geistlichen Chormusik eines Heinrich Schütz und der Kunst der Fuge von J. S. Bach bis herauf zu Beethovens letzten Streichquartetten und Pfitzners „Palestrina”. Den Zeitgenossen jedenfalls steht es nicht zu, Kunstwerke nach ihrem Erfolg zu werten. Und auch diesen soll man nicht messen, sondern, womöglich, wägen. Und das Schwere und Schwierige erweist sich oft, ja meist auch als das Wertbeständige und Dauerhafte.