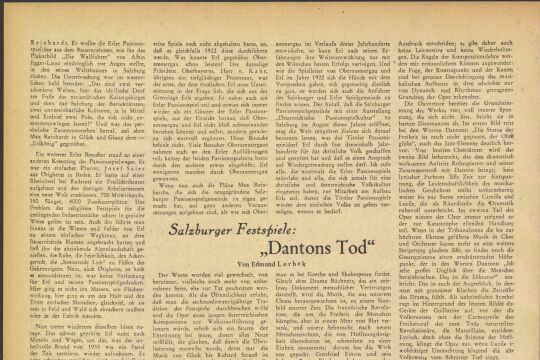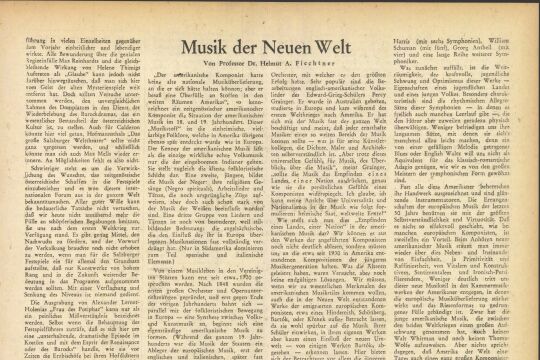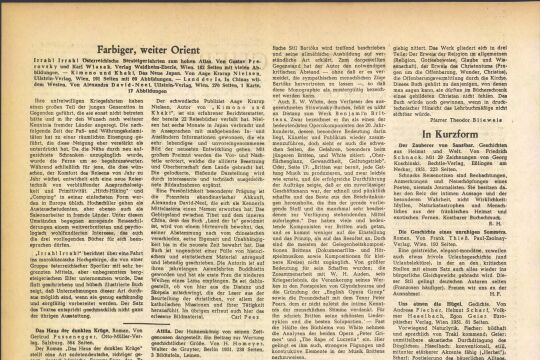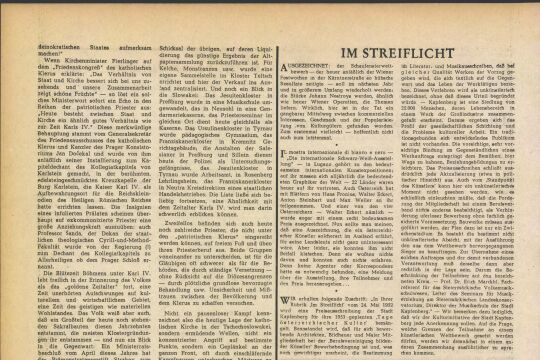Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wege der Oper
Operngäriger sind, was man in der Tierkunde Omnivoren nennt. Sie verzehren jede Art und jede Zusammenstellung künstlerischer Kost: Antike, Barock, Romantik, Naturalismus und Moderne; Gesang, Rezitativ, Sprache mit und ohne Begleitung; Kammermusik und Hundert-Mann-Orchester und zirpendes Cembalo; Clownerie und Heroik; Pantomime, Volkstanz und Spitzenballett; Illusionstheater, Stilbühne und Dekorationslosigkeit; Prima- donnen-Hegemonie und Ensemblekunst; die besten Orchester und die schlechtesten Orchester; die größten Dirigenten und ahnungslose Taktschläger; gute Sänger, mittelmäßige Sänger und miserable Sänger. All das und noch hunderterlei anderes wirkt zusammen, steht in unseren heutigen Opernbetrieben eng benachbart und bildet insgesamt einen unabdingbaren Bestandteil dessen, was wir so gern unser kulturelles Leben nennen. Das merkwürdigste ist, daß diese additive, scheinbar von Willkür zusammengetragene Gattung repräsentativ für den Zeitgeist einer Epoche wirken kann. Daß sie Stile auskristallisiert, Kunstfragen höherer Art zu beantworten imstande ist und mitunter sogar eine geistige Elite anzieht. Natürlich ist die Oper tot. Sie war es vom Augenblick ihrer Geburt an; von Zeit zu Zeit merken es die Kritiker und schreien Mordio, ohne daß die Situation sich darum ändert. Gerade diese Totgeborenheit hat immer wieder die großen Geister von Rinuccini und Moliere über Goethe bis zu Hugo von Hofmannsthal, Jean Cocteau, Bertolt Brecht und W. H. Auden zu Belebungsversuchen gereizt, von den großen Musikern zu schweigen.
Ein Lagebericht von Anno 1954 muß Symptome aller Arten berücksichtigen. Er muß die Gründung von Opernensembles an vielen Universitäten der Vereinigten Staaten, die Serienaufführungen von Opern Gian-Carlo Menottis in den Schauspiel- und Musikkomödien-Thea- tern des New-Yorker Broadways so sorgfältig registrieren wie die Fakten, daß das ruinierte Deutschland nach 1945 sich seine rund siebzig Opernbühnen jährlich etwa 200 Millionen Mark an öffentlicher direkter und indirekter Subvention kosten läßt und daß die Sowjetunion 36 Staatsopern unterhält. Er muß die strengen Stilisierungsversuche von der Szene her Carl Qrff und von der Musik her Luigi Dallapiccola, Hans Werner Henze so ernstlich gegeneinander abwägen, wie er die Rückkehr zu veristischen ‘Melodietypen Gottfried von Einems „Prozeß" registrieren wird. Die szenische Reinigung und Ausspartechnik der neuen Bayreuther Wagner-Inszenierungen wird ihm so bewußt sein müssen wie die holly- woodesken Revuekünste, mit denen die Pariser Große Oper so erfolgreich die Renaissance der „Indes Galantes" von Rameau und des „Oberon" von Weber betreibt — bis zur Zerstäubung von Parfüm bei den Blumenszenen.
Denn in den Künsten der Bühne ist das Schöpferische enger mit dem Praktischen verbunden als in irgendeiner anderen Kunst. Alles, was sich da im geistigen Bereich zuträgt, hängt mit dem materiellen Bereich zusammen, wechselseitig beeinflußt sich die ästhetische Phantasie und die Forderung des Ortes und Tages. Im ganzen ist allerdings das Operntheater ein schwerfälligerer und konservativerer Apparat als die Schauspielbühne, die viel rascher auf Zeitströmungen reagiert und deren Spielplan schneller wechselt und gegenwartsnäher ist als der der Oper.
Fortschritt in der Kunst bedeutet Sprachbereicherung. Die Richtung des Weges ist unwichtig. Rückschritte können fortschrittliche Funktion haben. Gemessen an der Transzendenz der Mittel in Arnold Schönbergs beiden Einaktern „Erwartung" 1909 und „Die glückliche Hand" 1910 bis 1913, weist Alban Bergs „Wozzeck" 1923 auf weniger entwickelte musikdramatische Typen zurück. Und dennoch hat Berg die Gattung Oper im „Wozzeck" weiter in die Zukunft getragen als Schönberg selbst in „Von heute auf morgen" 1929.
Für die Gruppe, die noch im Licht und im Schatten Wagners stand — und zu ihr gehören Debussy und Strauß ebenso wie Schönberg, Pfitzner, Schreker, Strawinsky und Alban Berg —, hieß das Problem: Verinnerlichung des Pathos. Es ließ sich auf vielerlei Arten anpacken. Zum Beispiel durch die Debussysche Technik der Verschleierung: das Orchester schildert zwar Seelenzustände, es „psychologi- siert", es läßt Motive vernehmen, die mit dem jeweiligen szenischen Geschehnis in Zusammenhang stehen, aber das alles findet sozusagen kn Halbschlaf statt, an der Grenze von Traum und Realität. Man leidet im Grunde genau , so wie bei Wagner gelitten wird, doch es geschieht con sordino.
Oder man verzichtet ‘— und das ist der Schönbergsche Weg -— auf die psychologische Motivik und differenziert gleichzeitig die Kunst der Beschwörung von Stimmungen sehr abseitiger Art, so daß ein neuer künstlerischer Status animae geschaffen wird.
Oder man über,,wagnert" Wagner mit seinen eigenen Mitteln, bis der Sättigungspunkt erreicht ist, und löst dann den pathetischen Psychologismus auf in ein Spiel von scheinbarer Indifferenz und artistischer Ueber- raschung: das Verfahren Richard Strauß’ bis zur „Elektra" und vom „Rosenkavalier" an.
Gegen alle diese Methoden meldet sich etwa um die Zeit des ersten Weltkriegs schon eine gewisse Skepsis, die der Musik selbst höhere Rechte an der Opernform eingeräumt wissen möchte. Die Wirkungen des psychologisieren- den und ästhetisch stellvertretenden Orchesters werden als abgenutzt empfunden, die verfließenden Grenzen zwischen den Teilformen, wie sie Wagners Methode des „Durchkomponierens" und der unendlichen Melodie eingeführt hatte, widersprechen einem neuen Sinn für musikalische und für melodische Kontur. Das früheste Ergebnis dieser Skepsis legt Fer- ruccio Busoni vor; es ist der von Philipp Jarnach vervollständigte Torso des „Doktor Faust". Hier wird zum ersten Male wieder seit einer Generation die Welt der musikalischen Formen auf das Drama projiziert. Das heißt, daß nicht vom Text, von der Handlung, von der Szene her die klingenden Gestalten sich fügen und erfüllen, sondern daß die Musik in die herrschende Stellung zurückversetzt wird, die Mozart ihr gegenüber der Poesie zugewiesen hatte. „Doktor Faust", 1925 nach Busonis Tode in Dresden uraufgeführt, neuerdings durch die Dortmunder Bühne zu neuem Leben erweckt, :war in. vieler Hinsicht ein revolutionäres Werk. Seine Musik ist durchaus polyphon, ja bewußt im Geist des „linearen Kontrapunktes" . erfunden, ohne dabei in die von Richard Strauß als deutsches Erbübel bezeichnete kontrapunktische Undurchsichtigkeit zu geraten. Sie will stilistisch zum Prinzip er-, heben, was bei Wagner und Verdi nur ganz gelegentlich auftritt: die Enthüllung des Un- . geschauten, das, was Busoni „Klanghorizont" oder „akustische Perspektive" nennt. Vor allem aber treten die absoluten musikalischen Formen in ihr Recht.
Etwa gleichzeitig schrieb Berg den „Wozzeck", in völliger Unabhängigkeit von Busoni, ja ohne daß beide auch nur von den Arbeiten wußten, geschweige denn ahnten, daß sie ähnlichen Prinzipien folgten. Und wenige Jahre darnach, 1927, zeigte Paul Hindemith im „Cardillac", daß Busonis Vorbild schöpferischen Erfolg hatte.
Alle diese Versuche und Leistungen sind in großen stilistischen Zusammenhängen zu verstehen. Die Abkehr von den programm-musikalischen Vorstellungen der deutschen und der französischen Romantiker, die ja die Musik zu einer Begleit- und Illustrierkunst machten, gab dem Musiker unvergleichlich größere Rechte und Verantwortungen. Sie führte zu einer neuen Hierarchie, zu einer Besinnung auf die eigenen formbildenden Kräfte der Tonkunst. Busonis „Faust", Bergs „Wozzeck" und Hindemiths „Cardillac" sind Bekenntnisse zur Autonomie-Aesthetik. Was ihnen, namentlich den erstgenannten beiden, besonderes Gewicht gab, war die Sicherung vom Stoff her. Das Faust-Puppenspiel und Georg Büchners sozialpsychologisches Drama erfüllen die Forderung nach hoher literarischer und ideeller Würde, die seit Wagner nicht überhört werden konnte. Bei Berg entsprach das dem ihm eigentümlichen Trieb nach allseitiger Sicherung des Kunstwerkes, das ihn eine so erstaunliche Synthese von absolut-musikalischer Form, psycho- logisierender Orchestersprache und Leitmotivik. großem symphonischem Zusammenhang und klarer Gliederung kleiner Formen finden und dem Ablauf der Büchnerischen Szenen zuordnen ließ.
Wie wird der Weg weitergehen ? Es ist kein Zweifel möglich, daß die musikalischen Formen in der Oper an Wichtigkeit gewinnen werden. Nur wo sie sich verbinden mit neuen Mitteln der Dramaturgie, mit allen Möglichkeiten, die sich aus der Kombination menschlicher Stimme, Gestik und Mimik mit instrumentalem Klang ergeben, ist das innerste Gesetz der Oper erfüllt. Nicht Uebergewicht eines ihrer integrierenden Teile, sondern Gleichgewicht ist, von allen epochalen Schwankungen abgesehen, das Ziel. Das Cocteausche Ideal, daß ein Kunstwerk allen neun Musen genügen soll, wird in der jungen, der beginnenden Kunstform der Oper Erfüllung finden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!