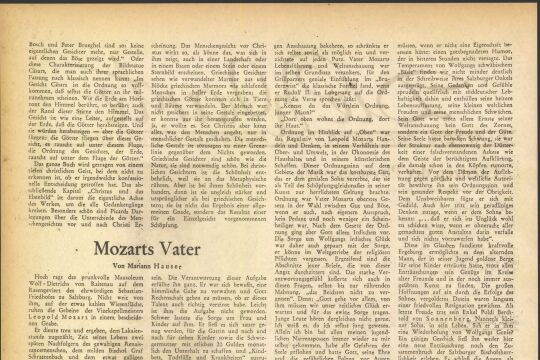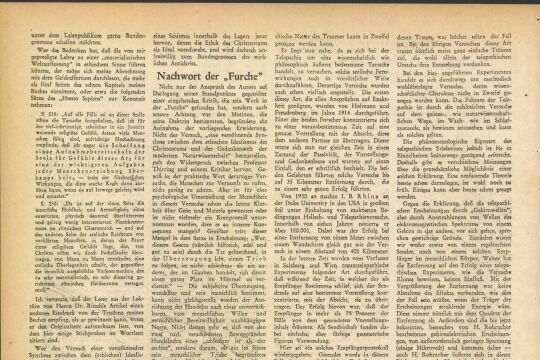Die Kinematographie ist ein Kind des Naturalismus. Vom Abbild der Wirklichkeit ging sie aus. Für sie gab es ursprünglich keine geistigen Inhalte, sie beschränkte sich auf die Aufnahme und Wiedergabe des rein Gegenständlichen. Hinter den bewegungserfüllten Bildern stand in der ersten Zeit nach 1895 kein Sinn, kein Sinnbild, keine Idee. Es war dem Film einstweilen nur darum zu tun, Bildillusion und photographierte Wirklichkeit einander möglichst zu nähern. Vor dem bewegten Bild kapitulierte die Kritik. Schon die ersten Ergebnisse der kinematographischen Technik fanden reichen Beifall. William Kennedy Laurie Dickson, einer der hervorragendsten Mitarbeiter Edisons, nannte zum Beispiel das Kino „die Krone und Blume der Zauberei des 19. Jahrhunderts“ und behauptete, man könne sich kein lebendigeres und natürlicheres Abbild vorstellen, die Illusion sei vollkommen. — Nun, wir wiederholen derartige Urteile mit einer gewissen Reserve. Denn mit den damaligen Apparaten konnte weder eine flimmerfreie, farbtonrichtige und in der Bewegung fließende Wiedergabe erreicht werden, noch war wegen der Kürze der Einfühlungszeit — die Filmchen waren ja nicht länger als 17 Meter! — jene Faszination durch das sich bewegende Bild möglich, wie sie etwa gegen Ende des ersten Viertels unseres Jahrhunderts die Zuschauer in ihren Bann zog.
Und dennoch war man von der Naturtreue der Kinobilder entzückt, ja man betrachtete sie nicht als Illusion, sondern gewissermaßen als Wirklichkeit selbst!
In diesem Zusammenhänge erhebt sich eine nicht unwesentliche Frage. Indem man erkannte, daß die theatralische Illusion wesensverschieden von der filmischen ist, sprach man von der „Unbestechlichkeit" der Filmkamera. Sie könne, so sagte man, nur ein tatsächlich vorhandenes, und zwar vor ihrer Linse vorhandenes Bildgeschehen aufnehmen. Projiziert bietet der Filmstreifen sozusagen eine Wiederholung des photographisch fixierten Geschehens. Ein Boxkampf bleibe ein Boxkampf und ein lächelnder Diplomat müsse doch auch von der Leinwand herablächeln. Gewiß, die Wirklichkeit bleibt auch in der Projektion dieser Bilder gewahrt. Aber wir wissen seit den bahnbrechenden Arbeiten des im Vorjahre verstorbenen amerikanischen Regisseurs David Wark Griffith und seit den Erkenntnissen der Russen über die künstlerische Montage, daß wir mit Einstellung, Beleuchtung und Bewegung des Aufnahmeapparats sowie mit Hilfe des Filmschnitts einen Boxkampf als edles Kräftemessen oder als brutale Entartung des Sports darzustellen imstande sind und daß das Diplomaten- lächeln freundlich-gewinnend, verschlagen, dumm und sinnlos wirken kann. Derselbe Mann erscheint je nach Kameraeinstellung — also einer persönlichen Einstellung des Operateurs zum photographierten Objekt — wie ein Standbild, zu dem man aufblickt, oder als harmloses Figürchen, das man nicht ernst zu nehmen braucht.
Ein zweites lehrreiches Beispiel: Der russische Regisseur Wsewolod Pudowkin unternahm mit seinem Kollegen Kuleschow einen klassischen Versuch. Er schnitt aus irgendeinem Film die Großaufnahme des Schauspielers Iwan M o s j o u- k i n e (Moschuchin) heraus. Es handelte sich um eine Aufnahme ohne besondere mimische Aussagekraft. Sie wurde vor eine Aufnahme eines Suppentellers geklebt. Der Zuschauer erhielt den Eindruck, Mosjoukine betrachte die Suppe. In ähnlicher Weise wurde dann die Aufnahme eines Sarges mit einer darin liegenden Frau und schließlich mit dem Bilde eines spielenden Kindes kombiniert. Als diese drei Montagen hintereinander vorgeführt wurden, erweckten sie bei den Zuschauern den Eindruck, als hätte der Schauspieler in der ersten Szene den Teller melancholisch, in der zweiten die tote Frau schmerzlich und in der dritten das Kind glücklich angeblickt. Die Aufnahme Mosjoukines war aber immer die gleiche gewesen. Hier haben wir es also mit einer neuen Art der Illusion zu tun.
Daß aber die Wirklichkeit durch einen Montagetrick umgekehrte Vorzeichen erhalten kann, beweist uns ein drittes Beispiel, das wir dem Buche „Der Geist des Films" von Bela B a 1 ä z s entnehmen. Sergej Nikolajewitsch Eisensteins Film „Der Panzerkreuzer Potemkin", einst ein berühmtes Werk, wurde von der Zensur eines skandinavischen Staates verboten. Der Verleiher, der sich von der Aufführung des Films ein gutes Geschäft versprach, änderte durch einen geradezu genialen Trick den Film, ohne aber etwas herauszuschneiden oder hinzuzufügen. Bela Baläzs berichtet: „Bekanntlich beginnt der Film mit Szenen der Matrosenmißhandlung. Dann sollen die ,Unzufriedenen erschossen werden. Im letzten Augenblick meutert die Mannschaft. Revolte auf dem Schiff. Kämpfe in der Stadt. Zuletzt erscheint die Flotte, läßt aber das revoltierende Schiff passieren. So die Szenen- und Bilderfolge des Original-Potem- kins.
Nach dem Schnitt der kühleren skandinavischen Schere sah der revolutionäre Film folgendermaßen aus: Er begann, in medias res, gleich mit der Meuterei, also nach der Szene der verhinderten Hinrichtung. Von da an lief er aber unverändert bis zum Schluß, bis zum Erscheinen der Flotte. Nicht eines der aufreizenden revolutionären Bilder wurde weggeschnitten. Was geschah denn da für die Zensur? Nur eine kleine Umgruppierung. Nur, daß der Film nicht mit dem Erscheinen der Flotte zu Ende war, sondern der weggeschnittene Anfang des Films ans Ende angehängt wurde. Nach der Meuterei also, nach dem Erscheinen der zaristischen Flotte, stehen nun die Matrosen zitternd in Reih und Glied. Jetzt erst werden die Unzufriedenen gefesselt und vor die Gewehre gestellt. Jetzt erst wird Feuer kommandiert — und der Film ist aus! Die Meuterei ist also unterdrückt worden, die Rebellen werden bestraft, die Ordnung ist wieder hergestellt. Den Film hätte die skandinavische Zensur ohne Bedenken durchlassen können.“
Im Film haben wir es also nicht mit der realen Welt allein zu tun. Diese Wirklichkeit bleibt allerdings nur in den ersten Filmen überhaupt unmißverständlich und naiv. Sobald der Kameramann — schon vor 50 Jahren! — den Menschen aufs Korn nahm, änderte sich die Situation. Gewiß, dieser Mensch bedeutete ursprünglich nicht viel mehr als ein Grimassenschneider. Er mußte sich deutlich ausdrücken. Da ihm das Wort fehlte, blieben ihm nur die übertriebene Gebärde und die überdosierte Mimik. Aber er ist, au da in den Höchstleistungen der Filmkunst, nie Mittelpunkt geworden. Bis zu einem gewissen Grad übernahm er im Stummfilm die Funktionen eines Requisits, denn im wahren Film sind etwa die meisten Gefühlsdarstellungen auch durch Bildsymbole möglich. Vom Menschen erscheint im Filmbild immer nur ein Teil, das Theater hingegen verlangt seinen ganzen Körper, es verlangt seine Stimme, seine Seele.
Mit dem Ton, mit dem Geräusch, mit der Sprache gewann der Film ein Feld, das die Naturnähe des Bildes ergänzte, und durch den farbigen und plastischen Film — vom ebenfalls bereits erfundenen Geruchsfilm gar nicht zu reden! — müßte, so glauben viele, die letzte Vollkommenheit im naturalistischen Sinne erreicht sein.
Vor nicht weniger als 60 Jahren, als Edison seinen Phonographen mit dem gleichfalls von ihm erfundenen Kinetoskop verband, war man dem Problem der Wirklichkeitswiedergabe nicht ferner als heute. Die Synthese von Bild und Ton ist trotz unseren Präzisionsmaschinen fragwürdig geblieben. Das Wort, das lichtgewordene Schemen auf der Kinoleinwand zu lebendigen Menschen vollenden soll, schwebt in einem Zwiespalt. Es gehört dem zweidimensionalen Bild an und breitet sich im dreidimensionalen Raum aus. Es ist also an eine flächige Erscheinung gebunden, die überdies an sich keine lebendig-fließende Bewegung besitzt, sondern auf einer Reihe unbewegter Einzelbilder basiert. Ein auf der Netzhaut des Auges sich vollziehender Verschmelzungsprozeß von fast wunderbarer Unfaßbarkeit läßt diese Momentaufnahmen zu scheinbarer Bewegung aufleben. Aus photographierter Wirklichkeit wird Illusion und wieder Wirklichkeit.
Obwohl das Wort im realen Raum existiert, fehlt ihm dennoch die Realität des Lebens. Es geht ja nicht vom lebendigen Körper der Schauspieler aus, sondern von seiner Photographie. Es ist selbst photographiert und muß einen langen Weg der Verwandlung von Schall in Licht und wieder zurück durchlaufen. Darüber hinaus muß das Wort den Gesetzen des bewegten und montierten Bildes folgen. Es begleitet den Bildstreifen nicht als „Dialog" im dramatischen Sinne. Der Filmdialog bildet nicht einmal innerhalb einer Szene ein geschlossenes Ganzes, sondern erschöpft sich in einzelnen Gesprächsfetzen, die wiederum nicht direkt, sondern nur mittelbar mit der Bilderkette verbunden sind. Ein wirklich „filmischer" Dialog entwickelt sich also nach anderen Gesetzen als der wirkliche Dialog auf der Bühne und auch als ein Gespräch im Alltag. Daraus ist ersichtlich, daß Bild und Ton einander nicht ebenbürtig sind. Man kann einen Film ohne Ton abspielen und wird ihn in seinen Hauptzügen verstehen. Aber aus dem Tonband allein dürfte die Rekonstruktion schwierig sein. Wir haben es — durch den Einsatz des Tones, durch das Geräusch und durch die Sprache — mit dem Beginn einer Entwicklung zu tun, die von der phantasielosen Wirklidikeit wegführt.
Dem Filmdialog liegt die breite Ausführung der Gedanken fern. Er . stützt sich auf das einzelne Wort. Seine Schwere oder Leichtigkeit ist von dem poetischen Gehalt des Bildes abhängig. So ist das Dialogschreiben weniger eine Frage dramatischer Wendigkeit als vielmehr ein behutsames Auswägen von Bildgewicht und Wortgewicht. Mit der Hinwendung zum Menschen, zum Menschlichen und zur Poesie der Sprache muß der Filmschöpfer erst lernen, „über unseren Mund und über unsere Augen besser zu herrschen", wie Lessing sagt.
Als vor 20 Jahren die Tonfilmära begann, setzte eine Geräuschbarbarei von ungeahnten Ausmaßen ein. Auf den naturechten Ton mußte selbstverständlich zunächst Wert gelegt werden. Dadurch, daß reale Geräusche zu vernehmen waren, mußten auch reale Geräusch q u e 1 len sichtbar werden. Damit geriet der Film wieder in das Fahrwasser des konsequenten Naturalismus. An diesem Punkte der Entwicklung schlugen die russischen Regisseure Eisenstein und Pudowkin einen neuen Weg ein. Sie betrachteten das Ton-band als Kontrapunkt des Bildes. Sie unterwarfen die Tonaufzeichnung ebenfalls der Montage, sie kombinierten sie zu einem fast selbständigen künstlerischen Ganzen. Bildraum und Tonraum mußten sich in ihren Filmen keineswegs decken, ja, die Inkongruenz beider ergab erst Reize, die vorher, als Geräusch und Geräuschquelle den Sinnen des Zuschauers gleichzeitig zugeleitet wurden, nicht entstehen konnten. So führte der akustische Kontrapunkt eine Abwendung von der naturalistischen Auffassung herbei, trotz der äußersten technischen Präzision bei Aufnahme und Wiedergabe realer akustischer und optischer Elemente.
Durch die Sprache des photographischen Bildes ist der Mensch zum Thema der Filmkunst geworden. Die Sprache, die aus seinem Munde erklingt, umschreibt seine Persönlichkeit. Das Wort erst ermöglicht im Film jene durchgebildeten Charaktere, die der Stummfilm, nur in Weiß und Schwarz zeichnend, nicht kannte.
Immer näher rücken Physik und Chemie der realen Welt zu Leibe. Und immer weiter muß sie sich dem Film entziehen, will er in die Bezirke der Kunst elntretėHj will er nicht Konservenbild der Wirklichkeit sein. Wenn idi zu Beginn gesagt habe, daß die Kinematographie ein Kind des Naturalismus sei, so muß ich gerechterweise feststellen, daß er es geblieben ist, allerdings nur in seinen technischen Voraussetzungen. Es sei zugegeben, daß et sowohl dem Expressionistnus, als auch dem Symbolismus seinen Tribut gezollt hat. Sonderbarerweise fand der malerische Surrealismus ifti Fllffl einen kargeren Boden, als es die zweifellos vorhandenen Voraussetzungen hätten vermuten lassen. Die Verlockungen, das naturalistische Material zu nutzen, waren im Film zu groß.
Die Wendung zur Kunst wird sich auch beim Film in der Zuordnung ZU einer Idee vollziehen. Die Idee des Theaters ist Jahrtausende lebendig: es lebt aus dem mythischkultischen Spiel um Diesseits und Jenseits, aus dem Zwiespalt zwischen Mensch und Gott, Vater und Sohn, Mann und Weib. Die Idee des Films ist Verzauberung, Magie, Sirtndeütung des Seienden durch das Bild) Überwindung von Raum und Zeit, Verlebendigung von Gedanken, die uns erfüllen, die uns quälen, uns bewegen, uns bekämpfen und erheben. Nicht der Naturalismus der tiäiven Photographie darf sein Ziel sein, sondern der Flick der beweglichen Kamera hinter die Dinge, hinter die Geschehnisse. Dieser Bilde Weitet die Welt des Gegenständlichen aus. Es ist nicht der Blick des Reporters, sondern des Dichters, des Sehers.
wußte um das Verhältnis von Religion und Volktum. Wünsche der Polen nach eigenen Schulen und Organisationen wurden, vielfach ' gegen den Widerstand der zuständigen Stellen in Berlin, gewährt. Die polnische Bevölkerung mußte bald einsehen, daß unter einer solchen Regierung gut zu leben war.
Die aus seinem praktischem Christentum erwachsene Einstellung wie die deutsche und europäische Haltung Lukascheks und seine tiefe Verwurzelung im oberschlesischen Volk konnten von den Nationalsozialisten begreiflicherweise nicht ertragen werden. Schon im Mai 1933 war Hans Lukaschek von seinem Posten als Oberpräsident von Oberschlesien entfernt, da er sich weigerte, die „Oberschlesische Volksstimme“, das führende katholische Blatt, zu verbieten. Er ließ sich nun als Rechtsanwalt in Breslau nieder. Lange vor dem nationalsozialistischen Regierungsantritt sah er schon, wohin der damals den meisten Menschen noch vernebelte Weg Deutschlands führe. „Es ahnt ja niemand das entsetzliche Ende dieses Experiments, dann und wann zweifle ich, ob ich verrückt bin, oder all die andern“ — äußerte er einmal zu jener Zeit. Seine Anwaltspraxis war eine Anwaltschaft der Bedrückten und Verfolgten des Naziregimes. Aus ganz Schlesien wurden ihm'die politisch schwersten Fälle zugetragen: Geistliche, die wegen ihrer tapferen Haltung in Bedrängnis geraten waren, Sozialisten und Kommunisten, Polen und Tschechen fanden den Weg zu ihm. Ungezählten Juden verhalf er zur Auswanderung und zum Transfer ihres Vermögens. Aber die weltklugen und hochmögenden Leute, die einst um seine Freundschaft buhlten, zogen sich angstvoll von ihm zurück, Ein leerer Raum bildete sich um ihn, und in der Straße gingen Leute, deren Wohltäter er gewesen, von weitem auf die andere Straßenseite. Aber er bildete den unsichtbaren Mittelpunkt all derer, die in Schlesien nicht so wollten wie das Regime, das lange nicht wagte, gegen ihn vorzugehen — wegen seiner Beliebtheit im Volke.
' Unterdessen hatte sich in Berlin der Widerstand gegen die Nazidiktatur konkretisiert. Es war 1940. Der „Kreisauer Kreis“, so genannt nach dem schlesischen Gut des Grafen Helmuth von Moltke, begann Pläne vorzubereiten für den Aufbau eines neuen christlichen Deutschland. Katholiken und Protestanten und Sozialisten wirkten eng zusammen, organisierten ihre Kräfte. Für das Unternehmen vom 2 0. Juli 1944 war er als Landesverweser von Schlesien ausersehen. Stauffenberg hatte den Befehl an das Breslauer Generalkommando, sich Lukaschek zu unterstellen, bereits herausgegeben, bevor das Vorhaben zusammengebrochen war.
In der Nacht zum 21. Juli wurde Lukaschek von der Gestapo in seiner Breslauer Wohnung verhaftet. Nun begann eine schwere Leidenszeit im Polizeigefängnis in Breslau, im Gefängnis der Gestapo in der Lehrterstraße in Berlin, im Konzentrationslager Ravensbrück und wieder in der Lehrterstraße, eine Zeit, voll von körperlichen Mißhandlungen, Demütigungen, Entbehrungen und Ängsten. Infolge des Bombenangriffs, der am 3. Februar 1945 den Volksgerichtshof in Berlin zerstörte, wobei auch dessen Vorsitzender Freisler ums Leben gekommen war, verzögerte sich das Verfahren gegen Lukaschek. Die Verhandlung am 19. April, die zwei Monate vorher Zum Galgen geführt hätte, endete unter dem fernen Dröhnen der russischen Kanonen mit einem Freispruch, Es folgten noch einige Tage der Spannung im Gefängnis, wo die Gestapo noch L'utzende von Gefangenen durch Genickschuß um brachte, bis sich die Gefängnistore infolge des Einmarsches russischer Truppen öffneten.
Er eilte zu seiner Frau, die sich in Berlin in einem Kloster verborgen hielt. Russen räumten das Haus und trieben die Bewohner fort. Mit einem Handkoffer als letzte Habe standen Lukaschek und seine Frau in der dunklen Nacht auf der Straße. Soldaten raubten auch noch diesen Handkoffer.
Doch Hans Lukaschek kämpfte sich durch. Als Syndikus der Berliner Stadtbank wurde er einer der Gründer der CDU in Berlin im Juni 1945. Aber seine ganze Sorge galt neben dem mühsamen Broterwerb der Hilfe für die Vertriebenen.
Von diesem Gedanken getragen, ging er Ende 1945 nach Weimar, wo er als Vertreter der CDU der thüringischen Landesregierung als Landwirtschaftsminister angehörte. Wie einst in Schlesien, so war er auch hier wieder bald der unsichtbare Träger des
Widerstandes gegen Unrecht und Gewalt. Die Machthaber erkannten das, und im Herbst 1946 wurde Hans Lukaschek von der Besatzungsmacht abgesetzt. Es gelang ihm, noch rechtzeitig zu entkommen und in Berlin Zuflucht zu nehmen. Dort begann nun wieder der Aufbau einer neuen Existenz. Als Vizepräsident beim deutschen Obergericht in Köln baute er gegen den Widerstand aller die Soforthilfe für die Ostvertriebenen auf und übernahm bei der Bildung der deutschen Bundesregierung das Ministerium für die Vertriebenen.
Lukaschek weiß, daß das von den Deutschen nicht geschaffene Vertriebenenproblem von Deutschland allein nicht gelöst werden kann. Trotzdem versucht er das Unmögliche, aus Christenpflicht und um Deutschland und damit den Rest von Europa vor dem zu bewahren, was folgt, wenn die Vertriebenen weiter der Verelendung preisgegeben werden. Ein Mann der Pflicht, ein Wohltäter der Bedrängten, ein ganzer Christ.