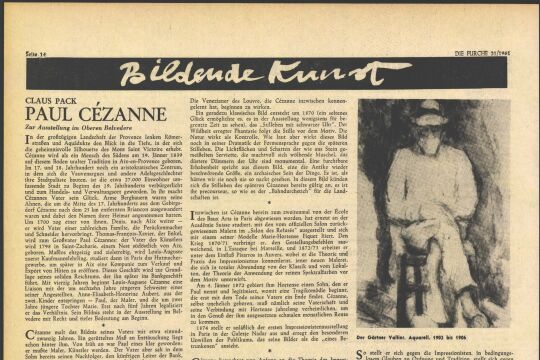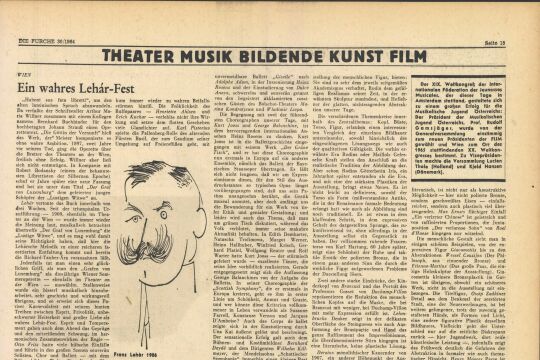Das künstlerische Ringen um Erscheinungsformen der menschlichen Existenz hat kaum ein CEuvre in diesem Jahrhundert so geprägt wie jenes von Alberto Giacometti, kaum eines wurde so nachhaltig vom Gedankengut des Existentialismus interpretatorisch vereinnahmt und erst allmählich auch formalästhetisch gewürdigt.
Die umfangreiche Ausstellung in Wien im vergangenen Jahr stellte in der Auseinandersetzung mit allen Schaffensperioden des Künst-
lers die surrealistische Plastik und die gemalten Porträts in den Mittelpunkt. In diesem Jahr gastieren Werke Giacomettis in Japan und Norwegen und die bayerische Landeshauptstadt München zeigt ihre erste Museumsausstellung dieses Künstlers. Es ist eine sehr ästhetische Präsentation des Spätwerkes in einer ganzheitlichen Sicht des Malers und Zeichners wie des Bildhauers.
In gedämpft weißem Licht sind Gemälde, Zeichnungen und Bronzen zueinander in Beziehung gesetzt, ergänzen sich. Im kurzen Vorspann mit postimpressionistischen Werken seines Vaters Giovanni Giacometti, aus dessen Einfluß sich der Sohn 1922 mit Eintritt in die Academie de la Grande Chaumrere in Paris löst, fällt jenes auf, das Alberto seine Mutter Annetta porträtierend zeigt: der eindringliche
Blick des jungen Bildhauers ist wie gebannt auf sie gerichtet. Das lebenslange Ringen um die künstlerische Umsetzung des Gesehenen scheint hier vorweggenommen.
Aus der surrealistischen Periode Giacomettis, die ihn bis zum Bruch 1935 mit den Freunden um Andre Breton verband, kann München neben bekannten Bronzen wie „Löffelfrau" und „Der unsichtbare Gegenstand" mit „Der Käfig" (1930-31) ein Werk zeigen, dessen Thematik der Künstler 1950 wieder aufgreift und das eine Verbindung herstellt zwischen dem surrealistischen CEuvre und dem Spätwerk: An die Stelle amorpher Details treten später, filigran anmutend, ein kleiner Kopf, eine Gestalt, eingebunden in ein Hochrechteck. Die schützende Bahmung umgibt später nahezu alle ge-
malten Porträts.
Wie sehr Giacometti schon während seiner regelmäßigen Aufenthalte im 1 leimatort Bergeil aus der surrealistischen Traumwelt auftauchte, auf der Suche nach einer künstlerischen Wirklichkeit, zeigen die Porträtköpfe seiner Eltern (1927). Der Kopf Giovannis verbindet plastisches Volumen mit dem nur eingeritzten Lineament der Physiognomie, verbindet die Handschrift des Bildhauers mit der des Zeichners. Seine Suche nach der Wirklichkeit führt Giacometti zurück zur Malerei, zur Auseinandersetzung mit Cezanne, führt ihn zu bildnerischen Werken wie „Diego", fast traditionell, von Ro-dinscher Prägung.
Bis 1945 ringt Giacometti um die
Wiedergabe dessen, was er selbst als das Gesehene wahrnimmt. Die „Kleine Büste auf einem Doppelsockel" steht für Minimalisierung seiner Werke in dieser Zeit. Die winzigen Figurinen rücken in unüberwindbare Entfernung, entziehen sich dem Betrachter. Mit der Erkenntnis: „Von der Wirklichkeit bleibt also nur die Erscheinung" gelangt Giacometti zu jenen transitorisch anmutenden Bild- und Gestaltfindungen in Gips und Bronze, die sich bis auf einen energetischen Kern zu verdichten scheinen, alles Sinnliche abstreifen.
Eine objektive Lebensgröße der hieratisch anmutenden weiblichen, der zuweilen ausschreitenden männlichen Ge-stalten gibt es nicht. Sie sind an kein. Maß gebunden. Unsere Seherfahrungen in bezug auf körperliches Volumen, auf umgebenden Raum und erkennbare Distanz werden ohne Bedeutung, heben sich auf. Monumentalen asketischen Körpern gleich scheinen ihre flackernden Bronzeoberflächen von einer innewohnenden Energie zu pulsieren.
„Der Mensch ist eine Art konzentrierter Kraft, die bewirkt, daß er nicht zermalmt, nicht zerdrückt wird." Die gleiche konzentrierte Kraft beschwört Giacometti im gezeichneten und gemalten Lineament seiner Porträts. Die letzte und größte Büste von Elie Lotar (1965) steht an der Schwelle vom Leben zum Hinscheiden in den Tod.