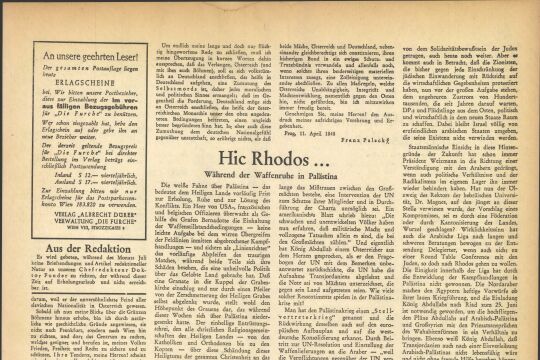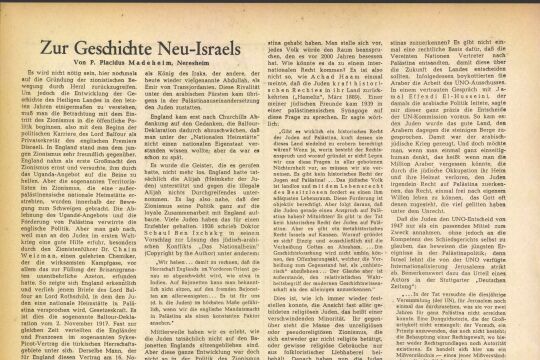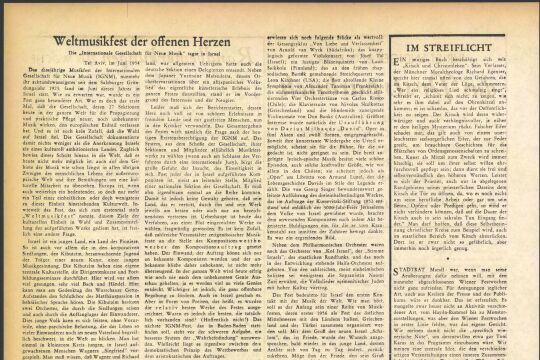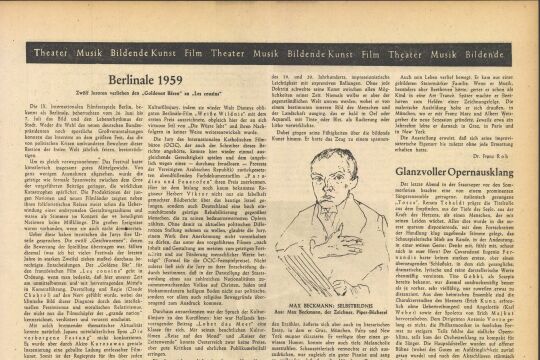Brüchige Achse „göttlichen“ Humors
Der sanftmütige ultraorthodoxe Ben trifft auf den „pragmatischen“ Beduinen Adel und gemeinsam essen sie die weiße Friedenstaube auf.
Der sanftmütige ultraorthodoxe Ben trifft auf den „pragmatischen“ Beduinen Adel und gemeinsam essen sie die weiße Friedenstaube auf.
Über ihre neue Position als Leiterin des Jüdischen Museums in Wien sagte Barbara Staudinger vor Kurzem in einem Fernsehbericht, sie werde zu hinterfragen versuchen, welche Stereotype über Juden ein jüdisches Museum (re)produziert. Ein interessanter Gedanke und ein kultureller Mentalitätsansatz, von dem Filme wie „Nicht ganz koscher – Eine göttliche Komödie“ leider weit entfernt sind. Jüdische wie arabische Klischees und Stereotype werden hier unter dem Deckmantel einer „Komödie“ aneinandergereiht, und anstatt Ressentiments zu brechen, werden sie platt reproduziert und verfestigt. In einer Geschichte, die einen Großteil ihres „Humors“ aus dem Israel-Palästina-Konflikt ziehen möchte, wirkt das geradezu dreist. Von Otto Friedrich Gleich 20 Goya-Nominierungen (der spanische Oscar) gab es, und letztendlich fünf Gewinne, darunter für den Besten Film, die Beste Regie und – natürlich für den Besten Hauptdarsteller. Fernando León de Aranoas bitterböse Filmparabel „Der perfekte Chef“ ist vor allem eines: ein Festspiel für Javier Bardem, den wohl bedeutendsten lebenden Charakterdarsteller des spanischen Films. Wer sehen will, was der Oscar-Preisträger (für die Rolle des Killers Chigurh im Coen-Thriller „No Country For Old Men“, 2007) an Nuanciertheit, Grandezza und bodenloser Bosheit in eine Figur zu legen imstande ist, der kann dies am „Perfekten Chef“ quasi prototypisch festmachen – und sich überdies an dieser Schauspielleistung ergötzen. Erzählt wird vom 30-jährigen, orthodoxen Juden Ben (sehr gut: Luzer Twersky) aus Brooklyn, der aufgrund der Verkuppelungsversuche seiner Familie zu seinem Onkel nach Jerusalem reisen muss. Dort erkennt Ben seine Gelegenheit zur Flucht: Als er nämlich erfährt, dass der einst größten jüdischen Gemeinde Alexandrias die Auflösung droht, weil sie mittlerweile auf neun männliche Mitglieder geschrumpft ist, aber zehn notwendig sind, bietet Ben sich kurzerhand an. Seine Reise nach Alexandria gestaltet sich – laut Film größtenteils wegen der Judenfeindlichkeit der Araber – als sehr beschwerlich. Der arabische Taxifahrer isst ihm sein Essen weg. Im Radio hört man von „Angriffen der Palästinenser“, auf die „Israel mit kontrollierter Verteidigung geantwortet“ Dass das Publikum von Regisseur und Drehbuchautor León de Aranoa im Vorübergehen auch noch mit beißender Gesellschaftskritik wie der Entlarvung einer speziellen Conditio humana mitversorgt wird, ist jedenfalls als zusätzlicher Vorzug des Films zu verbuchen. Julio Blanco sieht sich als Chef, wie er im Lehrbuch steht. Der Mittfünfziger hat vom seinem Vater eine große Waagenfabrik übernommen und fühlt sich als „Buen Patrón“, wie der spanische Filmtitel der Gestalt auch lautmalerisch näherkommt – für seinen Betrieb wie für seine Angestellten. Und nun ist die Firma „Basculas Blanco“ in die Endrunde für die besten Firma der Rehat. Und mitten in der Wüste wird Ben dann von den anderen arabischen Passagieren aus dem Bus geworfen, weil sie „nicht mit einem Juden an Bord“ weiterfahren wollen. Umgekehrte Szenen, in denen Juden Arabern derart „witzig“ „entgegenstehen“, gibt es im Film nicht. Die Dichotomie arabische Aggression - jüdische Verteidigung ist Achse dieses „göttlichen“ „Humors“. Nach kurzer Wüstenwanderung trifft der sanftmütige Ben den mürrischen Beduinen Adel (sehr gut: Haitham Omari), der per Auto sein entlaufenes Kamel sucht. Adel nimmt Ben mit, er ist also „ganz nett“, trotzdem ist es im Film er, der (zwecks Nahrungsbeschaffung für beide wohlgemerkt) eine (weiße) Taube töten muss, die Ben als „Symbol des Friedens“ bezeichnet. Verkauft wird diese Szene dann als „ultraorthodoxe Religionspraxis trifft auf Beduinen-Pragmatismus“, tatsächlich handelt es sich „schlicht“ um übliche Ressentiments. Erwähnt sei, dass Regisseur Stefan Sarrazin und Peter Keller dafür Drehbuchpreise erhalten haben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!