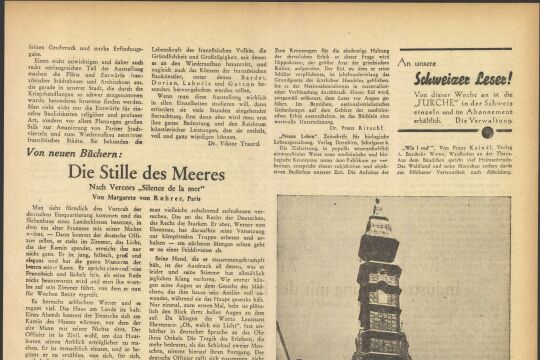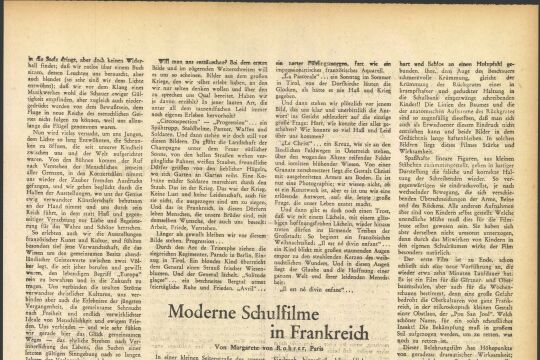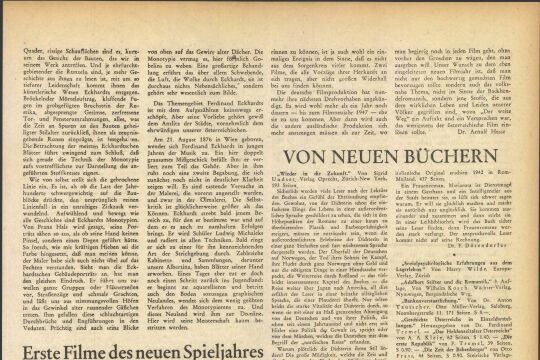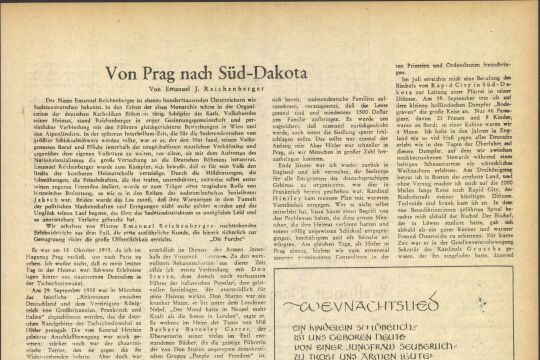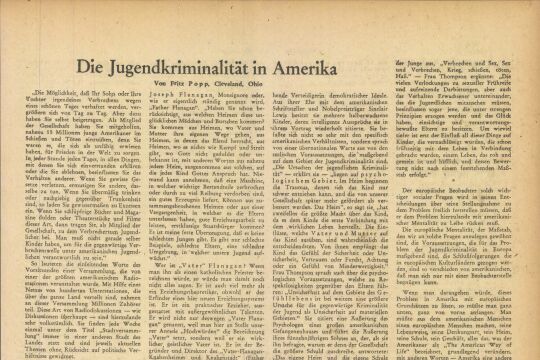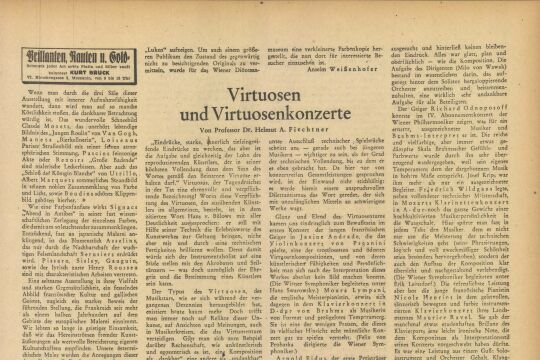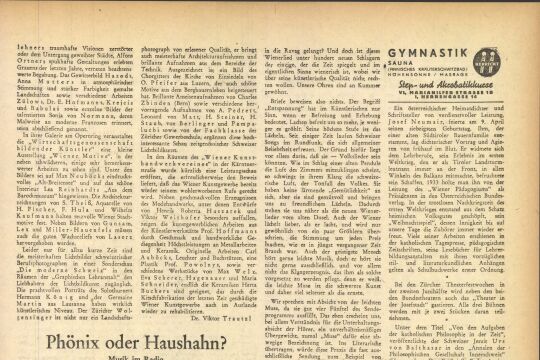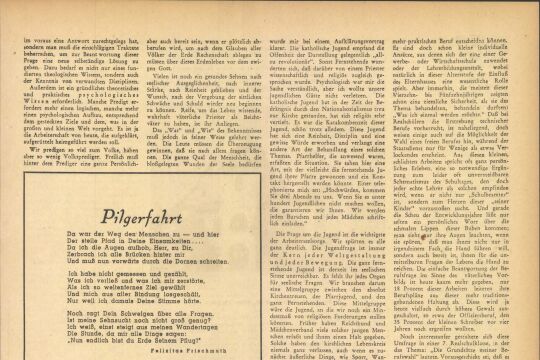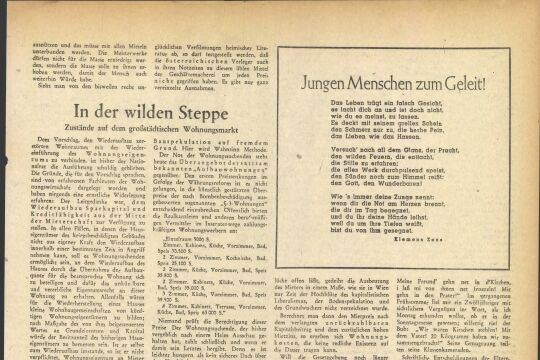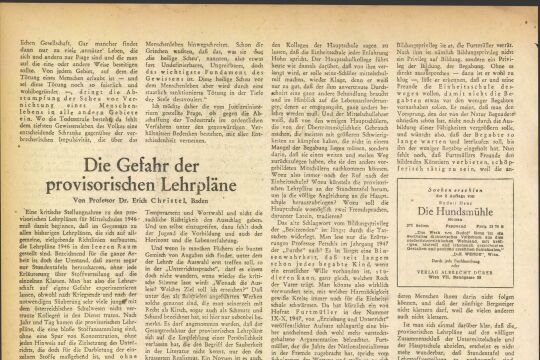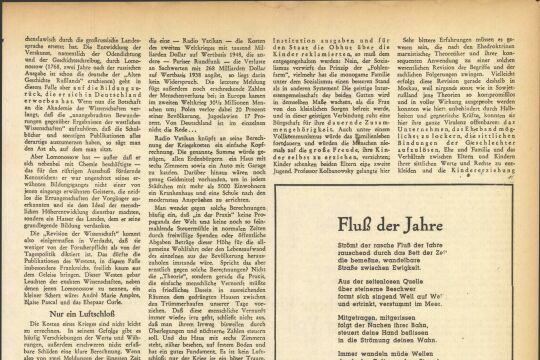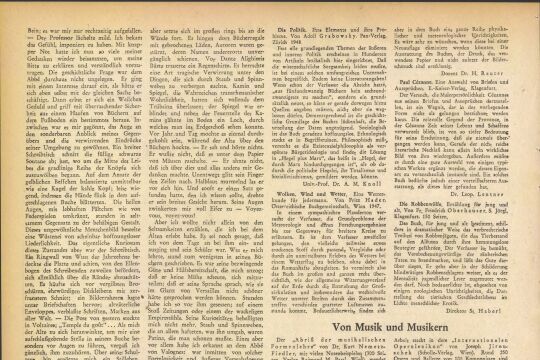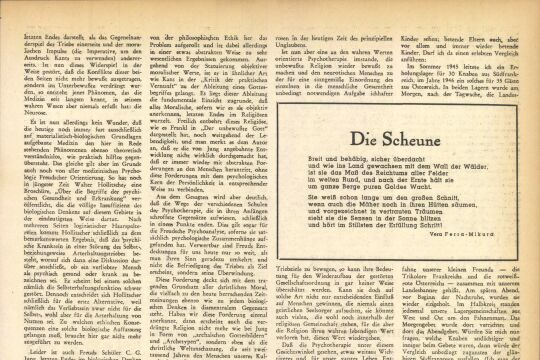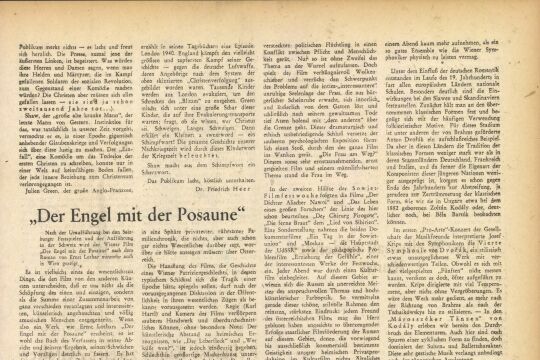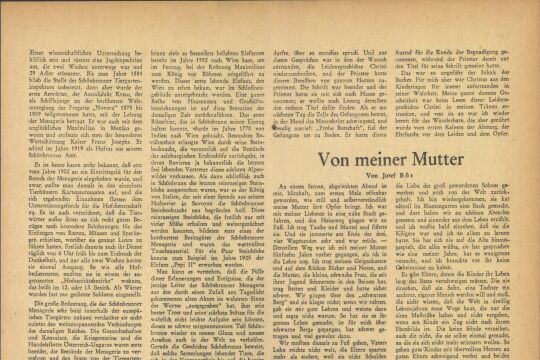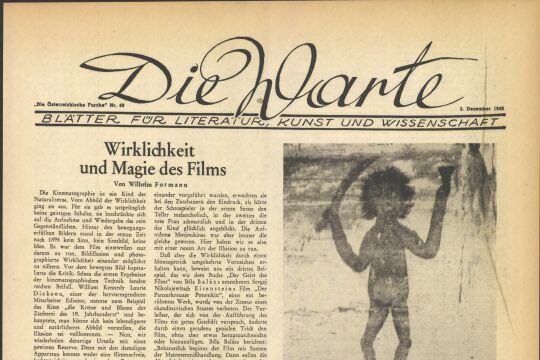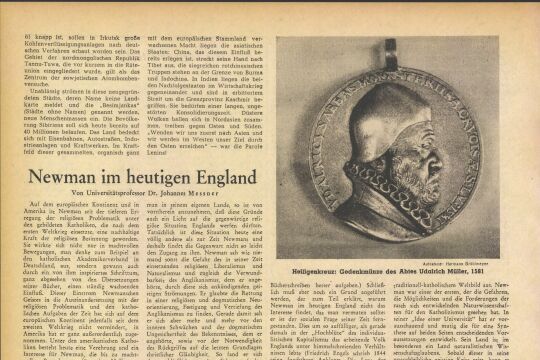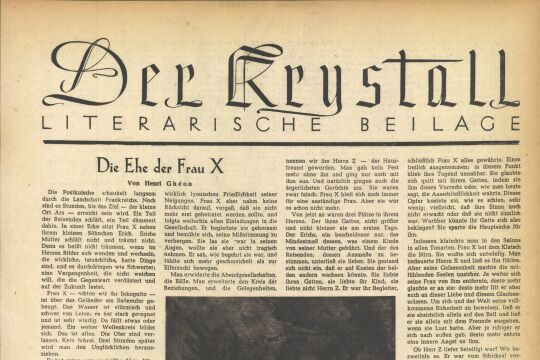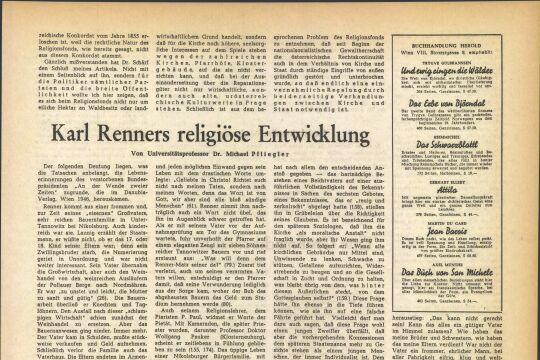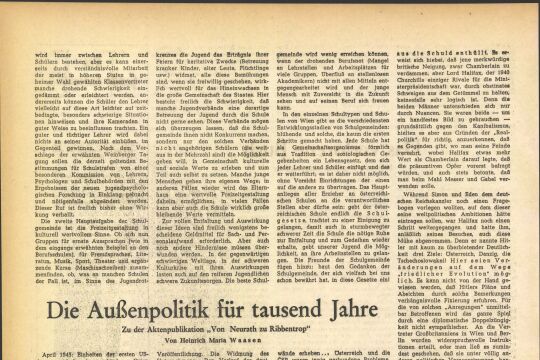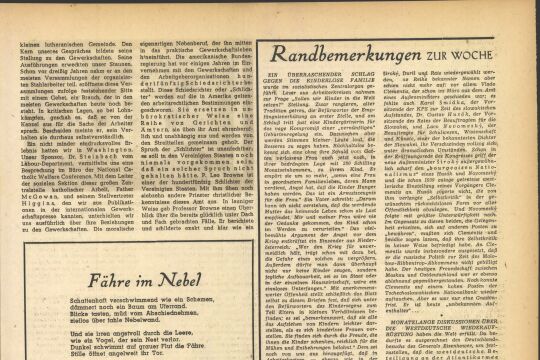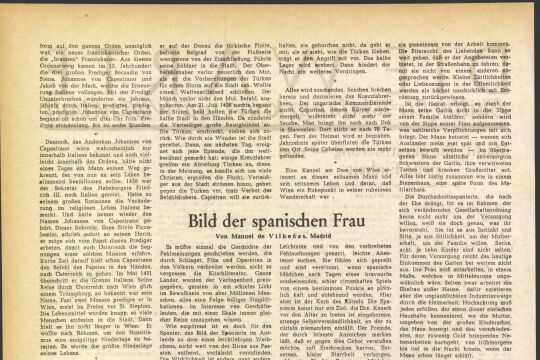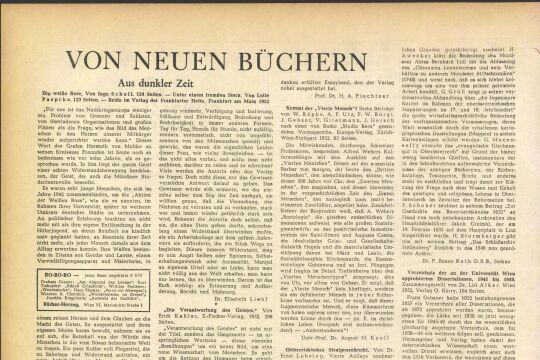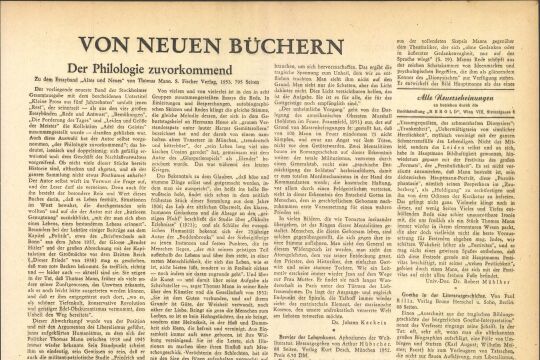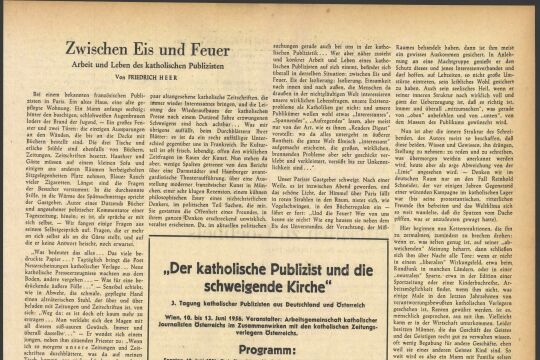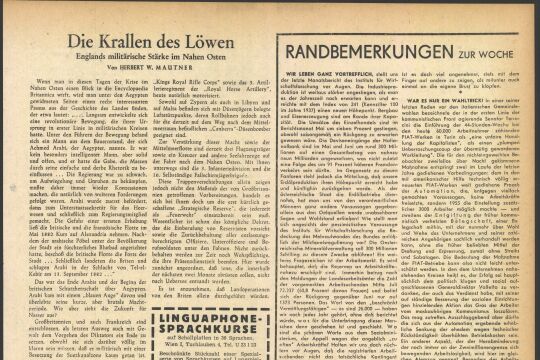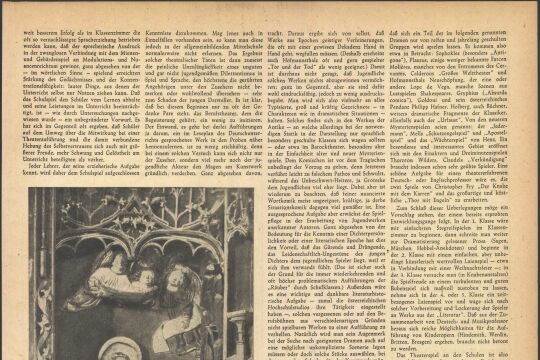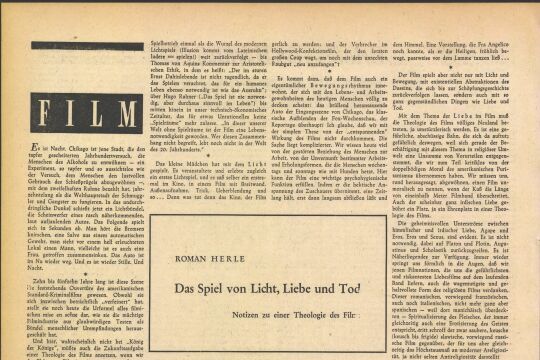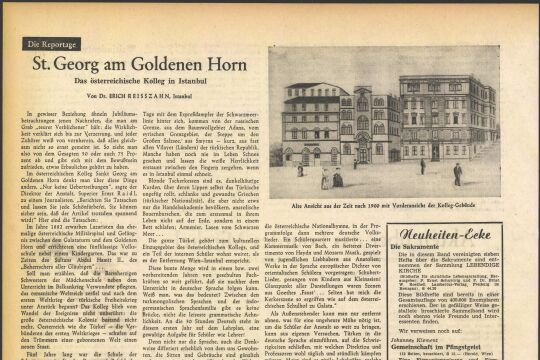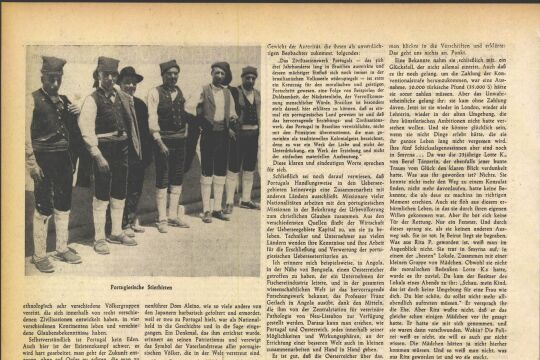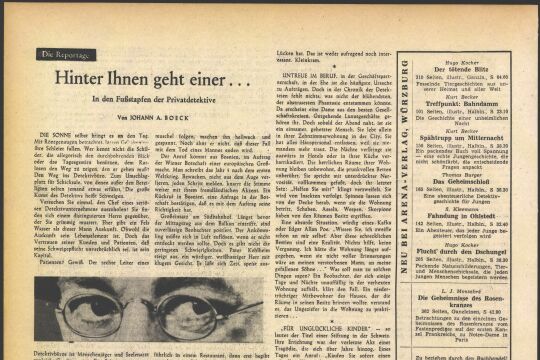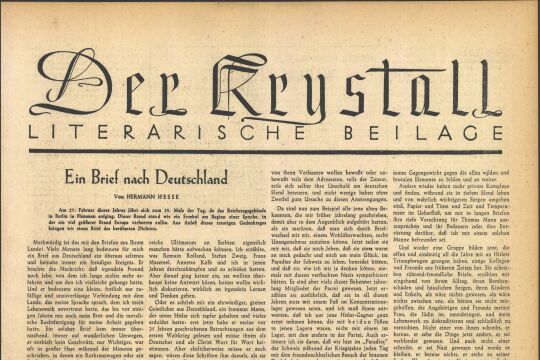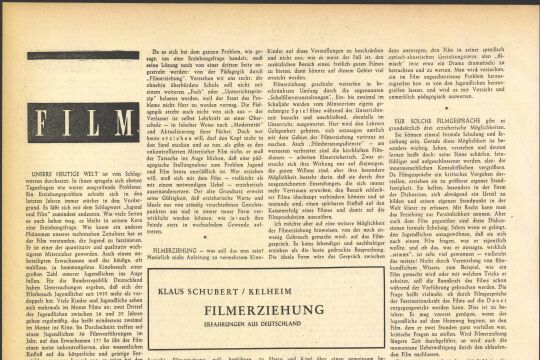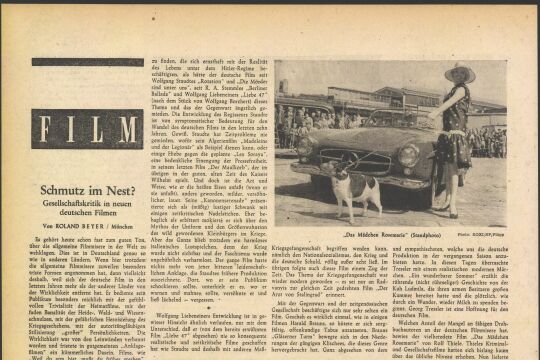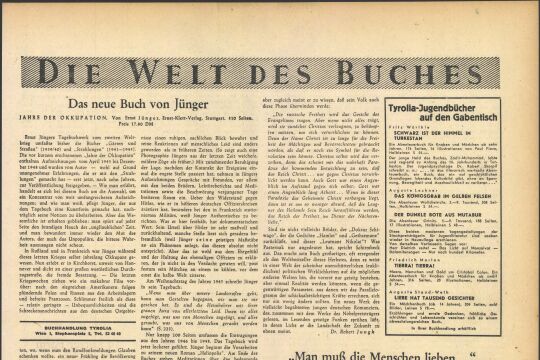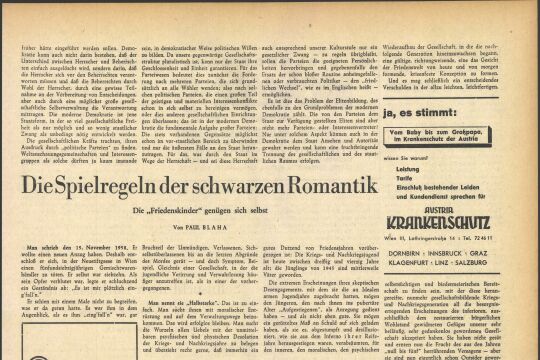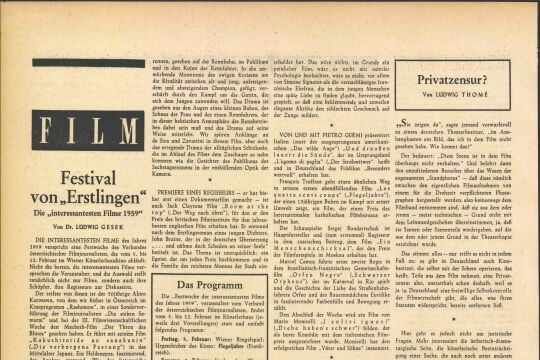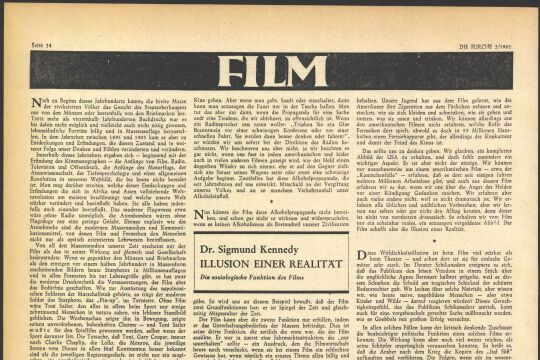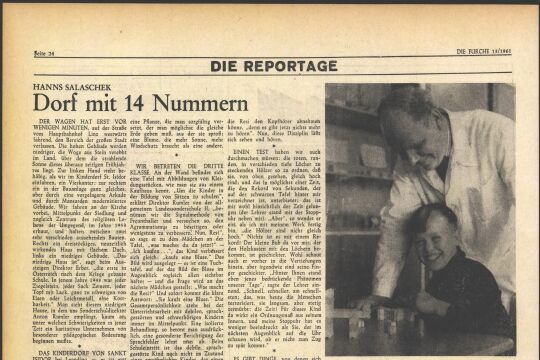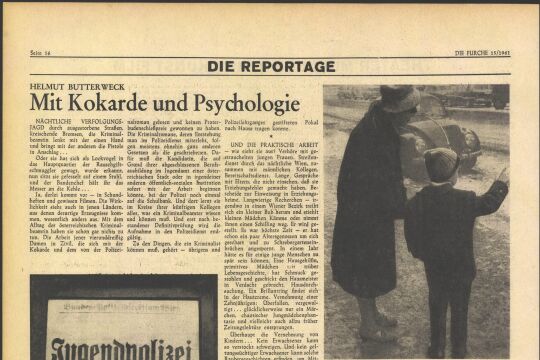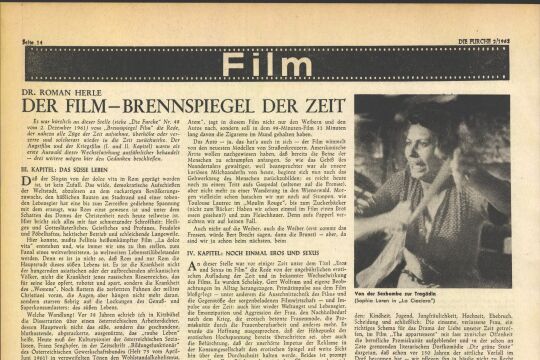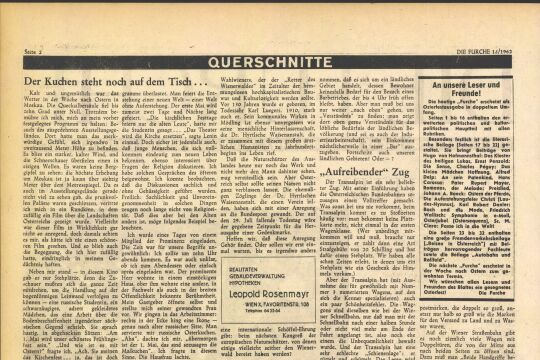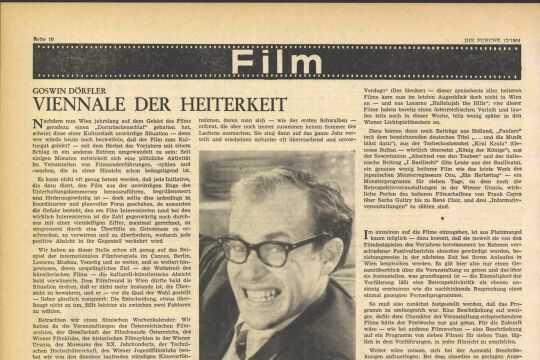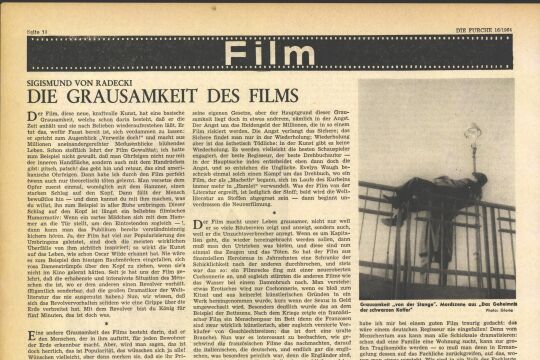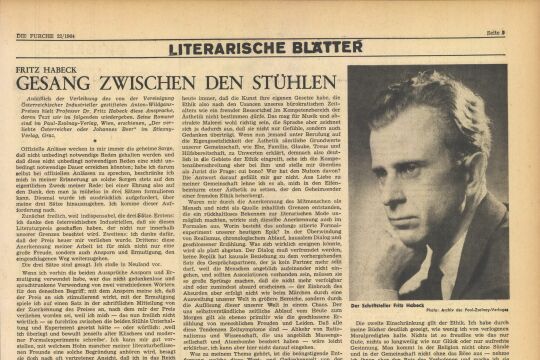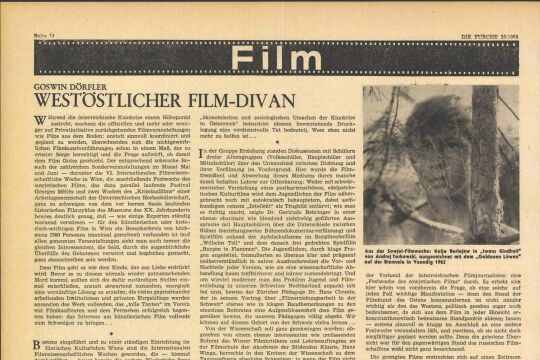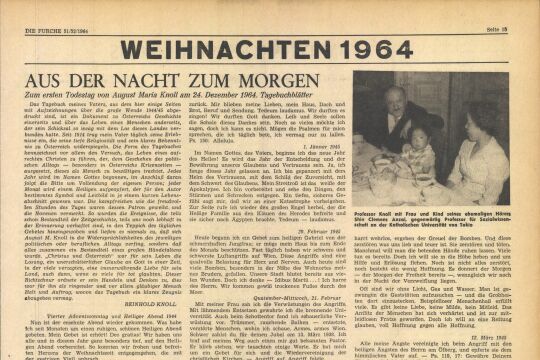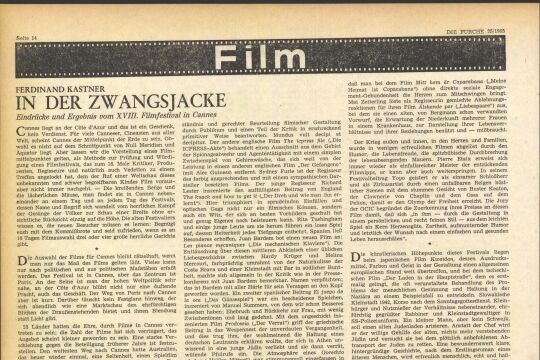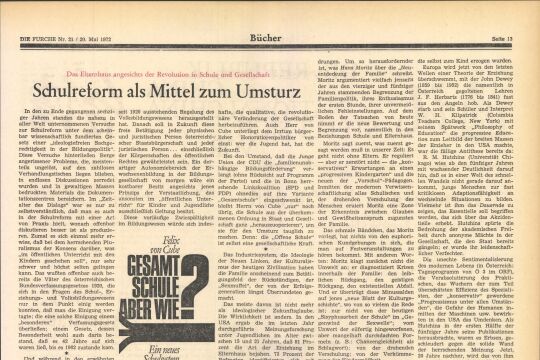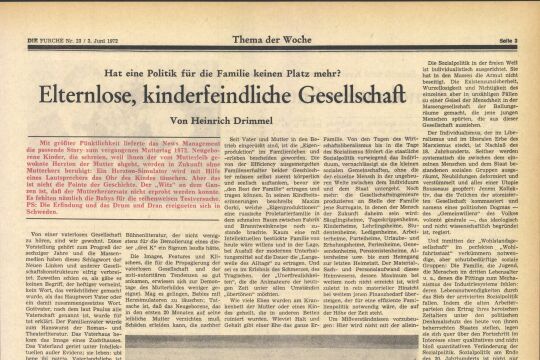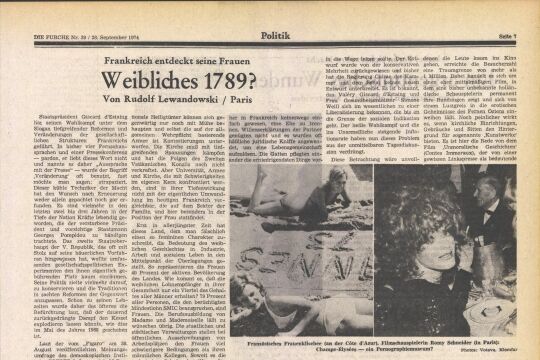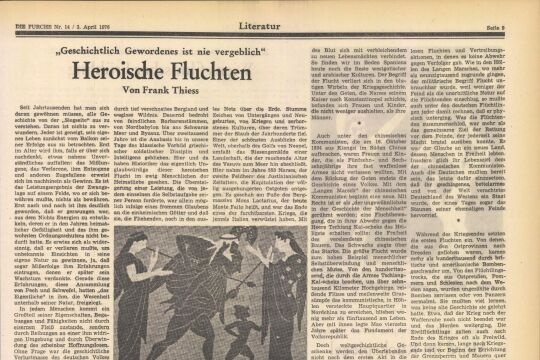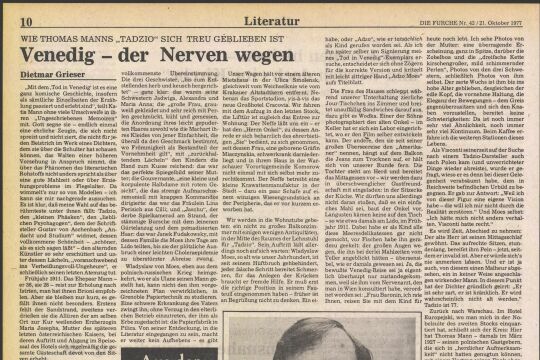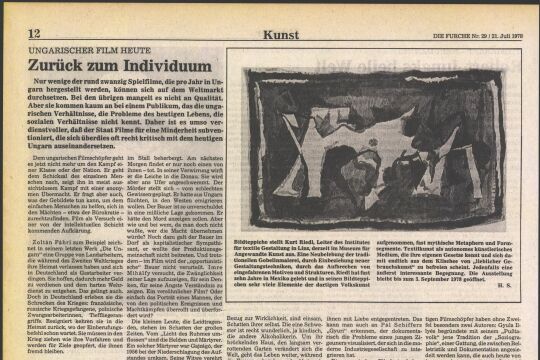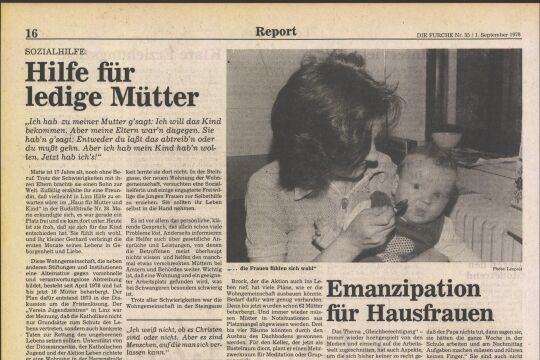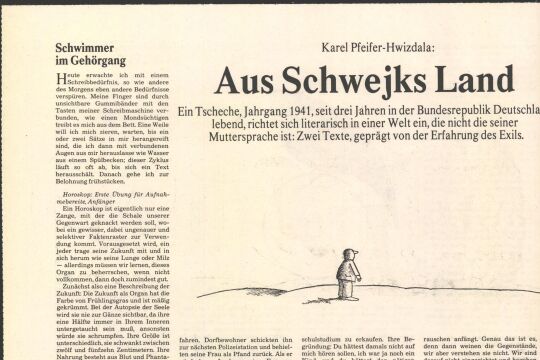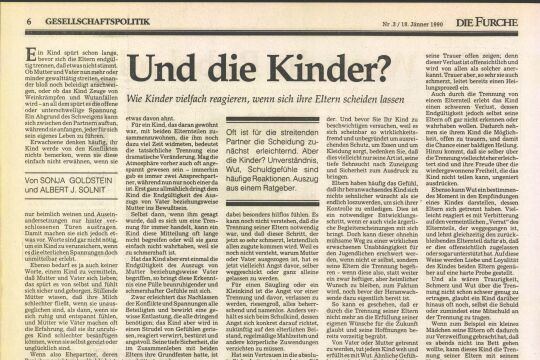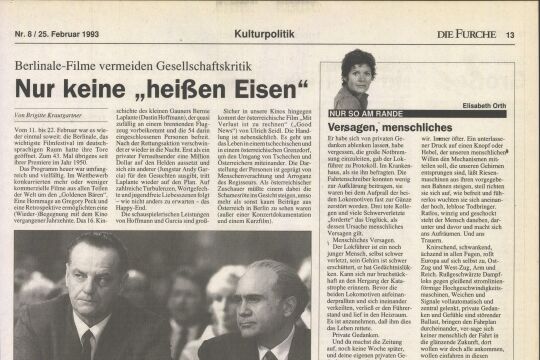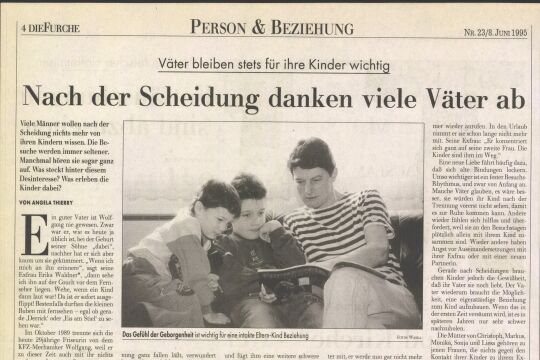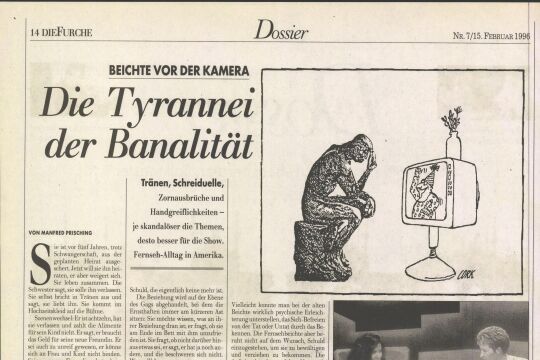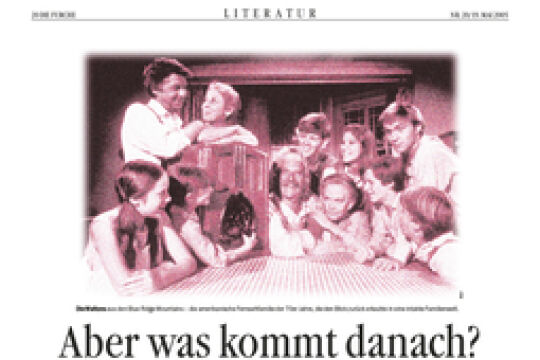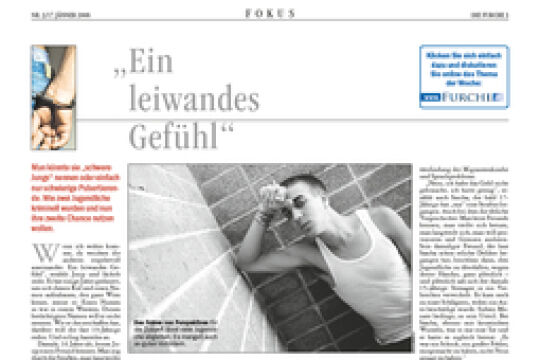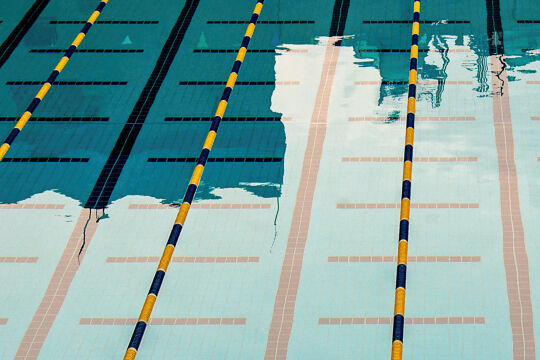Leerstelle eines Traumas
„Born in Evin“ erzählt die Geschichte von Regisseurin und Schauspielerin Maryam Zaree, die sich auf die Suche nach den Umständen ihrer Geburt in einem der berüchtigsten politischen Gefängnisse der Welt macht.
„Born in Evin“ erzählt die Geschichte von Regisseurin und Schauspielerin Maryam Zaree, die sich auf die Suche nach den Umständen ihrer Geburt in einem der berüchtigsten politischen Gefängnisse der Welt macht.
Als Maryam Zaree für ihre Dokumentation „Born in Evin“ endlich eine Frau aufspürt, die etwa gleich alt ist wie sie, fast die gleiche Geschichte hat und auch bereit ist, darüber zu sprechen, äußert diese Bemerkenswertes: Als Kinder der Besiegten seien sie dazu „programmiert, erfolgreich zu sein“. Der Beleg: Zaree hat Karriere als deutsche Schauspielerin gemacht, spielt im Berliner „Tatort“ oder war in Christian Petzolds „Transit“ zu sehen. Ihr englisches Pendant ist Psychologin geworden – ein Beruf, dem in diesem Film viele nachgehen, die selbst etwas zu verarbeiten haben. Zaree macht sich darin auf, jene Leerstelle zu füllen, die sie in ihrer Biografie verspürt. Sie weiß, dass sie als Kind der „Verlierer“ der Islamischen Revolution in iranischer Haft geboren wurde. Zu den genauen Umständen hat ihre Mutter jedoch bislang geschwiegen.
Der Vater, der getrennt davon jahrelang warten musste, ob man ihn hinrichten würde, kann darüber nichts berichten, also macht sich Zaree auf die Suche. Nach Zeugen, was damals geschah, nach Kindern, die wie sie dort zur Welt kamen. „Born in Evin“ ist durch seine Ich-Perspektive kathartisch. Unverblümt lässt die Regiedebütantin teilhaben an den Hochs und Tiefs ihres Vorhabens, einer Frage, die sie noch beantworten muss: „Was gibt’s uns, wenn wir das wissen?“ Schnell geht es nicht mehr nur um sie, sondern um eine Generation, ein kollektives Trauma. Die Kamera folgt ihr zu Treffen und Konferenzen, manchmal in eine Angst, die Jahrzehnte später und Tausende Kilometer weit weg immer noch da ist, im besten Fall aber zum gegenseitigen Mitteilen des Erfahrenen. Gelegentlich benutzt Zaree die Kamera auch, um die Welt in sich anzudeuten. Das anfängliche Bild vom Mädchen, das durch die Ödnis wandert und einen schweren Fallschirm hinter sich schleppt, wird nicht nur für sie sinnbildlich, sondern für viele, ob Opfer der Islamischen Revolution oder Kind von Holocaust-Überlebenden wie ihr Stiefvater. „Doch die Versehrten können oft nicht sprechen oder erst Jahrzehnte später“, schreibt Zaree. „Manchmal sind es auch erst ihre Kinder, die berichten können von dem Versehrtsein ihrer Eltern und selbst ihnen hat es oft die Sprache verschlagen.“
Dieser einende Gedanke des Films ist wichtig. Ebenso aber die Erzählweise, wie sich Zaree mit viel Zuneigung für die Personen und Gespür fürs heilende Heitere diesem ihrem Lebensprojekt stellt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!