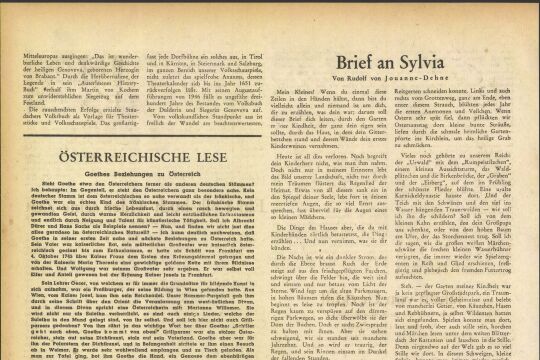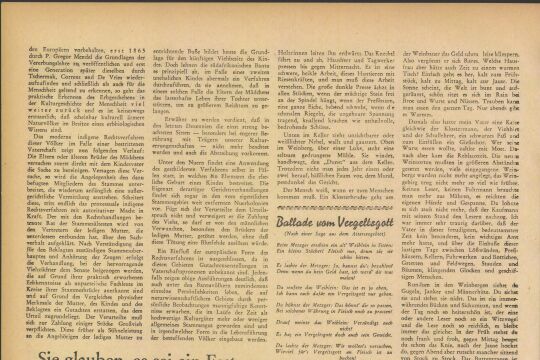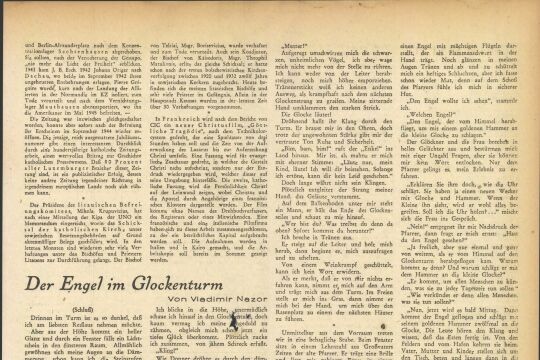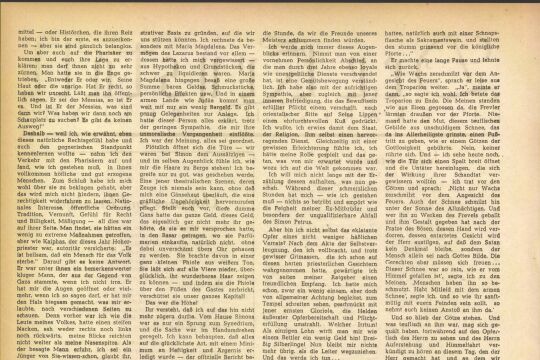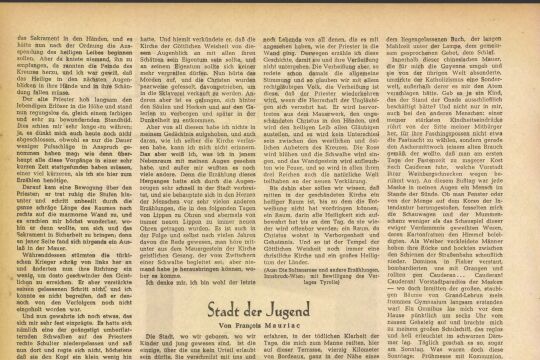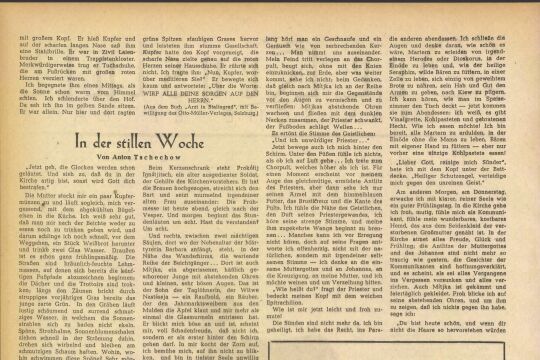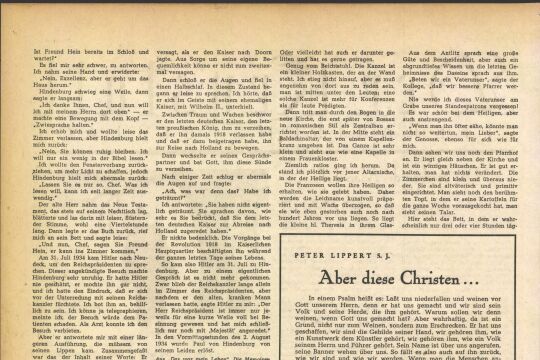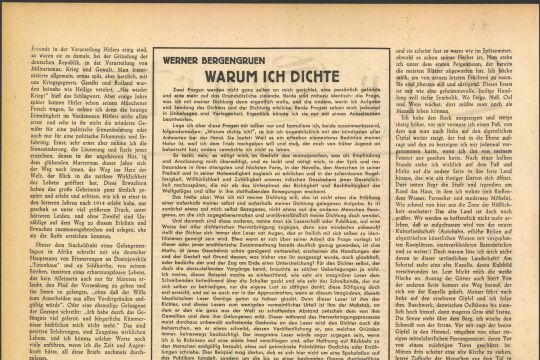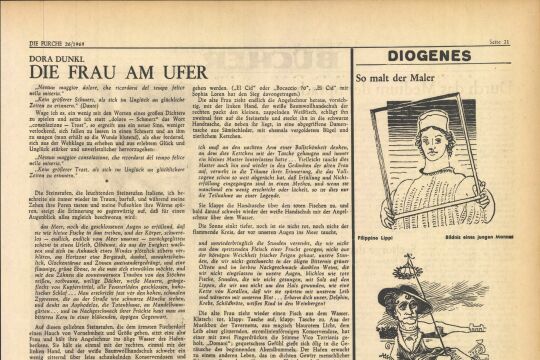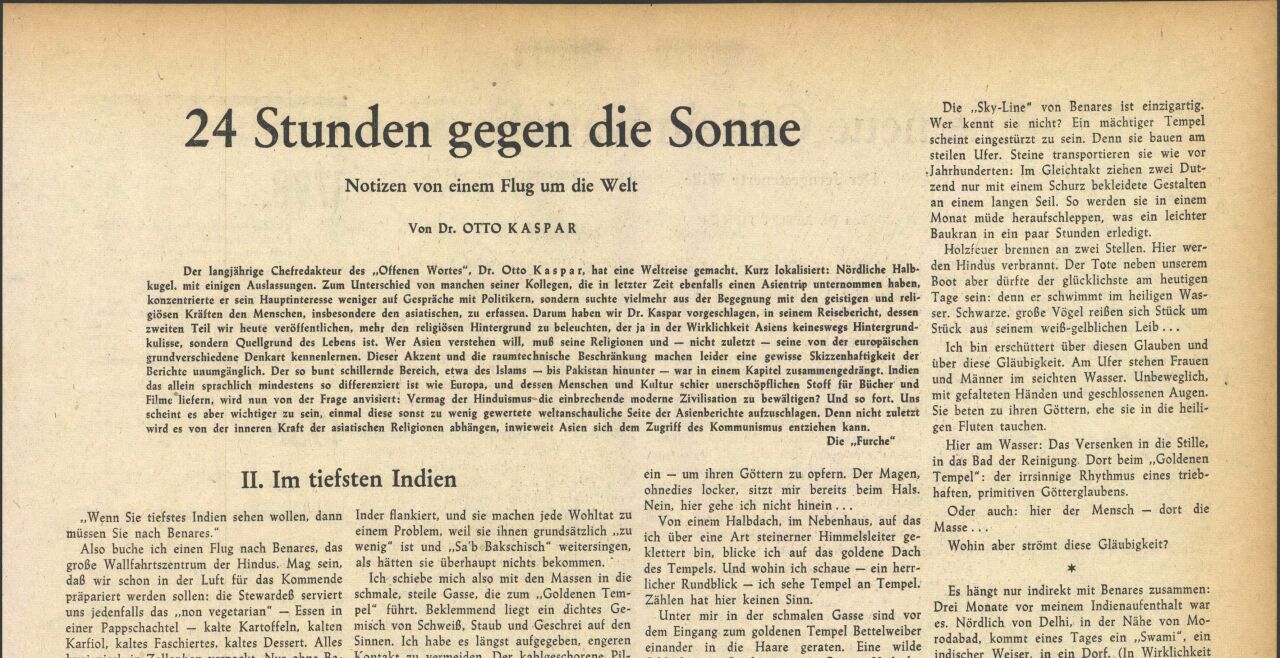
24 Stunden gegen die Sonne
Der langjährige Chefredakteur des „Offenen Wortes“, Dr. Otto Kaspar, hat eine Weltreise gemacht. Kurz lokalisiert: Nördliche Halbkugel, mit einigen Auslassungen. Zum Unterschied von manchen seiner Kollegen, die in letzter Zeit ebenfalls einen Asientrip unternommen haben, konzentrierte er sein Hauptinteresse weniger auf Gespräche mit Politikern, sondern suchte vielmehr aus der Begegnung mit den geistigen und religiösen Kräften den Menschen, insbesondere den asiatischen, zu erfassen. Darum haben wir Dr. Kaspar vorgeschlagen, in seinem Reisebericht, dessen zweiten Teil wir heute veröffentlichen, mehr den religiösen Hintergrund zu beleuchten, der ja in der Wirklichkeit Asiens keineswegs Hintergrundkulisse, sondern Quellgrund des Lebens ist. Wer Asien verstehen will, muß seine Religionen und — nicht zuletzt — seine von der europäischen grundverschiedene Denkart kennenlernen. Dieser Akzent und die raumtechnische Beschränkung machen leider eine gewisse Skizzenhaftigkeit der Berichte unumgänglich. Der so bunt schillernde Bereich, etwa des Islams — bis Pakistan hinunter — war in einem Kapitel zusammengedrängt. Indien das allein sprachlich mindestens so differenziert ist wie Europa, und dessen Menschen und Kultur schier unerschöpflichen Stoff für Bücher und Filme liefern, wird nun von der Frage anvisiert: Vermag der Hinduismus die einbrechende moderne Zivilisation zu bewältigen? Und so fort. Uns scheint es aber wichtiger zu sein, einmal diese sonst zu wenig gewertete weltanschauliche Seite der Asienberichte aufzuschlagen. Denn nicht zuletzt wird es von der inneren Kraft der asiatischen Religionen abhängen, inwieweit Asien sich dem Zugriff des Kommunismus entziehen kann. Die „Furche“
Der langjährige Chefredakteur des „Offenen Wortes“, Dr. Otto Kaspar, hat eine Weltreise gemacht. Kurz lokalisiert: Nördliche Halbkugel, mit einigen Auslassungen. Zum Unterschied von manchen seiner Kollegen, die in letzter Zeit ebenfalls einen Asientrip unternommen haben, konzentrierte er sein Hauptinteresse weniger auf Gespräche mit Politikern, sondern suchte vielmehr aus der Begegnung mit den geistigen und religiösen Kräften den Menschen, insbesondere den asiatischen, zu erfassen. Darum haben wir Dr. Kaspar vorgeschlagen, in seinem Reisebericht, dessen zweiten Teil wir heute veröffentlichen, mehr den religiösen Hintergrund zu beleuchten, der ja in der Wirklichkeit Asiens keineswegs Hintergrundkulisse, sondern Quellgrund des Lebens ist. Wer Asien verstehen will, muß seine Religionen und — nicht zuletzt — seine von der europäischen grundverschiedene Denkart kennenlernen. Dieser Akzent und die raumtechnische Beschränkung machen leider eine gewisse Skizzenhaftigkeit der Berichte unumgänglich. Der so bunt schillernde Bereich, etwa des Islams — bis Pakistan hinunter — war in einem Kapitel zusammengedrängt. Indien das allein sprachlich mindestens so differenziert ist wie Europa, und dessen Menschen und Kultur schier unerschöpflichen Stoff für Bücher und Filme liefern, wird nun von der Frage anvisiert: Vermag der Hinduismus die einbrechende moderne Zivilisation zu bewältigen? Und so fort. Uns scheint es aber wichtiger zu sein, einmal diese sonst zu wenig gewertete weltanschauliche Seite der Asienberichte aufzuschlagen. Denn nicht zuletzt wird es von der inneren Kraft der asiatischen Religionen abhängen, inwieweit Asien sich dem Zugriff des Kommunismus entziehen kann. Die „Furche“
II. Im tiefsten Indien
„Wenn Sie tiefstes Indien sehen wollen, dann müssen Sie nach Benares.“
Also buche ich einen Flug nach Benares, das große Wallfahrtszentrum der Hindus. Mag sein, daß wir schon in der Luft für das Kommende präpariert werden sollen: die Stewardeß serviert uns jedenfalls das „non vegetarian“ — Essen in einer Pappschachtel — kalte Kartoffeln, kalten Karfiol, kaltes Faschiertes, kaltes Dessert. Alles hygienisch in Zellophan verpackt. Nur ohne Besteck.
Nach heimlicher gegenseitiger Beobachtung machen wir uns mit den Händen an die Arbeit. Das heißt mit der rechten Hand natürlich. Die Linke — das wußten wir bereits — ist ja „unrein“. Das kommt von der Hygiene. Ein Kübel Wasser und die linke Hand erscheinen nämlich dem Inder praktischer als Klopapier.
So kommen wir stufenweise ins „tiefste“ Indien. Nach dem bunten Netz mit den Knoten der gleichfarbigen Dörfer glitzert plötzlich der Ganges, der heilige Fluß der Hindus, in der Vormittagssonne. Er leuchtet, als wolle er uns zeigen, daß der Götter Glanz sich in ihm spiegelt.
Von Glanz ist unten nicht viel zu sehen. Das Schwarzweiß in der beinharten Sonne dominiert. Wallfahrtsgetriebe kenne ich von daheim. Auch den Wallfahrtsrummel. Aber hier ist alles for-tissimo. Hier ist nichts ausgeglichen. Hier ist äffltfS'lffaß“ oöjA tat toi wski nr nsix “-TBtriä Aa'snahme“btfdet,¥i,eHe'ic?rt'1fe* VWfcglfe-dehnte Universitätskomplex. Er liegt außerhalb der Stadt wie ein befestigtes, englisches Koloniallager. Fast eine Oase der Stille.
Sonst aber pulst das Leben, als rausche das Blut doppelt rasch durch die Adern. Und das bei Menschen, die oft zum Abbrechen dürr sind.
Beim Affentempel mache ich halt. Ich darf nicht hinein. Nur hinauf auf die „Galerie“. Im Viereck läuft um das freie Tempelinnere ein Gang. Feiste Affen machen sich gegenseitig das Leben leichter und kratzen sich. Sie zeigen keine Eile, wenn amerikanische Touristen einem der, zahlreichen Tempeldiener eine Rupie geben, damit er die Affen füttere. Nicht aus Tierliebe, sondern für das Photoalbum.
Unten im Tempel herrscht großer Betrieb. Drei Glocken, hell bis dunkel, läuten ohne Unterlaß. Gläubige schlagen daran, dann beten sie einen Augenblick. Und geben dem Priester ein Almosen, wenn er ihnen gelbe und rote Farben auf die Stirne streicht.
In einer Ecke baden andere Gläubige und die Affen haben großen Spaß. Denn da können sie mit einem Hemd oder einer Hose davonziehen. Bis sie wieder ein Tourist als Photostatisten benötigt . ..
Ein Kunsthistoriker hätte seine helle Freude. Ich weiß nicht, wieviel tausend Tempel und Tempelchen hier existieren. Herrliche Steinarbeiten und Plastiken, oft voll derbster Volksphantasie, machen Benares auch zu einem Zentrum indischer Kunst.
Ich bin aber kein Kunsthistoriker. Darum sehe ich mehr auf die Menschen, in die ich plötzlich eingekeilt bin. Am heutigen Tag feiern sie gerade Shivaratri, das Fest der Nacht des Gottes Shiva.
Ich lasse mich im Menschenstrom treiben. Natürlich bin ich als Fremder sofort zu erkennen. Ein junger Mann geht vor mir und markiert „Führer“. Er spricht ein tolles Indo-Englisch. Ich habe ihn nicht engagiere. Das macht aber nichts. Das ist in Benares so Sitte. Am Schluß hält jeder „Führer“ die Hand auf und bekommt — immer zu wenig. Das ist in Benares auch so Sitte.
Denn in Benares fließt nicht nur der Ganges in seiner ganzen trüben Breite, und baden urd trinken die Gläubigen aus dem „heiligen Fluß“; in Benares sind auch die hartnäckigsten Bettler zu Hause. Ständig wird man von einem Schwärm „Sa'b Bakschischf“ (Herr, Bakschisch) singender
Inder flankiert, und sie machen jede Wohltat zu einem Problem, weil sie ihnen grundsätzlich „zu wenig“ ist und „Sa'b Bakschisch“ weitersingen, als hätten sie überhaupt nichts bekommen. “
Ich schiebe mich also mit den Massen in die schmale, steile Gasse, die zum „Goldenen Tempel“ führt. Beklemmend liegt ein dichtes Gemisch von Schweiß, Staub und Geschrei auf den Sinnen. Ich habe es längst aufgegeben, engeren Kontakt zu vermeiden. Der kahlgeschorene Pilger neben mir am Stock hält krampfhaft seine Messingflasche mit Gangeswasser hoch. Eine Frau im weißen Sari kreischt auf. Ich bin ihr auf die Füße gestiegen. Da sehe ich erst, daß an der Mauer eine Bettlerin neben der anderen sitzt. Alle in weißen Umhängen. Jede hat einen Blechteller für Almosen vor sich.
Ich will verschnaufen und entweiche in einen kleinen Haustempel. Aus dem Dunkel starrt der elefantenrüsselige Götterzwerg Ganesha aus drei Augen auf mich. An den Blicken der Wallfahrer merke ich, daß ich fehl am Platz bin und tauche schleunigst wieder in dem Menschenstrom unter.
Da bin ich aber gerade recht gekommen: eben will eine heilige Kuh die glitschige Gasse in der Gegenrichtung durchwandern. Ehrfürchtig wird ihr Platz gemacht. Ich quetsche mich, um nicht heiligen Aerger bei den Hindus zu erregen, an die Wand. Direkt neben einen Leprabettler. Er rückt mir mit seinen Stummeln immer näher. Er nützt die Chance — und ich kann mich nur durch einen ausgiebigen Bakschisch befreien.
Die Masse schiebt sich weiter. Keuchend, stoßend. Immer schriller werden die Stimmen. Endlich sind wir beim „Goldenen Tempel“. Ein Blick genügt.
Das Geschrei um mich macht mich halb verrückt, der Geruch des Tempelwassers will mir den Rest geben: denn am Boden des Tempels steht knöcheltief eine undefinierbare Pfütze, gegen die die Gangesbrühe reinstes Gebirgs-wasser ist. Und da patschen die Pilger barfuß in“ jetzt beinahe schon fanatischer Ekstase hinein — um ihren Göttern zu opfern. Der Magen, ohnedies locker, sitzt mir bereits beim Hals. Nein, hier gehe ich nicht hinein...
Von einem Halbdach, im Nebenhaus, auf das ich über eine Art steinerner Himmelsleiter geklettert bin, blicke ich auf das goldene Dach des Tempels. Und wohin ich schaue — ein herrlicher Rundblick — ich sehe Tempel an Tempel. Zählen hat hier keinen Sinn.
Unter mir in der schmalen Gasse sind vor dem Eingang zum goldenen Tempel Bettelweiber einander in die Haare geraten. Eine wilde Schlacht mit Stöcken ist im Gange. Und daneben schieben sich die Pilger über eine steinerne, schlüpfrige Stufe zu dem Ziel ihrer Wallfahrt...
Ich aber flüchte aus diesem „tiefsten“ Indien. Hinunter zum Ganges. Fast fühle ich mich hier nach diesem manischen Tremolo beim Goldenen Tempel wie auf einem Jahrmarkt, ehe der Tanz beginnt. Stark riechen die Goldlackkränze, die Frauen feilbieten. Rischkafahrer preisen mir vergebens ihr Gefährt an.
Ich gehe ja zum Ganges. Vorbei an Ketten von Leprabettlern, die auf den breiten Stufen Quartier bezogen haben. Mein Gehör hat sich inzwischen an normale Lautstärke gewöhnt. Ich höre, wieder das „Sa'b Bakschisch“ um mich singen. Ein weißgepuderter Fakir, fast nackt, mit einer dichten Haarmähne, stolziert durch die Menge, die ihm Raum gibt. Ein anderer Fakir, ein dunkelbraun gestrichenes Skelett, sitzt auf einem Podest. Er wird nur von ein paar Touristen beachtet, die gebückt eine Tafel mit seiner Lehre zu seinen Füßen studieren: „Conscience is God.'“ „Bewußtsein ist Gott“). Ein Yogi also, der weltentrückt, mit offenen starren Augen meditiert, um mit dem ewigen Weltbewußtsein eins zu werden ..
Aus meiner Betrachtung reißen mich Bootsleute, die mich für eine Rupie den Ganges auf und ab fahren wollen. Ich steige zu einem Kahn hinunter, mitten durch Wallfahrer, die im heiligen Ganges baden, um ihrer Sünden ledig zu werden.
Die „Sky-Line“ von Benares ist einzigartig. Wer kennt sie nicht? Ein mächtiger Tempel scheint eingestürzt zu sein. Denn sie bauen am steilen Ufer. Steine transportieren sie wie vor Jahrhunderten: Im Gleichtakt ziehen zwei Dutzend nur mit einem Schurz bekleidete Gestalten an einem langen Seil. So werden sie in einem Monat müde heraufschleppen, was ein leichter Baukran in ein paar Stunden erledigt.
Holzfeuer brennen an zwei Stellen. Hier werden Hindus verbrannt. Der Tote neben unserem Boot aber dürfte der glücklichste am heutigen Tage sein: denn er schwimmt im heiligen Wasser. Schwarze, große Vögel reißen sich Stück um Stück aus seinem weiß-gelblichen Leib ...
Ich bin erschüttert über diesen Glauben und über diese Gläubigkeit. Am Ufer stehen Frauen und Männer im seichten Wasser. Unbeweglich, mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen. Sie beten zu ihren Göttern, ehe sie in die heiligen Fluten tauchen.
Hier am Wasser: Das Versenken in die Stille, in das Bad der Reinigung. Dort beim „Goldenen Tempel“: der irrsinnige Rhythmus eines triebhaften, primitiven Götterglaubens.
Oder auch: hier der Mensch — dort die Masse...
Wohin aber strömt diese Gläubigkeit?
Es hängt nur indirekt mit Benares zusammen: Drei Monate vor meinem Indienaufenthalt war es. Nördlich von Delhi, in der Nähe von Mo-rodabad, kommt eines Tages ein „Swami“, ein indischer Weiser, in ein Dorf. (In Wirklichkeit war er ein Hoteldiener aus Benares, den sie dort hinausgeworfen hatten.) Er gibt sich als Inkarnation des Gottes Shiva aus, und die Bauern erhoffen sich von ihm Erlösung von der Not, unter der sie schwer leiden. Das ganze Dorf verehrt ihn als Gott. Er lebt auf Kosten der Bauern. Da kommen zwei Moslems ins Dorf. Die Bauern zwingen sie, den Swami-Shiva anzubeten. Als Moslems weigern sie sich. Denn es gibt für sie nur einen Gott: Allah. Sie bekommen Prügel und geben nach außen hin nach. Die Polizei, der sie ihr Erlebnis melden, schickt fünf Mann, die den Swami hopp nehmen sollen. Die kommen aber bei den Hindus im Dorf gut an: Zwei werden total zerstückelt, die anderen drei entkommen mit Mühe. Darauf folgt eine
Großaktion mit Waffeneinsatz. Endergebnis: 15 Tote auf beiden Seiten ...
An den Swami von Benares denke ich jetzt in der Stadt am heiligen Fluß weniger. Mehr an die fanatischen Hindu-Bauerni von denen etwa zehntausende ähnliche rund um mich herum zu ihren Göttern — und wären es nur rot angestrichene Steine — pilgern.
Indien ist ein tiefreligiöses Land. Das Volk hat einen Glauben, dessen Treue und Verwurzelung für viele Christen Beispiel sein könnte.
Aber nochmals: Wohin führt dieser Glaube? In der nächsten Nummer: „DIALOG IN 4000 METER HÖHE“