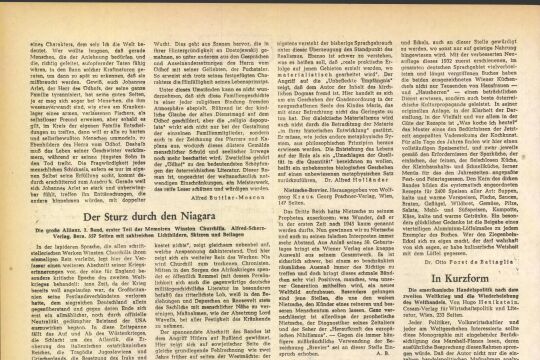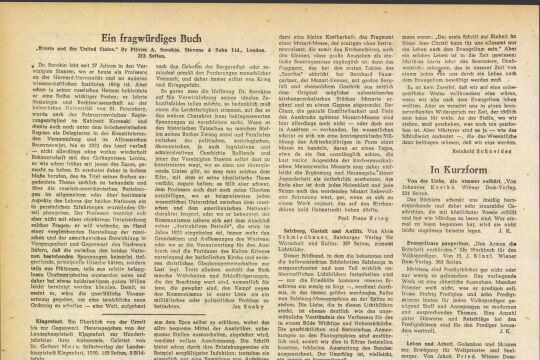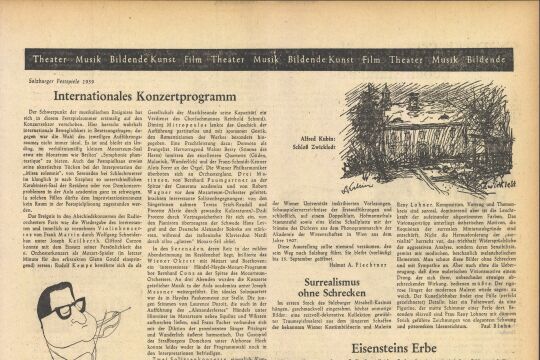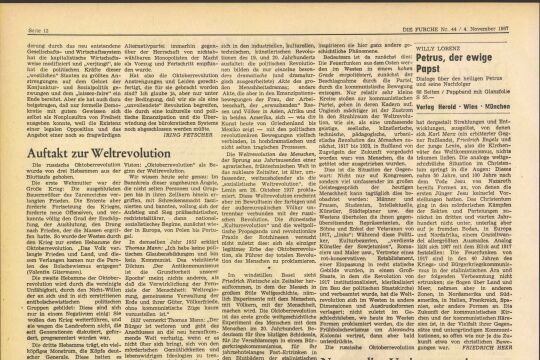Einem Chemiker, einem Bauingenieur und einem Lehrer verdankt die sowjetische Kinemaithographde im wesentlichen einheimischen Ruhm und internationale Geltung. Es sind Wsewolod IUarionowitsch Pudowkin (1893 bis 1953), Sergej Mikhailowitsch Eisenstein (1898 bis 1948) und Alexander Dowschenko (1894 bis 1956). Drei Persönlichkeiten von gegensätzlichem Charakter, auch im Werk stark unterschieden: Eisenstein — ein Ideologe, ein Agitator, von Themen beherrscht, nicht von Sujets, der Masse, nicht dem Individuum zugetan, intellektuell, tendenziös, mit dem Hang zum Monumentalen und zum Pathos. Pudowkin dagegen ein Psychologe, ein Atmosphäriker, literarisch orientiert, am einzelnen und an den zwischenmenschlichen Beziehungen interessiert, gefühlvoll, „romantisch“, nicht ohne Wärme. Der Ukrainer Dowschenko schließlich: gemütlich, behäbig, von einem erstaunlichen epischen Atem, emotial, mitunter sentimental, der Allegoriker, der Zauberer von Stimmungen — der Dichter unter diesen Regisseuren.
Doch Realisten sind alle drei und die anderen, die noch genannt werden müssen. Mit der Kraft und der Zähigkeit von Fanatikern verbeißen sie sich in die Wirklichkeit (oder das, was sie dafür halten). Kompromisse kennen sie nicht; sie sind ideologisch radikal. Der Film ist ihnen wohl eine Kunst, aber auch ein Mittel der Demonstration der bolschewistischen Doktrin. Lenin hat es so gelehrt; er erkannte die Bedeutung des Liehtspiels, der „wichtigsten unter den Künsten“, in der Wirkung auf die Masse, freilich spät erst, als Ihn und die anderen Parteiführer der Erfolg verblüffte, den „Panzerkreuzer Potemkin“, „Mutter“, „Sturm über Asien“ usw. beim Publikum, zumal dem außersowjetischen, erzielten.
Anfänglich wandte Wladimir Hjitsch Uljanow, genannt Lenin, seine Aufmerksamkeit mehr der Kinematographie als Dokumentation zu: „Bei der Schaffung eines neuen, von kommunistischen Ideen getragenen Films, der das sowjetische Leben wiedergibt, muß man mit der Chronik beginnen.“ Faktographie also, Tatsachenberichte über die sogenannte „neue Wirklichkeit“, die Kamera, die registriert, aber auch Propaganda macht — das war die ursprünglich dem russischen Lichtspiel zugedachte Aufgabe und ist es auch heute, nach fünfzig Jahren, noch.
Doch gab es zu Beginn nicht nur die „Kinoki“, die orthodoxen Dokumentarfilmer hauptsächlich um Dsiga Wertow; da begegnen auch schon „Abweichler“, „Konstruktivisten“, „Formalisten“, wie etwa die Gruppe des von D. W. Griffith beeinflußten Lew Kuleschow. Gerade dieser Kreis hat durch praktische Arbeit die Voraussetzungen für jene Entwicklung geschaffen, die den Sowjetfilm alsbald zu einer ungeahnten künstlerischen Höhe führen sollte. Was durch ihn und seine Einsichten beispielsweise in das Wesen der „Filmsprache“ mit der Montage als dem wichtigsten Gestaltungsmittel der revolutionäre Russenfilm leistete, ist von Eisensteins „Streik“ (1925) bis Pudowkins „Sturm über Asien“ (1929) als unerreichte Höhepunkte in die Geschichte des Lichtspiels eingegangen.
Der glanzvollen Stummfilmepoche folgte die Ära der „tönenden Leinwand“ und mit ihr nicht nur technisch, sondern auch stilistisch und ideologisch etwas Neues, das zunächst mit einem erheblichen künstlerischen Niedergang verwunden war: Der sogenannte „kritische Realismus“, doch mehr gekennzeichnet durch subversiv-antibürgerliche Züge als durch aufbauende Tendenzen, wurde 1932 vom „sozialistischen Realismus“ abgelöst.
Zur Zeit des kritischen, eigentlich anklägerischen Realismus _ er wandte sich vorzugsweise gegen das zaristische Feudalsystem, gegen die westlichen „Interventionisten“ usw.— wurde Überzeugendes zum Ausdruck gebracht. Jetzt, im Zeichen des „sozialistischen Realismus“, erlahmte der platt naturalistische, an den Einzelheiten der Wirklichkeit klebende Sowjetfilm, wurde er farblos, lebensunwahr. Der erst 1934 allgemein benützte Ton vollendete die künstlerische Katastrophe: Das bildfeindliche Wort dominierte in Form der Parole, der Parteiphrase. Zu dem primitiven Leitartikelstil trat eine simplifizierende Schwarz-Weiß-Zedchnung der Charaktere. Schließlich landete man bei einem verlogenen Neoklassizismus, der nicht nur die Zuschauer, sondern auch einige Künstler verstimmte — zum Beispiel Eisenstein und Pudowkin, die, wenn sie überhaupt noch drehten, „abirrten“ und deswegen gerügt wurden.
Immerhin begegnen in den dreißiger Jahren vereinzelt außergewöhnliche Werke — vielfach von jüngeren Regisseuren, die nach und nach die „alte Garde“ ablösen, so etwa Friedrich Ermler, Mikhail Romm, Grigorj Alexandrow, der Gestalter von Komödien und „Musicals“, Mark Donskoj, der Gorkis Autobiographie verfilmte, Wassilij Petrow, von dem der zweiteilige „Peter der Große“ stammt, und die beiden Wassiljew, die den für den behandelten Zeitraum wohl bedeutendsten Streifen schufen: „Tschapajew“ um einen legendären Revolutionsgeneral.
Es folgt die dritte Periode des russischen Films im „Großen Vaterländischen Krieg“ von 1941 bis 1945, der Ära des „herrlichen Sowjetpatriotismus“, der sich auch in jedem Meter Zelluloid bekundet, mag hier nun die Front oder das partisanenerfüllte Hinterland dargestellt sein. Auch die Geschichte wird bemüht {Petrow dreht beispielsweise „Kutu-sow“ über den Feldherrn, der 1812 Napoleon besiegte). Was beispielhaft ist für Tapferkeit, Treue, Pflichtbewußtsein, Opferbereitschaft usw., erscheint auf der Leinwand. In einer nationalistischen Aufwallung sondergleichen soll das Lichtspiel den Kampfgeist stärken, der Vernichtung des faschistischen Gegners dienen.
Nach dem zweiten Weltkrieg tritt der Sowjetfilm in die vierte Phase, die etwa mit dem Tod Stalins endet. Trotz der Waffenruhe schießt es in den Ateliers unentwegt weiter (im Grunde tut es das bis heute noch). Bei den politischen Sujets tritt allerdings eine Wandlung ein: War zuvor der Faschismus Gegenstand aller Angriffe, so ist es jetzt die „imperialistische Reaktion“, vor allem die der Amerikaner. Romms „Russische Frage“ über Machenschaften der US-Presse und Alexandrows „Begegnung an der Elbe“ über Praktiken der US-Besatzug sind hierfür exemplarisch.
Daneben obliegt man mit Dichterverfilmungen der „Pflege des klassischen Erbes“, gibt in der gewohnten Weise Historisches und Biographisches. Dowschenko dreht einen Film „Die Welt soll blühen“' über den sowjetischen Biologen Mitschurin, Pudowkin „Admiral Nachimow“, Eisenstein den zweiten Teil von „Iwan der Schreckliche“ (der erst 1958 anläßlich der Brüsseler Weltausstellung uraufgeführt wird). Wieder einmal mißfallen die Letztgenannten mit ihren Arbeiten und werden vom Zentralkomitee gerüffelt.
Zwar erscheint die Gegenwart in dieser Periode so aufbaufreudig und schöngefärbt wie nach dem ersten Weltkrieg; vereinzelt aber gibt sie sich nicht mehr ganz unproblematisch, grenzenlos optimistisch — gegen Ende werden, wenn auch noch mit „positiver“, das heißt, unrealistischer Lösung, beispielsweise schwierige Ehefragen behandelt (so etwa in Pyrjews „Beweis der Treue“ oder in Pudowkins letztem, übrigens in vorzüglicher Farbe gehaltenem Werk „Die Rückkehr des Wassilij Bortnikow“). Doch im allgemeinen — bei Jugendthemen, in Komödien, auf dem Gebiet der Musik — ist das Leben unbeschwert. Väterchen Stalin, um den ein kine-matographischer Personenkult sondergleichen getrieben wird, wacht ja ausweislich der einschlägigen Leinwandgebilde als „großer Führer“, „weiser Lehrer“, „unvergleichlicher Menschenfreund“ über alle und alles, insbesondere über die Filmkunst, die daher völlig steril wird und einen noch nie gekannten Tiefpunkt erreicht.
Mit Chruschtschow beginnt der fünfte Abschnitt des Sowjetfilms. Das berühmte „Tauwetter“ bringt nach dem entscheidenden XX. Parteitag der KPdSU mit der folgenden Entstalinisierung eine Lockerung der verhängnisvollen Reglementierung durch Staat und Partei. In den Studios weht ein frischer Wind. Die zur völligen Bedeutungslosigkeit abgesunkene Kinematographie gewinnt künstlerisch wieder Terrain. Das ist das Verdienst alter wie junger Regisseure.Aus der Fülle bemerkenswerter Potenzen seien genannt: von der nun „alten Garde“ Mikhail Kalatosow („Treue Freunde“ 1954, „Wenn die Kraniche ziehen“ 1957, „Ein Brief, der nicht ankam“ 1960), Mikhail Romm („Neun Tage eines Jahres“ 1962), Grigorj Kosinzew („Hamlet“ 1964), Iwan Pyrjew („Das Licht von einem fernen Stern“ 1965); unter dem „Nachwuchs“ Grigorj Tschuchrai („Der Einundvierzigste“ 1956, „Ballade vom Soldaten“ 1960, „Klarer Himmel“ 1961), Andrej Tarkow-skij („Iwans Kindheit“ 1962), Reso Tschechejidse („Der Vater des Soldaten“ 1965) sowie Sergej Bondartschuk, der 1959 so hoffnungsvoll mit „Ein Menschenschicksal“ begann, dann aber 1963 bis 1966 mit der geschmäcklerisch-pompösen Tolstoi-Verfilmung „Krieg und Frieden“ ziemlich enttäuschte.
Die von diesen und anderen Spielleitern behandelten Gegenstände umfassen alltägliches Geschehen (etwa aus der Mietskaserne, der Kolchose, dem wissenschaftlichen Milieu) oder historische Ereignisse (vielfach aus der jüngeren Vergangenheit, dem jetzt doch mehr als ein allgemeines Verhängnis angesehenen Krieg). Viele Erscheinungen — nicht nur solche der stalinistischen Ära, sondern auch der Gegenwart — werden in zum Teil satirischer Form der Kritik unterzogen; vor allem mit der Omnipotenz des Staates, der Parteibürokratie, der Funktionärsclique setzt man sich auseinander. Das Leben, wie es nun dargestellt wird, ist widersprüchlich, schwierig, problematisch. Seihst in dem nicht mehr ausgesparten privaten Bereich, der übrigens zunehmend bürgerliche Züge aufweist, gibt es Versager, ja Kriminelle. Die größte Errungenschaft des Sowjetfilms unserer Tage aber ist die Entdeckung des Menschen, der kaum mehr als Massenprodukt, als ökonomischer Faktor, sondern vorzugsweise als vom Kollektiv abgesondertes Einzelwesen erscheint, der in individueller Autonomie aus der politisch-gesellschaftlichen Anonymität tritt. Und mit ihm wurde auch wieder die Liebe als zwischenmenschliche Beziehung (wie im „Einundvierzigsten“ sogar unter ideologischen Gegnern) entdeckt, wenngleich im Überschwang alsbald romantisiert, verklärt.
Formal ist der Stand vergleichsweise der „klassischen“ Zeit noch nicht erreicht. Zwar photographiert man „abstrakt“ (Romm nähert sich in „Neun Tage eines Jahres“ Antonioni an), neigt man optisch dem Expressionismus oder Impressionismus zu, „malt“ man zum Beispiel hell-dunkel, differenziert, psychologisiert man, macht man lange „Fahrschüsse“, schneidet man Wirbelmontagen — aber meist sind das Rückgriffe auf frühere Leistungen, eigene wie fremde, solche etwa des italienischen Verismus. Immerhin: Man überprüft auch den offiziell immer noch geltenden „sozialistischen Realismus“1. Und das ist gut. Denn in der Filmkunst mündet schließlich doch alles und jene Meister, die im Stil des „menschlichen Realismus“ Überragendes geschaffen haben.