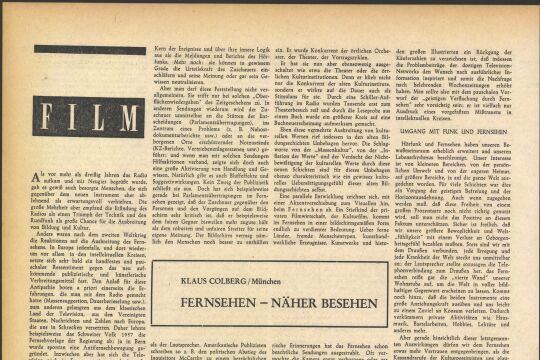Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
ABER PATRIOTEN MÜNCHEN MÜNCHEN AUF DISTANZ
Österreicher — in Hamburg und Berlin, London und Paris. Und anderswo. Österreicher in München. Es ist ein Kuriosum vielleicht. Wahrscheinlich aber ist es mehr! Kaum ein Land besitzt so viele Begabungen. Und kaum eines weiß so wenig mit ihnen anzufangen.
Was machen sie, die jungen Künstler und Akademiker, wenn sie ihr
Studium in Wien, Innsbruck, Graz oder Salzburg beendet haben? Sie gehen ins Ausland. Natürlich gibt es auch solche, die bleiben. Es sind oft jene, die sich dem Austriazismus verschrieben haben — dieser ebenso liebenswürdigen wie grantigen, grüblerischen, verschrobenen, originellen, wollüstig lamentierenden, friedlich betrachtenden und ansonsten wurschtigen Geisteshaltung.
Die Argumente einer derartigen Abwanderung, eines solchen „Eigenexports“: größere berufliche Chancen jenseits der Grenzen, ein höheres Gehalt, weniger Protektion — und ein frischerer Wind. Manche gehen auch gezwungenermaßen. Ein vielzitiertes Beispiel heißt Karajan.
Die meisten zieht es nach Deutschland. Und hier wirkt nun wiederum München, die Stadt mit Herz und Geist, beherrscht von den Musen, Vereinigung beider Komponenten, als besonderere Anziehungspunkt.
Sie sind unschwer zu finden, die Österreicher, die sich hier einen Namen gemacht haben.
Hans Stadlmair beispielsweise, geboren in Neuhofen an der Krems und Dirigent des Münchner Kammerorchesters.
Warum er Wahlmünchner geworden ist?
„In Österreich hätte ich es nie in so kurzer Zeit so weit gebracht. Jetzt allerdings stehen mir auch das Konzerthaus und der Musikvereinssaal offen. Weil ich bereits Tourneen nach Afrika, Amerika und in die übrige Welt unternommen habe. Als ich die Stuttgarter Symphoniker mit der Dritten Symphonie von Bruckner dirigierte, war ich 23 Jahre alt. In Wien hätte man mir in diesem Alter niemals eine derartige Verantwortung übertragen. Das Risiko wäre zu groß gewesen.“
Wir stehen beim Münchner Hauptbahnhof, und Herr Stadlmair hat
wenig Zeit. Er hat meistens wenig Zeit. Proben, Aufführungen und Tourneen nehmen ihn völlig in Anspruch. Aber er ist das bereits gewöhnt. Und natürlich ist es schon wieder spät. Die Bahnhofsuhr zeigt genau zwei Uhr — und um halb drei Uhr beginnen die Proben. Gestern war das letzte Konzert in Bozen Schließlich sitzen wir dann im
Restaurant und zwischen Gulyäs und Bockbier entsteht so etwas wie ein Interview.
„Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?“ Daß diese, korrekterweise jedes Interview beendende Frage vor lauter Eile an den Anfang gerutscht ist, scheint Herrn Stadlmair nicht weiter zu verblüffend.
„Mitte September ist eine vierzehntägige Deutschlandtournee geplant, wobei jedes Programm ein Werk von mir beinhaltet. Im Oktober und November geht es dann nach Frankreich, Spanien und auf dem Rückweg soll Belgien und Norddeutschland miteinbezogen werden. Für das Jahr 1969 war eine Ost- europatoumee angesetzt, die jedoch jetzt der jüngsten Ereignissen wegen wahrscheinlich gekürzt wird. Einzig Rumänien, Jugoslawien und — wenn möglich — die CSSR stehen noch auf dem Programm. Die übrigen Staaten möchte ich aus begreiflichen Gründen meiden. Im Jahre 1970 soll eine Tournee mit etwa 32 Konzerten in die USA stattfinden.“
„Eine Frage, Herr Stadlmair — wann proben Sie eigentlich?“
„Das geht so zwischendurch. Ebenso die Schallplattenaufnahmen und die Konzerte in München. Augenblicklich stehe ich in Verhandlungen mit Samy Molcho. Wir wollen zusammen im Jänner eine Sendung im Dritten Deutschen Fernsehen bringen. Ich dirigiere die vier Temperamente von Hindemith und Molcho mimt.“
„Worauf wird dabei der Hauptakzent gelegt. Ich meine — tritt bei derartigen Veranstaltungen nicht die Musik in den Hintergrund?"
„Das möchte ich nicht sagen. Es geht um die Verwirklichung eines harmonischen Zusammenspiels.“
Noch ein paar Bemerkungen über Für und Wider von Konzertsendun
gen im Fernsehen (das Akustische weicht dem Optischen) — dann tasten wir uns langsam zum eigentlichen Anfang zurück.
Hans Stadlmair, 39 Jahre alt, studierte an der Wiener Musikakademie und ging anschließend für fünf Jahre als Assistent von Johann Nepomuk David nach Stuttgart. Dort baute er nicht nur an seiner beruflichen Karriere, sondern wußte es sich auch auf privatem Sektor einzurichten. Als er im Jahre 1956 nach München zog, brachte er neben entsprechenden Empfehlungen noch seine Frau aus Stuttgart mit.
Nein, irgendwelche Schwierigkeiten beim Eingewöhnen hat er nicht gehabt. Und war man erst überzeugt — ließ man auch gewähren. Natürlich half ihm dabei der Ruf, den Wien als Musikstadt in Deutschland nach wie vor genießt.
„Was halten Sie von Wien als Musikstadt?"
„Wien zehrt von seiner Tradition. Das soll seinen Verdienst nicht schmälern. Die Wiener Philharmoniker sind immer noch die Wiener Philharmoniker. Aber sie sind keinesfalls besser als etwa die New Yorker Philharmoniker. Im Gegenteil — so gesehen fallen sie einfach ab. Und derartige Tatsachen will man in Wien nicht wahrhaben. Man hebt die schönen Künste ins Unnahbar-Sakrale. Auch dadurch haben junge Leute dort wenig Chancen — geduldet wird in Wien das reife Alter. Es ist — wie schon gesagt: wegen des Risikos.“
Damit verlassen wir das Restaurant. Den Koffer hat Herr Stadlmair in der Aufbewahrung vergessen.
Michael Kehlmann, gehätschelter Star-Regisseur des Münchner Fernsehens, empfängt etwas gemütlicher. Sein Häuschen liegt umgrünt mit kleinem Garten an Münchens Peripherie und fast an der
isar. Zum kleinen Star brachte es der geborene Wiener bereits in seiner Vaterstadt. Man erinnert sich dort noch an seine Inszenierungen im Kleinen Theater im Konzerthaus. Auch an seine Zusammenarbeit mit Qualtinger und Bronner. Die übrigens weitergeht, wie einer seiner letzten Spielfilme, „Der kurze Prozeß“, beweist, in dem Qualtinger die Hauptrolle übernommen hatte.
Zum großen TV-As wurde Kehlmann. jedoch erst in München. Ein Regisseur der feinen Nuancen, der ausgewogenen Dialoge und vor allem der treffenden Charakterschilderung. Er war einer der ersten, der den besonderen Anforderungen, welche das Medium Fernsehen an den Regisseur stellt, gerecht wurde und dem damals noch ziemlich unsicheren Herumexperimentieren durch handfeste Ergebnisse aus einer Sackgasse half.
„Herr Kehlmann, worin sehen Sie den Unterschied zwischen Film und Fernsehen?“
„Der Film zeigt die Dinge, das Fernsehen Chiffren. Der Film ist naturalistischer, das Fernsehen symbolhafter.“
„Und was fasziniert Sie vor allem am Fernsehen?“
„Daß es Millionen von Menschen erfaßt.“
„Glauben Sie nicht, daß gerade durch diese Tatsache das Niveau leidet?"
„Nein, das muß absolut nicht der Fall sein. Es ist Aufgabe des Regisseurs, die Massen zu erziehen — nicht, sich auf sie einzustellen.“
Er hält übrigens das deutsche Fernsehen nach wie vor für das beste der Welt. Obwohl sein Niveau durch die Einführung des Zweiten und Dritten Programms gesunken sei. Als es nur ein Programm gab, mußten sich die Leute ansehen, was sie vorgesetzt bekamen. Man konnte also das Niveau steuern, ohne eine
Konkurrenz zu befürchten. Allerdings gibt er dem Filmregisseur vor dem Fernsehregisseur die größeren Möglichkeiten. Läßt jedoch die Filmschauspieler hinter den Fernsehschauspielern rangieren. Vom Fernsehschauspieler werde — auch bedingt durch die Großaufnahmen — mehr verlangt. Weshalb fast alle Fernsehschauspieler vom Theater kämen.
„An .photogen glaube ich nicht. Das Talent allein ist entscheidend.“
Michael Kehlmann ist 40 Jahre alt. Man sieht es ihm — nebenbei — nicht an. In Wien hatte er Germanistik studiert, und eben die Dissertation begonnen, da hielt es ihn plötzlich nicht mehr im Heimatstaat (Kommentar: „Das Wiener Publikum ertrotzt sich erst jetzt den Einzug in das 19. Jahrhundert.“). Und als ihm bei einem Gastspiel vom „Brettl vor dem Kopf“ eine Stelle beim Hamburger Fernsehen angeboten wurde, ließ er Dissertation und Studium sausen und griff zu. 1956 bis 1959 war er Oberspielleiter bei Frankfurts Bildschirmversorgern. Und dann wurde er freier Mitarbeiter in München. Warum? München sei Ballungssphäre der v:rs 'üedensten künstlerischen Strömungen — und vor allem ein Zentrum für Film und Fernsehen.
Was Wien anbelangt, so findet er es zu konservativ. Man brächte dort zu wenig moderne Stücke. Und betrachte das Theater als reine Unterhaltung — es fehle lebendige Auseinandersetzung.
„Ich bin für politisches Theater. Darunter verstehe ich Theater, das über private Affären hinausgeht.“
Außerdem gäbe es in Österreich zu wenig geeignete Plätze für gute Leute. Darum gingen auch viele junge Talente weg.
Kategorische Feststellungen — von groß angelegter Gestik begleitet. Herr Kehlmann liebt kategorische Feststellungen. Er bringt sie mit einem gewissen liebenswürdigen Draufgängertum. Auch wenn er weiter von seiner Arbeit berichtet:
„Der Kameramann hat in meinen Filmen keine eigene Funktion. Er ist reiner Handlanger. Ich sehe die Bilder — und ich schlage sie vor. Er führt sie aus. Ich bin auch gegen diese in jüngster Zeit angestrebte
Zusammenarbeit zwischen Regisseur, Autor und Schauspieler. Das Theater ist kein demokratisches Forum. Durch derartige Diskussionen wird nur Zeit vertrödelt. Es muß eine Autorität geben, nach der sich alle übrigen Beteiligten richten.
Kehlmann läßt wenig Gutes an Österreich im allgemeinen und an Wien im besonderen. Und ist vielleicht gerade darin Österreicher durch und durch. Eine antik eingerichtete Wohnung hat er mit Alt- Wiener Stichen bebildert. Seine Frau ist Wienerin und spielt in vielen seiner Filme die Hauptrolle. Und er hat etlichen Österreichern in Deutschland über die ersten beruflichen Hürden geholfen. Auch wurden durch seine Filme österreichische Autoren in der Bundesrepublik un- gemein populär. Das begann mit einer „Horvath-Renaissance“ (Kehlmann) und führte über eine Nestroy- Welle („Ich habe Nestroy in Deutschland salonfähig gemacht!“) bis zu dem ganz großen Erfolg von „Radetzkymarsch“ („Das Buch von Josef Roth wurde dadurch ein Bestseller!“)
Und noch eine Eigenschaft stempelt Herrn Kehlmann zum Österreicher. Er ist nämlich — Ironie des Schicksals — konservativ.
„Herr Kehlmann, was halten Sie vom jungen deutschen Film?“
„Nichts! Die junge Generation hat nichts zu sagen. Sie verwechselt einfach Inhalt und Form. Das heißt also: die Form erhält gegenüber dem Inhalt ein Übergewicht. Dadurch muß es zu einem reinen Formalismus kommen. Außerdem sind teilweise recht reizvolle Effekte oft aus reinem Dilletantismus entstanden. Grobes Korn kann eine gewisse Wirkung haben — auch wenn es im Grunde gar nicht beabsichtigt ist.“
Eine abschließende Frage: „Warum arbeiten Sie eigentlich nicht für das österreichische Fernsehen?“
Darauf kurzes Nachdenken: „Ja, warum eigentlich nicht?“ Gefolgt von einem lakonischen „Man hat mich nicht gerufen“. Dann ein zögerndes „Es gab da Differenzen“. Und schließlich ein beschwichtigendes „Aber wir stehen in Verhandlungen“.
Zwei Österreicher in München! Sie stehen für viele. Patrioten — aber auf Distanz.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!