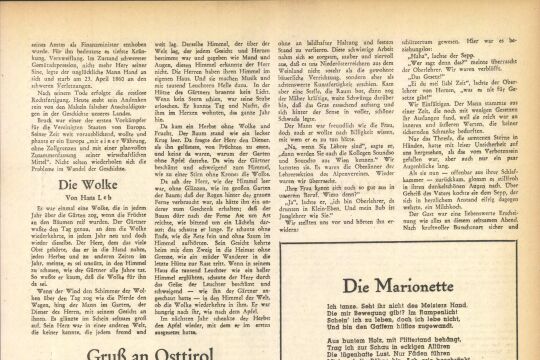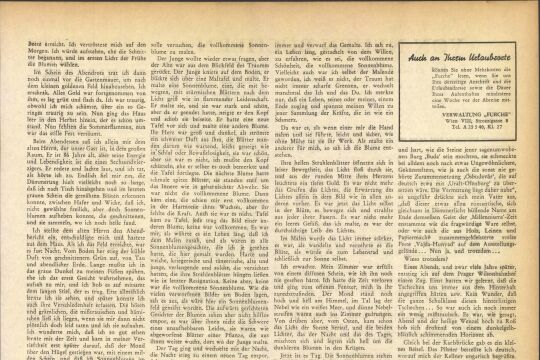Abschiedsbrief an einen böhmischen Schuhmachermeister
Sehr geehrter Herr Antonin!
Sie müssen entschuldigen, daß ich diesen Weg wähle, um Ihnen einen Brief zu schreiben. Niemand kennt Ihre Adresse und weiß, wo Sie zu finden sind. Der Meister, der nach Ihnen Ihre Sclu.hmacherwerkstätte bezog, hat nach einem halben Jahr seine neue Wirkungsstätte, an der Sie durch Jahrzehnte tätig waren, wieder verlassen. Dann stand Ihr Geschäft lange leer, und die Scheiben der Auslagen blickten wie blinde Augen auf das gegenüberliegende Lobko- witzpalais. Erst vor kurzem wurde Ihr Geschäftslokal neuerlich „besiedelt”. Aber von der neuen Firma weiß natürlich erst recht niemand die Anschrift Ihrer Wohnung, in der Sie Ihren Lebensabend verbringen. So ließ die Unmöglichkeit, Ihre Adresse zu finden, in mir den Entschluß reifen, Ihnen endlich auf diesem Weg zu schreiben.
Vielleicht werden Sie, sehr geehrter Herr Antonin, verwundert fragen, warum ich Ihnen denn überhaupt einen Brief schreibe, noch dazu in aller Oeffentlichkeit? Ja, dies hat so seine verschiedenen Hintergründe. Erstens ist es nur selbstverständlich, daß Ihnen öffentlich der Dank ausgesprochen wird für alle die schönen Schuhe, die Sie durch Jahrzehnte Ihren Kunden nach Maß verfertigten, schöne, schlichte, sehr einfache Schuhe, die eben deshalb sehr elegant aussahen, . ber ungeeignet waren,. von Snobs und sotiktigeh’ Plötzen getragen zu werden. Es ist selbstverständlich, daß Ihnen öffentlich der Dank ausgesprochen wird für alle Anhänglichkeit, die Sie Ihren Kunden bewahrten. Es war recht schwer, Ihre Gunst zu erringen, es war noch schwerer und bedurfte einer guten Empfehlung, um in den Kreis Ihrer Kunden aufgenommen zu werden. Aber wer einmal Ihr Kunde war, der blieb Ihnen treu und bestellte sich von weiß Gott wo seine Schuhe bei Ihnen. Ohne natürlich noch Maß nehmen zu müssen. Denn wer Ihre Schuhe trug, dem drückte schon bei Lebzeiten kein Schuh mehr.
Aber noch aus einem zweiten Grunde schreibe ich Ihnen diesen Brief. Denn je länger Sie nicht mehr in Ihrem Geschäft anzutreffen sind, desto mehr komme ich darauf, daß nicht nur ein Stück Wien mit Ihnen verschwunden ist, sondern daß sich das Antlitz Wiens grundlegend dadurch geändert hat. Sie werden jetzt recht verwundert sein, sehr geehrter Herr Antonin, und lächelnd meine Behauptung als eine Marotte abwehren. Aber ich werde Ihnen gleich beweisen, daß ich ‘ recht habe.
Sehen Sie, sehr geehrter Herr Antonin, viele Menschen, besonders Ausländer, wollen es nicht glauben, daß sich Wien geändert hat. Für sie ist Wien immer noch eine heimliche Kaiserstadt, in deren Prater jeden Frühling wieder die Bäume blühen, deren Burgtlieater so gut ist wie in alten Zeiten, deren Oper, deren Museen dem Auge und dem Gehör Genüsse bieten, die sonst keine Stadt bieten kann. Das ist alles richtig. Aeußer- lich hat sich Wien vielleicht wirklich nicht viel geändert, aber innerlich, da hat es sich gegenüber den letzten zwanzig, gar gegenüber den letzten fünfzig Jahren völlig verwandelt. Und dies „nur”, weil Sie, sehr verehrter Herr Antonin, nicht mehr tätig sind, weil Sie sich vom aktiven Leben zurückgezogen haben. Aber nicht nur Sie, sondern Tausende von anderen „Anto- nins”. Und dies hat einen völligen Strukturwandel der alten Kaiserstadt nach sich gezogen. Die Plattform, auf der das jetzige „Große Wiener Welttheater” abrollen kann, ist eine ganz andere geworden, als sie es einstmals war.
Denn verschwunden sind aus Wien die böhmischen Schuhmachermeister, die böhmischen Schneider, die so fleißig und unermüdlich vom frühesten Morgen bis in die späteste Nacht herr liehe Schuhe, herrliche Anzüge hervorzauberter und mit ihnen die Blößen der Menschen derart bedeckten, daß aus Menschen „Leute” wurden - Verschwunden sind aus Wien auch die böh mischen Köchinnen, die jahrzehntelang bei ihren Herrschaften dienten, mit ihnen weinten, mit ihnen lachten, sie tyrannisierten und durch ihre Kochkünste (es waren noch wirkliche Koch- k ü n s t e) unweigerlich dazu beitrugen, daß alle Familienmitglieder über kürz oder lang ihre „Figur” verloren und Abonnenten für Karlsbad wurden. (Unvergeßlich dieser Tafelspitz mit Apfelkren, unvergeßlich diese Germknödel, unvergeßlich überhaupt diese Mehlspeisen.) Das heutige Wien hat nur noch wenig übrig für das Kochen als Kunst. Es ist nur zu verständlich Denn Frauen, die ins Büro hasten und abends todmüde nach Hause kommen, können für ihren Mann, ihre Kinder höchstens noch Nahrungsmittel herbeischaffen, aber keine edlen Genüsse des Gaumens mehr. Und die Männer, denen man diese Genüsse immer mehr vorenthält, verlieren natürlich die Freude am Essen.
Verschwunden sind aus Wien aber auch die böhmischen Diener in den Aemtern, meist ehemalige längerdienende Unteroffiziere, die sich immer als „Amt” ausgaben. („Was wünscht der Herr?” — „Ich möchte zum Herrn Minister.” - „Bedaure, aber w i r haben heute keine Sprechstunde.”) Verschwunden sind aus den Büros, den Geschäften diese listigen, mit Humor begabten Diener, die stets zu Gefälligkeiten bereit waren ‘‘‘erschwunden sind die böhmischen Hausmeister.
Verschwunden sind aus Wien überhaupt die
„Böhm” Wien ohne Tschechen wäre noch vor fünfzig Jahren undenkbar gewesen. Heute kann man in Wien kaum noch Böhmisch reden. (Nur der Friseur Jaro Pikhart in der Habsburgergasse spricht es noch — Gott erhalte ihn uns noch lange.) Im zehnten Wiener Gemeindebezirk, in dem man einst kaum ein deutsches Wort hörte, ist jeder böhmische Laut verschwunden. Die Vorschrift, daß die Wiener Polizisten Böhmisch — soweit es zum Dienstgebrauch notwendig sei - beherrschen müssen, ist längst nicht mehr gültig.
Das war ja auch so schön bei Ihnen, sehr geehrter Herr Antonin, daß man bei Ihnen noch - wie im alten Wien - Böhmisch reden konnte. Freilich, die Bestellungen gab man Deutsch auf, aber dann plauderte man Böhmisch, eine gute halbe Stunde. Kam ein anderer Kunde, der nicht Böhmisch konnte, so sprachen Sie natürlich nur Deutsch mit ihm. Es war wie in der alten Armee. Die Kommandosprache, die Verständigungssprache war Deutsch, die Regimentssprache war Böhmisch. Und wie schön konnten Sie in Ihrem Böhmisch von den alten Zeiten erzählen, von
Ihren Kunden, lustige und traurige Sachen. Wie lustig war zum Beispiel die Geschichte von dem Herrn (er war natürlich kein „Herr”), der Sie nach dem „Anšlus” besuchte und ein paar Stiefel zum — Doppeln brachte. Stiefel und doppeln. So etwas war Ihnen noch nicht vorgekommen. Und unter verhaltenem Lachen haben Sie dem Herrn (er war wirklich kein „Herr”) hinauskomplimentiert, indem Sie ihm erklärten, daß man in Ihren Stiefeln nur reiten, aber nicht marschieren könne. Aber erst wie dieser „Herr” wieder aus Ihrem Laden verschwunden war, war Ihnen zum Bewußtsein gekommen, was jetzt für Leute in Oesterreich regierten.
(Eine ähnliche Geschichte passierte auch Herrn Marko in der Habsburgergasse, seines Zeichens k. u. k. Kammerfriseur, ein Serbe aus der Militärgrenze, der natürlich ein „plemenit”, ein „Edler von” war, und mit Verachtung von den Serben im Königreich sprach. Diesem guten Marko passierte es — ebenfalls nach dem März 1938, daß zu ihm in das Geschäft ein Herr aus dem Norden trat, mit einer Frisur behaftet, die man in Berlin als „hinten praktisch, vorne ele- jant” bezeichnet und deren Wesensmerkmal darin besteht, daß nur auf der Spitze des Hauptes einige Haare stehen bleiben, ansonst alle rundherum wegrasiert werden. Dieser Herr also aus dem Norden, mit dieser Frisur wollte sich die Haare schneiden lassen. Herr Marko sah ihn an und sagte dann mißbilligend: rBitte, belieben sich zuerst Haare wachsen zu lassen und dann in sechs Wochen wiederzukommen.”)
Oder wie lustig war die Geschichte von jenem Lehrbuben, der Ihnen sagte, daß ein Kunde „gelbe Schuhe” bestellt habe. Der arme Lehrbub! Er wollte absolut nicht begreifen, als Sie ihn fragten, welches „Gelb” denn der Herr bestellt habe. Der Lehrbub hatte nicht mehr in der alten Armee gedibnt und wußte nichts mehr von der Vielfalt der Farben. Für ihn war Gelb eben Gelb. Er hatte nie gelernt, welches Regiment schwefelgelbe und welches kaisergelbe Aufschläge trug. Gott sei Dank hatte der Lehrbub endlich gesagt, welcher Herr diese Schuhe bestellt hatte, und dann wußten Sie endlich, daß sich derselbe wie immer tabakfarbene Schuhe gewünscht hatte.
Denn Sie kannten diesen Herrn natürlich, denn er war nicht nur jahrelang Ihr Kunde ge- wesenr sondern hatte auch nochtnit Ihnen beim glfefcheö ‘Dfägönerr’ägifnfeHt gedfėht. Ačh ‘ja, dieser Dienst bei der alten Armee! Was konnten Sie da für nette Geschichten erzählen aus den drei Friedensdienst und vier Kriegsjahren. Schließlich waren Sie Feldwebel gewesen, k. u. k. Feldwebel bei den Dragonern. Es war ein sogenanntes „gutes” Dragonerregiment gewesen, und Sie waren immer besonders stolz, bei diesem „guten” Regiment gedient zu haben. Wenn Sie von jemand etwas ganz Geringschätziges sagen wollten, dann sagten Sie nur: „Bitte schön, der war ja auch Rittmeister im Dragonerregiment Nummer so und so, was doch bekanntlich war ain schlächtes Dragonerregiment.” Ach, wer weiß schon heute noch, welche Dragonerregimenter der alten Monarchie zu den „guten” oder zu den „nicht guten” zählten. Wobei diese Einreihung gar nichts mit einer militärischen Wer- ‘ tung zu tun hatte. Aber dies der heutigen Generation zu erklären,-ist ja hoffnungslos. Wer es weiß, der weiß es, und wer es nicht weiß, wird diesen Unterschied nie begreifen.
Vorbei, alles vorbei.
Aber nicht nur die „Böhm” sind ja aus Wien verschwunden, sondern auch die „Randlböhm”, die Sudetendeutschen. Wer heute noch sich als Sudetendeutscher in Wien deklariert, ist entweder ein Flüchtling, den die schrecklichen Ereignisse im Jahre 1945 nach Oesterreich verschlugen, oder er lebt schon in zweiter oder gar dritter Generation in Wien. Die echten Sudetendeutschen oder, wie sie damals hießen, die „Deutschböhm”, die vor 1914 nach Wien wan- derten, sind auch verschwunden. Und damit verschwanden aus Wien die fleißigsten und intelligentesten Arbeiter, Handwerker und Beamte, die die Monarchie gekannt hatte. Ihre Liebe zur Arbeit glich oft schon einer Besessenheit. Diese Besessenheit kennen im heutigen Oesterreich nur noch die Vorarlberger, kaum die übrigen Oesterreicher. Aber Vorarlberger wandern nicht nach Wien aus, sondern bleiben im „Ländle” oder gehen in die Schweiz. Und so besitzt Wien heute kaum noch Menschen, die Roboter sind. Roboter mit einer hohen Intelligenz, die oft ins Spintisieren reichte, ins Spekulative. Die Tiroler, die Steirer, die eine ähnliche Spekulationsgabe b-sitzen, wandern aber auch nicht nach Wien. Eher wandern schon die Wiener nach Tirol, nach Steiermark. In Graz kann es einem pas-sieren, daß man unter zehn Leuten neun geborene Wiener antrifft. Nein, Wien besitzt keine Roboter mehr.
Aber nicht nur diese sind verschwunden, auch die slowenischen und kroatischen Dienstmädchen. Verschwunden sind vor allem, auch die Juden. Das ist vielleicht einer der ärgsten Schläge, die Wien erhalten hat. Verschwunden sind die braven jüdischen Hausärzte, die meist auch gute Seelenfreunde und Helfer der von ihnen betreuten Familien waren, verschwunden die feinen jüdischen Gelehrten, verschwunden die jüdischen Journalisten. Und das ist eine besondere Katastrophe für die österreichische Presse. Denn diese jüdischen Journalisten, die ein Deutsch schrieben, mit dem Goethe zufrieden gewesen wäre, während - das heutige Zeitungsdeutsch doch oft so verballhornt ist, daß es sich wie der Slang zum Oxfordenglisch verhält, diese jüdischen Journalisten also, die ihren Beruf nicht nur als ein Sprungbrett auffaßten oder als einen Beruf, den man vorübergehend ausüben könne, weil man derzeit „nichts Besseres” gefunden hatte, diese Juden, die somit den echten Eros des Berufes hatten, hatten auch — Esprit. Und die Zeitungen, in denen sie schrieben, besaßen deshalb nicht nur hohes Niveau, sondern waren auch nie langweilig. Während jetzt… aber lassen wir das…
Die Tschechen sind aus Wien verschwunden, die Sudetendeutschen, die Kroaten, die Slowenen, die Juden. Die Vorarlberger kommen nicht nach Wien, nicht die Tiroler, nicht die Steirer. Wien ergänzt sich aus dem Burgenland, aus dem nahen Niederösterreich. An die Stelle von Reichenberg, von Komotau, von Bodenbach, von Brünn, Pisek und Znaim ist St. Pölten getreten. Aus Sankt Pölten zu stammen, bedeutet heute so etwas wie eine sichere Anwartschaft auf eine Karriere in Wien.
Vor einiger Zeit sagte der Abt eines Benediktinerklosters zu mir: „Vor dreißig Jahren bestand unser Konvent aus 25 Patres und 50 Laienbrüdern. Heute besteht er aus 20 Patres und 5 Laienbrüdern. Bald wird es überhaupt keine Laienbrüder mehr geben. Wir werden dann natürlich immer noch ein Benediktinerkloster sein, aber die soziologische Struktur unseres Klosters wird sich völlig gewandelt haben.” Aehnliches geschieht jetzt mit Wien. Es entsteht ein neues Wien. Ein Wien, das kein Völkergemisch mehr darstellt. Dessen Leben auf einer neuen Plattform sich äbspielt. Ob dieses neue Wien schön sein wird? Möglich. Das alte war es bestimmt. Es hatte etwas unendlich ,Bestrickendes, etwas Bezauberndes.’ Es besaß ein Fliildüm, das nicht wiederzügeben ist. Ohne diese Arbeit der „Laienbrüder” von Wien, dieser böhmischen Schuhmachermeister, dieser sudetendeutschen Roboter, dieser jüdischen Journalisten, dieser kroatischen Dienstmädchen hätte dieses bezaubernde Wien nicht entstehen können. Dieses bezaubernde Wien, dessen Scharm die Welt berückte. Alles vorbei. Ein neues Wien ist im Kommen.
Knapp bevor Sie, sehr geehrter Herr Antonin, Ihr Geschäft aufgaben, ging ich einmal an Ihrem Laden vorbei. Ich sah Sie in der kleinen Kammer sitzen, die sich oberhalb Ihres Geschäftes befand und deren Fenster ebenfalls auf den Lobkowitzplatz gingen. Sie saßen vor Ihrem Arbeitstisch. Aber Ihre Hände, die jahrzehntelang gearbeitet hatten, ruhten. Ihre Augen sahen starr nach vorn. Ich erinnere mich, diesen gleichen Ausdruck kurz nach dem ersten Weltkrieg in den Augen hoher tschechischer Staatsbeamter gesehen zu haben, die noch aus dem Dienst der alten Monarchie gekommen waren.
Deren traurige Augen sagten nur immer stumm: „Unser Reich ist zu Ende. Wofür wir gearbeitet haben, ist nicht mehr.” Das gleiche sagten damals eigentlich auch Ihre Augen, sehr geehrter Herr Antonin. Diese Augen sagten: „Das Wien, das wir alle geliebt und mitgeschaffen, ist nicht mehr.” Es war schrecklich, diese Ihre Augen zu sehen. Deiiri sie wußten wirklich mehr, als so manche gelehrte Abhandlung.
Ja, es kommt ein neues Wien. Die neue Generation kennt das alte Wien nicht mehr, das Sie, Herr Antonin, und alle die Tausende von „Antonius” geschaffen haben. So soll wenigstens dieser Brief ein bescheidenes Zeugnis von Ihrer aller anonymen Arbeit geben und einen tiefen Dank aussprechen für diese selbstlose Mühe. Wien wäre in den letzten 80 Jahren nicht das gewesen, was es war, wenn nicht Ihre stumme und doch selbstverständliche Pflichterfüllung gewesen wäre.
Mejte se velice dobfe, velevžženy pane Antonine. Pfeji Väm mnoho, mnoho štšsti a zdravf. Mnoho dikü ješte jednou za všechno. Büh s Vätni.
Väs upfimny