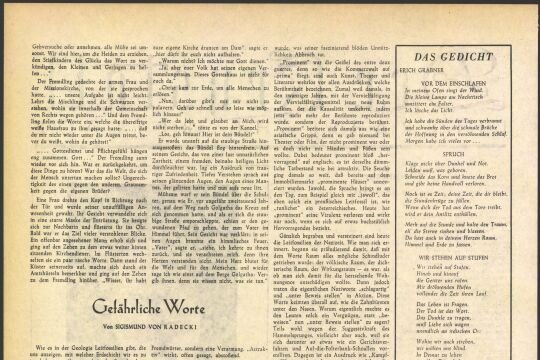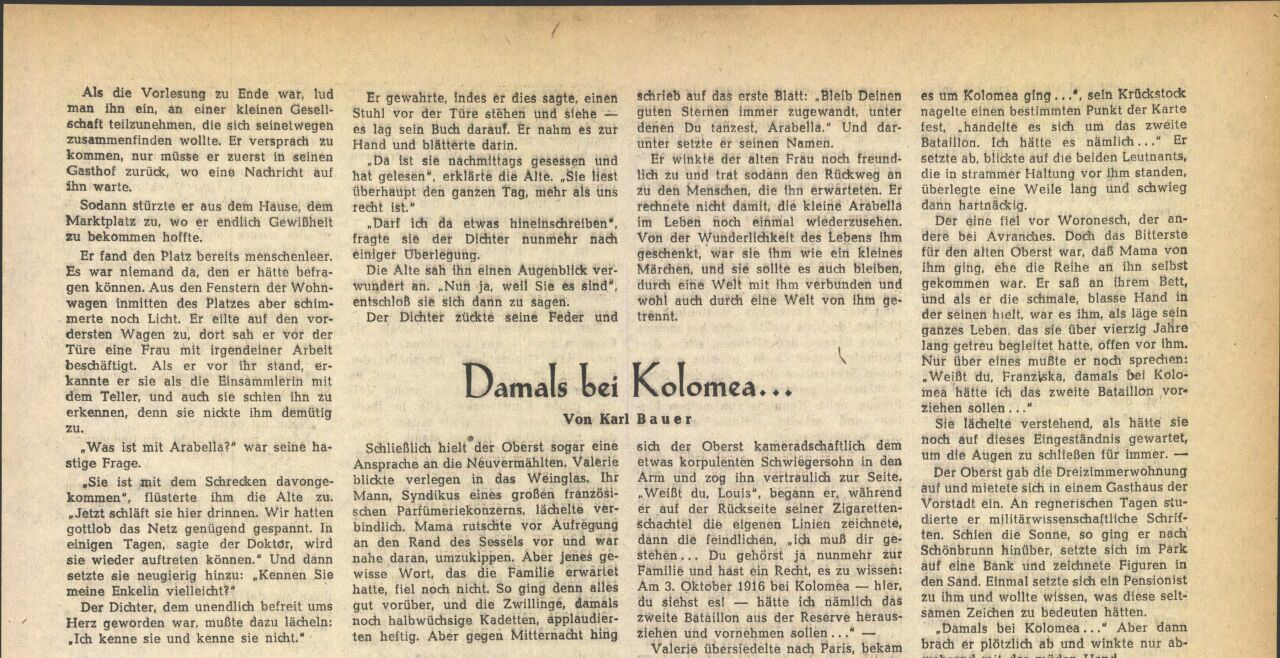
Das muß ein herrliches Gefühl sein, so etwas aufzurichten: man rollt einen Stacheldraht ab, postiert sich mit einer Maschinenpistole dahinter, und schon ist die Grenze fertig. Schön muß aber auch das Gefühl sein, einer Grenze die lange Nase zu zeigen — Spatzen und Äroplane wissen ein Lied davon zu singen. Denn Grenzen haben einen furchtbaren Feind, nämlich die Luft, und solange man noch nicht Wolken verhaften kann, bleibt auch die schönste Schranke etwas Mißliches. Trotzdem ist unsere Zeit sehr produktiv im Erzeugen von Grenzen, und wenn man sich's überlegt, hat ja jeder Vorteil davon: der Staat bekommt Zolleinnahmen, zahlreiche Beamte ihr Brot samt den Konfiskationsprämien, die Grenzbevölkerung widmet sich dem Paschen, die Reisenden schmuggeln ebenfalls, und auch die Hersteller von Paßphotos und Stacheldraht haben zu leben. Obwohl also eine Grenze meist die sogenannten niederen Instinkte anregt, ist sie doch etwas Heiliges: als Romulus sah, wie Remus den Grenzwall Roms aus Jux übersprang, schlug er seinen Bruder tot. Damit beginnt die Geschichte Roms, und seitdem hat jede Grenze ihren Romulus und ihren Remus: weil es bei so etwas nichts zu lachen gibt.
Wie es bei den Pumpen die Druckpumpen und die Saugpumpen gibt, so kann man auch bei den Grenzen Druckgrenzen und Sauggrenzen unterscheiden. Bei der Sauggrenze kommt man leicht hinein, aber schwer heraus; bei der Druckgrenze ist es umgekehrt: da kommt man schwer hinein, aber sehr leicht, sogar per Schub, wieder heraus. Wenn es in einem Lande nicht gar so schön aussieht, hat es seltsamerweise eine Sauggrenze. Zum Beispiel ist es verdammt leicht, nach Rußland hineinzukommen, aber das Herauskommen soll mit Schwierigkeiten verbunden sein. Lebt sidis jedoch in einem Lande vergnüglich, so hat es naturgemäß eine Drudegrenze, wie zum Beispiel die USA. Höchst interessant aber wird es, wenn eine Druckgrenze und eine Sauggrenze aneinander stoßen. So ließ die Schweiz (niemand kann's ihr verdenken) kurz nach dem Kriege nur ungern herein, und das besetzte Deutschland ließ erst recht nicht hinaus — denn es galt, Völkerwanderungen abzubremsen. Schreiber dieses hat acht Monate gebraucht, um Sog und Druck zu überwinden. Das war ein Sprung!
Rührend an den Grenzen ist die Sorgfalt, mit der sie auf deine Individualität eingehen. Sie wollen alles von dir wissen und studieren sogar deinen Fingerabdruck, weil es ein Langfinger sein könnte. Keine Warze bleibt unbeachtet, jeder versucht krampfhaft, sich selber ähnlich zu sein — kurz, nirgends wird ein solcher Persönlichkeitskultus getrieben wie an der Grenze. Und werden endlich Tasdien und Weltanschauungen sanft abgetastet, so merkt auch der Stumpfeste, daß er ein unnachahmliches Geschöpf Gottes ist. *
Die psychische Wirkung einer Grenze besteht darin, daß man vor dem überschreiten Angst hat und nach dem Uberschreiten froh ist. Grenzen sind wahrscheinlich die größten Angst- und Freudenspender, die es gegenwärtig in der Welt gibt. Während des Grenzüber-. ganges dagegen schauen alle Reisenden unschuldig drein (wobei sie innerlich Stoßgebete abschicken). In der Tat, nirgends wird soviel Unschuld erzeugt wie an der Grenze — aber ach, nirgends gibt es auch soviel Zweifel an der menschlichen Natur! Zollbeamte haben es mit den Irrenärzten gemeinsam, daß sie zuweilen von ihrer Klientel angesteckt werden, denn sie trauen niemand über den Weg, und endlich auch nicht mehr sich selber. Es sollen da interessante Sprünge von plus nach minus Unendlichkeit vorkommen. Zum Beispiel war kurz nach dem ersten Weltkrieg die Grenzkontrolle zwischen Österreich und der Tschechoslowakei sehr streng. Leute, die Lundenburg passieren mußten, erzählten, daß sich dabei regelmäßig folgender Vorgang abspielte: Der Beamte reißt die
Kupeetür auf und schreit mit blutunterlaufenen Augen: „Harn S' Butter?“
„O nein... nein... gewiß nicht...“
Din Tür fällt krachend zu. Doch sogleich öifnet sie sich zum Spalt, und dieselbe Stimme fragt flüsternd herein:
„Wollen S' Butter?“
Hieraus kann man ersehen, daß eine Grenze zwei Antlitze trägt, wie Janus der Gott des Krieges, welcher ja auch stets gern an den Grenzen herumlungert. Dabei haben die Grenzen die geheimnisvolle Fähigkeit, alles schäbig zu machen: neueste Kleidungsstücke werden gebraucht und alt, Juwelen Imitationen, Rembrandts Öldrucke, gute Gewissen schlecht, Pässe erweisen sich als abgelaufen, und selbst die Menschen zeigen körperliche Mißbildungen, wodurch sich sogleich ein graues Untergangsgefühl verbreitet, daß mit dieser Welt eigentlich nichts los sei.... Nur die Zollbeamten scheinen sich den strahlenden Kinderglauben bewahrt zu haben. Dank ihm entdecken sie in Klumpfüßen Goldbairen, in Buckeln Brüsseler Spitzen und stellen so das schöne Bild des Menschen wieder her.
Als das Schicksal die Völker nach Europa warf, riefen sie, ganz wie bei Nestroy, optimistisch: „Wir werden uns schon zusammen separieren, daß wir Platz haben alle.“ Denn in diesem engen Erdteil müssen die Glieder der Völkerfamilie ihren Lebensraum durch Wandschirme markieren, und um die Küchenbenutzung gibt es dauernden Krach. Das schwierige Zollproblem in unserer Siedlung lautet: wie mache ich die Öffnung im Nachbarzaun so groß, daß meine Hühner bei ihm im Beet kratzen können, aber doch wieder so klein, daß die Nachbarshühner nicht zu mir herein können? — Je kleiner ein Staat, desto heiliger ist ihm die Grenze, während die Großkopfe-ten einem Wunschtraum nachhängen, welcher „natürliche Grenzen“ heißt, die Jedoch in seltsam er Geographie meist durch Blutströme und Leichenberge bezeichnet werden. Wie angstvoll fragte Holland bei Deutschland an, ob man auch seine Grenzen achten werde — fast wie ein kleines Mädchen, das der Mörder schon an der Hand genommen hat —, und wie feierlich ward ihm dieses, noch kurz vor dem Einmarsch, zugesichert! Und wie überrascht war das kleine Finnland, als es von Rußland erfuhr, daß es dessen Grenze durch Kanonenschüsse verletzt habe! Ach, die Grenzen sind im Kriege so malträtiert worden, daß man sich nicht wundern kann, wenn sie nun aus Ressentiment auch uns Friedliche ein wenig zwicken. Und dabei waren sie doch vor 1914 so gemütlich ... Heute dagegen steht so ein Ding, das wie das Drahtgitter eines Tennisplatzes ausschaut, und bildet sich ein, die Grenze zwischen Gut und Böse vorzustellen. Auf der einen Seite zum Beispiel darf man noch an Gott glauben, während ein Mensch, der es auf der anderen Seite tut, zum Bürger zweiter Klasse degradiert wird. Eine solche Kraft kann in einem Drahtgitter stecken. Wie kraftlos, wie melancholisch liegen doch die alten Grenzen in der Welt umher — mit ausgebrochenen Zähnen, vermoosten Augenhöhlen, nichts vor nichts schützend — und werden furchtlos von uns Menschenkäfern bekrochen. Wahrlich, diese Erde ist ein Friedhof untergegangener Grenzen: kein Fußbreit, der nicht einst sein donnerndes „Bis hieher und nicht weiter!“ gerufen hätte. Die chinesische Mauer, diese ungeheuerste Anstrengung der Menschheit — wie abgestorben wandert nun ihre Silhouette über die abgestorbenen Berge. Oder jene meilenlange Titanenmauer von Ste-Odile am Vogesenrande — wer sie errichtet hat, weiß man nicht mehr, und gegen wen, das weiß man auch nicht... Wenn man einst im Zarenreich auf dem Petersburger Nikolai-Bahnhof ankam, so konnte man auf den Perrontafeln lesen: „Postzug nach Odessa“, „Schnellzug nach Tiflis“, „Kurierzug nach Wladiwostok“, und die wartenden Lokomotiven fauchten, weil sie gleich über den halben Erdball rattern mußten. Fuhr man dann aber westwärts weiter, so gab es schon 30 Minuten hinter Petersburg einen Aufenthalt: Zollrevision, anderes Geld, andere Sprache, andere Uniformen — Bjeloostrowo, die finnische Grenze! Aber weit seltsamer noch war die Grenze nach Ostpreußen mit der berühmten Station Wirballen-Eydtkuhnen. Diese besaß eine geheimnisvolle Eigenschaft: sie verlieh den Adel.
Jemand, der noch in Wirballen sagen wir
Spätzle hieß, unterschrieb sich 100 Meter weiter in Eydtkuhnen mit heimlicher Freude bereits „von Spätzle“. In Rußland nämlich brachte ein gewisser Beamtengrad automatisch den Adel, und da meinten manche, sie könnten jene Qualifikation an der Grenze gegen ein „von“ eintauschen. Dieses wurde von der bösen Welt „Eydtkuhnenscher Adel“ genannt. In der Tat, Grenzen machen Schicksale, denn sie und nichts anderes sind der Grund, warum ich 1930 preußischer Staatsbürger geworden bin. Zehn Jahre lang war ich hartnäckig „staatenlos“ geblieben, doch da stellte sich's bei meinen Reisen heraus, daß Grenzen, schon dem Normalmenschen nicht günstig gesinnt, gegen Staatenlose direkt aus dem Schilderhäuschen geraten. So wurde ich denn Preuße, nahm Kenntnis von meinen Farben und arbeite seitdem mehr in Schwarzweißmanier.
Und dabei habe ich doch solch eine Vorliebe für Grenzen. Ihre hohe Zeit war das Mittelalter. Diese Leute müssen in Grenzen geschwelgt haben — das Antlitz Europas schien gesprenkelt von Sommersprossen, aber die Züge waren schön. Vielleicht weil Paneuropa damals Wirklichkeit war: trotz tausend Schranken gab es doch weder Glaubens- noch Sprachgrenzen, und man besaß sogar ein Esperanto namens Latein. Denn nur die lebendige Einheit vermag die lebendige Vielfalt zu schaffen. Damals glaubte man ja auch, daß man sich vor bösen Geistern durch einen beschwörenden Kreidekreis abgrenzen könne, während das heute mehr durch Druckerschwärze versucht wird. Und was war denn die Scholastik anderes als die genaue Ausarbeitung gedanklicher Grenzen — Definitionen — innerhalb einer Gesamtidee? Das hatte seinen Vorteil: man konnte zusammenkommen und disputieren, denn man war sich über gewisse Grenzen einig. Und hier gelangen wir zum Wesen der Grenze: sie ist das, was trennt, aber zugleich auch verbindet! Darum ist das Meer — wie jeder Engländer zugeben wird — die ideale Grenze, denn was trennt und verbindet so sehr wie Neptun? Und darum kann der amerikanische Einheitsmensch uns mit unseren komischen Grenzen gar nicht verstehen — denn ihm wird ja solch ein Ubergang höchstens dadurch bemerkbar, daß der Neger im Speisewagen plötzlich keinen Whisky servieren darf. Das Mittelalter war äußerlich provinziell, aber innen universal; wir werden (nach und nach) äußerlich universal, sind aber innen provinziell geworden — man kann eben nicht von allem haben, das ist wie mit dem Fünfer und mit dem Weggli. Unser Pfingstwunder der Verständigung geht über umgeschnallte Kopfhörer, und dann fahren die Kongresse wieder verstört auseinander.
Der Unterschied ist der: damals, als Grenzen noch etwas vorstellten, suchte man das Grenzenlose innerhalb der Schranke zu verwirklichen — und es entstanden große Sprachen, große Völker, große Kunstwerke: alle in ihren Grenzen, deren jede doch mitten unter dem unendlichen Himmel stand. Heute dagegen gibt es einen Drang, dem Grenzenlosen durch oberflächliches Niederbrechen aller Schranken — etwa der Grammatik, der Sitten, der Kunstformen, der Glaubensformen — näherzukommen. Daß uns dann die Landesgrenzen lästig wurden (und sie selber obstinat), ist ja nur eine Folge davon. Kurz, das Grenzenlose läßt sich nur durch wahre Grenzen realisieren. Man schaue ein Paar schöne Augen an, dann wird man schon sehen, daß das Grenzenlose nicht so viel Raum braucht. Das lernt man in der Schweiz erkennen, denn wo gibt es ein Land mit so viel inneren Grenzen und doch solcher Kraft der Einheit? Sehen wir von dem Weltbürger Mr. Davis ab, so sind die Weltbürger Dante, Shakespeare, Moliere und Goethe es gerade dadurch geworden, daß sie in ihren Werken national waren, mehr noch: Nationen konsolidierten! ohne solches freilich zu beabsichtigen. Und dennoch hat ihr Geistesstrom die Sprachisolierung durchschlagen. Der Sprung vom Ich zur Welt führt über die Sprache, also über Heimat — oder aber ins Leere. Dieses Einssein von Grenzenlosigkeit und Ichbeschränkung hat die Lippen einer Dichterin zu den Worten bewegt:
Ich will in das Grenzenlose
zu mir zurück —