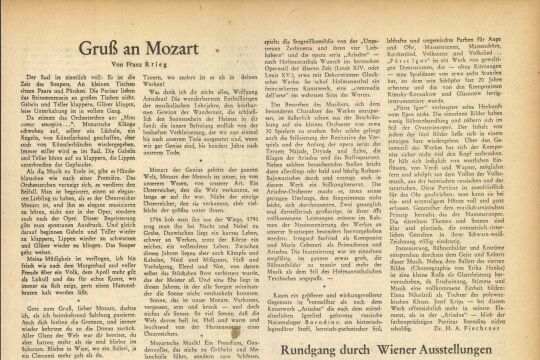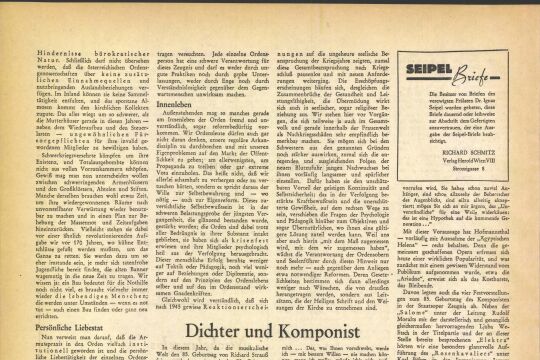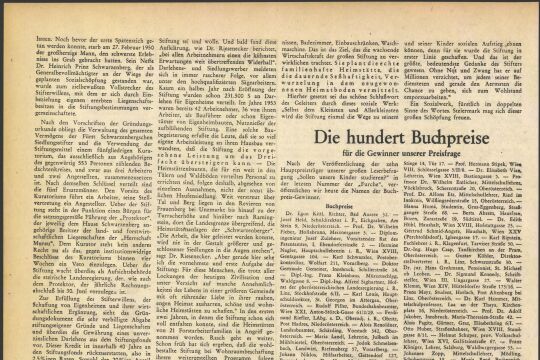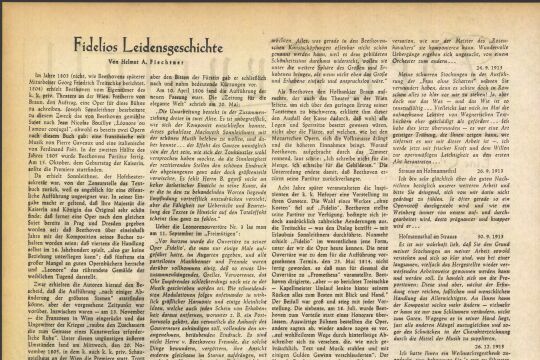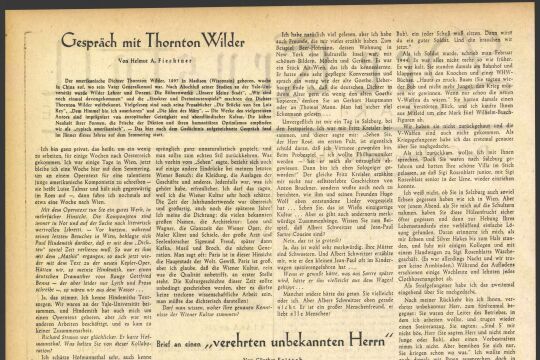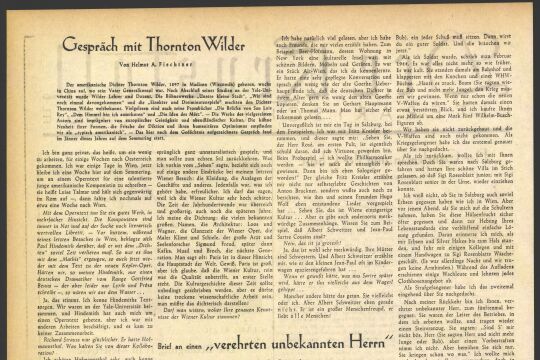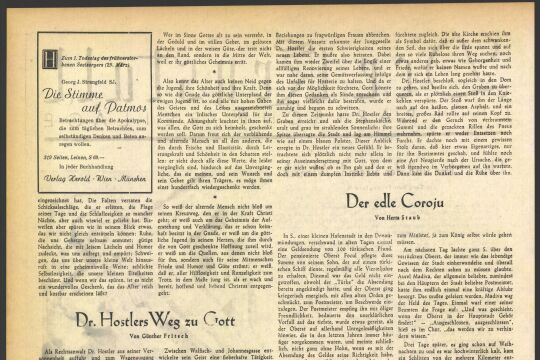Zwölf Werke, darunter sieben Opern, haben Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss im Laufe einer mehr als zwanzigjährigen Zusammenarbeit geschaffen, die man — wenn der Vergleich gestattet ist — als eine überaus fruchtbare Künstlerehe bezeichnen kann. Aber war diese Ehe auch eine glückliche? In keinem anderen Werk spiegeln sich die Schwierigkeiten und Krisen dieser intensivsten und dauerhaftesten Kollaboration, die die neuere Operngeschichte kennt, so deutlich wie in der „Ariadne“. Es führt ein langer und beschwerlicher Weg von dem Plan zu einer 30-Minuten-Oper, den Hofmannsthal in einem Brief aus dem Jahr 1911 — nur so nebenbei, in Klammern — erwähnt, über die Verkuppelung dieses mythologischen Divertissements mit dem „Bourgeois Gentilhomme“ des Moliere bis zur neuen Fassung als „Oper in einem Aufzug, nebst einem Vorspiel“ von 1916. Von allem Anfang an hat Hofmannsthal eine ganz präzise Vorstellung vom Stil und allen wesentlichen Elementen dieses neuen Werkes, das zunächst freilich nur als kleine Zwischenarbeit — nach dem „Rosenkavalier“ und vor der großen Oper „Die Frau ohne Schatten“ — angesehen und traktiert wird: ein Einakter für Kammerorchester mit heroischmythologischen Figuren im Kostüm des XVIII. Jahrhunderts und solchen aus der commedia dell' arte, Harlekins und Scara-mouches, heroische Elemente und Buffoneskes fortwährend verwebt, Handlung und Musik in Nummern gegliedert, das Dazwischenliegende entsprechend behandelt, womöglich unter Vermeidung des alten Secco-Rezitativs und der Prosa, nach Form und Gehalt also etwas durchaus Neuartiges auf der damaligen Opernbühne . . . Wir können dieses Projekt nicht genug bewundern, in dem künstlerische Einsichten und Möglichkeiten stecken, die eigentlich erst in unseren Tagen, nach einem Menschenalter, realisiert wurden. Wir befinden uns hier an einem Funkt, der zu einem Wendepunkt der modernen Operngeschichte hätte werden können. „Es sind die einmaligen Augenblicke im Leben des Künstlers, in denen sich die Frage öffnet. Beide haben den Augenblick, der Oper eine neue Richtung zu weisen, verspielt . . . Nach der .Ariadne' mußte die entscheidende Besinnung Platz greifen. Statt dessen wurden Stoffe und Formen gesucht, die den .Erfolg' wiederholen, die die Linie, die sich im Grunde als ungangbar erwiesen hatte, fortsetzen sollten“, urteilt der Musikforscher Egon Vietta. *
Begreiflich, daß Strauss, der ja auch in seiner Musik im Konservativen verharrte, nur zögernd nach dem Ariadne-Faden
„Mich persönlich“, schreibt er im Mai 1911 an Hofmanns-thal, „interessiert die Sache nicht gerade übermäßig, darum bat ich Sie, Ihren Pegasus etwas zu stimulieren, damit der Versklang mich etwas aufreizt. Sie kennen vielleicht meine Vorliebe für Schillersehe Hymnen und Rückertsche Schnörkel. Sowas regt mich zu formalen Orgien an, und die müssen hier herhalten, wo das Innere der Handlung einen kalt läßt. Eine schwungvolle Rhetorik kann mich genügend betäuben und mich über nicht Interessantes glücklich hinwegkomponieren lassen. Das Formenspiel, der Architekturgarten, muß hier in seine Rechte treten.“
Damit nun konnte Hofmannsthal nicht aufwarten, denn ihm ging es beim Ariadne-Text um das Inhaltsreich-Knappe und Prägnante. Er glaubt, ein kleines Meisterstück sui generis geschaffen zu haben, und daher ist seine Enttäuschung groß, als Strauss den fertigen Text mit einem höflichen „recht nett“ quittierte:
Ich will es offen sagen, daß mich Ihre sehr dürftigen und kühlen Worte über die fertige Ariadne, verglichen mit der Aufnahme jedes einzelnen Aktes des Rosenkavaliers, die mir
als eine der wesentlichen Freuden in jener Sache lebhaft im Gedächtnis sind, ein bißchen verdrossen haben. Ich bin der Ansicht, hier etwas mindestens so Gutes, ebenso Eigenartiges und Neuartiges geleistet zu haben, und so sehr wir darin übereinstimmen, eine gewisse gegenseitige Verhimmelung unaufrichtiger Art, wie sie unter mittelmäßigen Künstlern im Schwung ist, lieber von uns fernzuhalten, so müßte ich doch fragen, wessen Beifall in aller Welt mich für das Ausbleiben des Ihren entschädigen könnte!“
Strauss entschuldigte sich wegen seiner trockenen Art: er könne sich eben nicht verstellen — und gibt seiner Freude darüber Ausdruck, den großen Ariadne-Brief Hofmannsthals veranlaßt zu haben, der auch dem Publikum zum Verständnis der Oper helfen könne. Mit seiner Musik, die „als Partitur wirklich ein Meisterstück ist, das mir so bald keiner nachmacht“, und die allen denen, die etwas verstehen, einen neuen Weg der Spieloper weisen könne, ist er sehr zufrieden.
Äser dieses Werk bleibt das Schmerzens- und Sorgenkind der beiden Künstler, denn es war an die Moliere-Bearbeitung gebunden, die sich — infolge der umfangreichen Strauss'schen Musikeinlagen übermäßig gedehnt und in ihrem dramatischen Fluß unterbrochen — als nicht bühnenwirksam und schwer aufführbar erwies. (Strauss hat dann bekanntlich später die einzelnen Musikstücke zu einer selbständigen Orchestersuite zusammengestellt, die Oper „Ariadne auf Naxos“ wurde von dem Moliere-Lustspiel gelöst, mit einem Vorspiel versehen und in der neuen Gestalt zum erstenmal am 4. Oktober 1916 unter der Leitung Franz Schalks an der Wiener Staatsoper aufgeführt.)
Doch auch später kommt es wegen Details und Besetzungsfragen in der „Ariadne“ zwischen Strauss und Hofmannsthal zu Meinungsverschiedenheiten und lebhaften schriftlichen Auseinandersetzungen. Was Strauss wollte, was er schließlich durchsetzte, und worin er nachgab, geht aus einem Antwortbrief Hof-mannsthals hervor:
„Ich überlege mir seit zwei Tagen Ihren Brief mit dem sehr überraschenden Schlußvorschlag hin und her, komme aber der Sache nicht näher, sondern ferner. Ich fürchte, hier hat Sie der Theateropportunismus total auf den Holzweg gebracht. Zunächst ist mir die Besetzung des jungen Komponisten mit einer Dame völlig gegen den Strich. Dieses Verniedlichen gerade dieser Figur, um die der Geist und die Größe wittern sollen, in eine immer leise operettenhafte Travestie, das ist mir, verzeihen Sie meine Offenheit, greulich. Ich kann mir leider nur denken, daß unsere Auffassung dieser Figur hier sehr weit auseinandergeht, leider Gottes wieder einmal, wie bei Zerbinetta. O Gott, wäre es mir gegeben, Ihnen das Eigentliche, Geistige der Figur ganz deutlich zu machen. Anderseits bin ich ja nicht so verstockt, daß ick\ nicht verstünde, was Sie vermeiden wollen: den gräßlichen Tenor, ja, das verstehe ich schon . . . Und nun, ob Mann oder Weib — dieser Einfall für den Schluß ist geradezu entsetzlich, verzeihen Sie mir, lieber Doktor Strauss —, Sie haben diesen Brief in keinem guten Moment geschrieben. Denken Sie an die Höhe der Stimmung, die mühsam erklommen ist , . . Und nun, wo die nötige Coda nicht mehr als ein Moment sein darf: und nun solcher Quark wieder sich breitmachen darf (auf dem breit liegt der Ton): der Haushofmeister, das Honorar und der Graf und Tod und Teufel. Und das alles, damit die Rolle (der Sängerin Artot) ein Endchen länger wird. Dazu die stilistische Unmöglichkeit . . . Bitte schreiben Sie mir ein paar Worte expreß, daß Sie mich verstehen, mir wird ganz flau in Kopf und Magen, uns so weit auseinander zu fühlen.“
Strauss antwortet begütigend, bagatellisierend und nachgiebig. Man einigt sich und schließt einen Kompromiß wie schon so oft: der Komponist im Vorspiel bleibt Hosenrolle, der Schluß des Vorspiels wird nicht erweitert, sondern so belassen, wie Hofmanns-thal ihn ersann und wie es heute gespielt wird . . . Über Details hatte man sich wieder einmal verständigt, aber für „Ariadne“ haben die beiden Väter nicht die gleichen Gefühle. Mit allen dialektischen Mitteln verteidigt Hofmannsthal sein Lieblingskind, und wir glauben heute zu erkennen, daß es ihm dabei um mehr ging als um ein einzelnes seiner Libretti: von hier führten mehrere Wege in Neuland, am Faden der Ariadne sollte Strauss sich hineintasten. „Ich verspreche Ihnen, daß ich den Wagner-schen Musizierpanzer nun definitiv abgestreift habe“, schrieb Strauss. Aber schon in seinem nächsten Werk hatte er ihn wieder umgeschnallt, und in der „Liebe der Danae“, der letzten Oper nach einem Hofmannsthalschen Szenarium, tritt Wotan —
als Jupiter maskiert — blechbläsergepanzert und mit unvermindertem Pathos wieder aus den Kulissen. •.
Ariadne“ hatte schöne Aufführungen, aber keinen Erfolg. Man dürfe nicht ins deutsche Publikum hineinhorchen, wenn man die Lust zum Arbeiten behalten wolle, tröstet Hofmannsthal sich und seinen Partner, einen Brief Goethes an Alexander von Humboldt zitierend. Anderseits meint er zu beobachten, „wie sich die entscheidenden, Elemente des Publikums um dieses Werk sammeln“. Die Kritik freilich versagt vor ihm am ärgsten und wird darob sehr temperamentvoll verdonnert („Keine Katze, aber auch keine Katze von dem schreibenden Gesindel“ habe gemerkt, worum es in „Ariadne“ geht). Im Mai 1918 wohnten Strauss und Hofmannsthal in Wien gemeinsam einer besonders schönen Aufführung der „Ariadne“ bei, die in Hofmannsthal ernste Gedanken auslöst, die er einmal später seinem Mitarbeiter ausführlich darlegen will.
„Alles in allem höre ich immer aufs neue, dies unser gemeinsames Werk von allen aufs Liebste. Hier allein sind Sie ganz mit mir, und hier — was geheimnisvoller ist — sind Sie auch ganz mit sich selber gegangen. Hier waren Sie einmal völlig frei von dem Gedanken an Wirkung. Das Zarteste und Eigenste ist Ihnen hier nicht zu einfach, zu gering erschienen. Sie sind der geheimsten Inspiration gefolgt und haben das Schönste gegeben, und, glauben Sie mir, das, was von allen diesen Werken die stärkste Bürgschaft der Dauer in sich trägt. Von hier aus führt auch für mich, wenn ich an Sie denke, der Weg weiter: nicht einer, sondern mehiere.“ Auf diesen mahnenden und divinatorischen Brief Hofmannsthals antwortete Strauss ziemlich trocken:
„Daß sie an .Ariadne' glauben und sie lieben, freut mich sehr: leider wird diese Liebe und dieser Glaube vom Publikum und den deutschen Theaterleitern so wenig geteilt, daß das schöne Werk, mit Ausnahme von Wien und München, so ziemlich überalt vom Spielplan verschwunden ist. Müssen wir halt auf die liebe Nachwelt hoffen.“
Zu der Frage, die wir zum Schluß stellen und die von zeitgenössischen Musikern und Opernfachleuten, je nach ihrem Standpunkt, verschieden beantwortet wird: was denn nun eigentlich durch Strauss und Hofmannsthal für die Oper als Gattung, für ihre Weiterentwicklung und ihre Erneuerung, geleistet wurde, hören wir die Meinung eines „Neutralen“, der ein scharfsichtiger Beobachter und Diagnostiker seiner Zeit war. Rudolf Kassner schreibt: „Ich glaube nicht, daß Hofmannsthals Zusammenarbeit mit dem berühmtesten Opernkomponisten der Gegenwart das gewiß sehr schwere Problem der Oper zur Lösung oder einer solchen auch nur den allerkleinsten Schritt nähergebracht hat. Wo etwas wie ein Ganzes aussieht, ist diese Ganzheit nur scheinbar. Es ist darum töricht, von Kongenialität zu reden. In keiner Oper scheint mir Musik so gegen das Wort, gegen die ganze Bildlichkeit der Sprache zu gehen wie in der .Ägyptischen Helena“. Doch mehr als die Beziehung zum Komponisten interessiert mich Hofmannsthals Streben nach Mitte, nach Mythos, nach einem allgemeinen und bindenden Zusammenhängenden.“
Das Urteil Kassners mag hart und zu sehr verallgemeinernd sein, doch steckt in ihm jenes Körnchen Wahrheit, auf das es ankommt. Hofmannsthals weltliche Mission war das Theater: ein festliches Schauen und Hören, das mit Worten allein nicht zu verwirklichen ist, und das er mit Hilfe der Musik zu realisieren hoffte. Hierfür war ihm Richard Strauss der richtige Partner. “Um die Oper als Gattung zu erneuern, hätte er sich mit anderen, jüngeren Musikern verbinden müssen. Daran hinderte ihn vielleicht nur — wir wissen es nicht, wer dürfte diese Frage auf ja oder nein beantworten? — sein allzu früher Tod. So kam es, daß „Ariadne“ weder Geschwister noch Kinder erhielt. Auch scheint es ihr Schicksal zu sein, immer wieder verlassen zu werden . . .