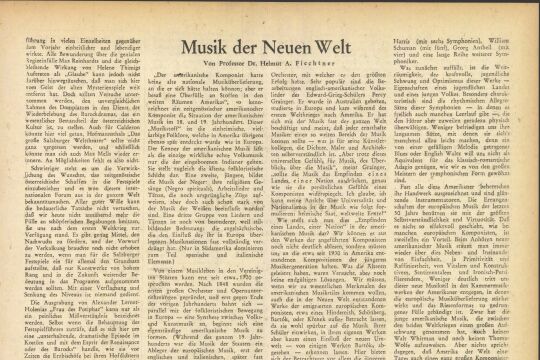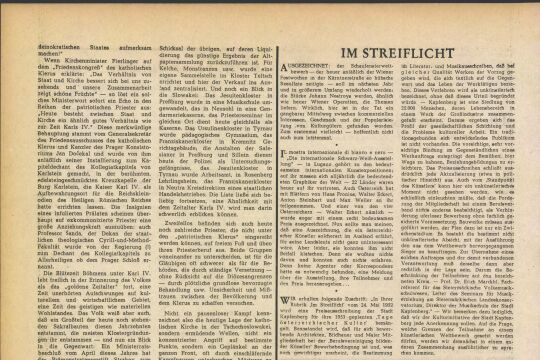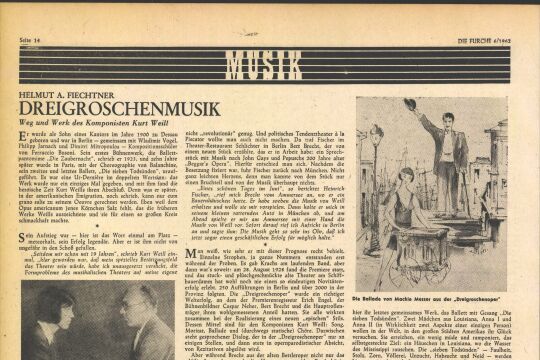Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Am Rand der Opernwelt
In bescheidenstem Rahmen gab es neulich eine europäische Erstaufführung — wenn wir der Ankündigung auf dem Programmzettel trauen dürfen: das Carriage House Theatre spielte auf einer Behelfsbühne im Clam Gallas Service Club Vlenna das Musical Drama .Down in the Valley“ von Kurt W e i 11. Das Milieu und da6 ganze Drum und Dran der Aufführung, die Ausführenden — amerikanische Soldaten und einige Mädchen mit Namen aus aller Herren Länder —, waren ganz im Stil und Geschmack des Komponisten. Die berühmten Brecht-Weiil-schen illusionsstörenden Verfremdungseffekte* wurden in reichem Maß, wenn auch unfreiwillig, durch die Nähe zur Bühne, das laienhafte Singen und die ungelenken Tänze erzielt. Dem primitiv-kitschigen Libretto von Arnold Sundgaard (eine Liebes- und Mordgeschichte in gedrängten Bildern) entspricht auch die Musik. Die Benützung amerikanischer Volkslieder und die Bestimmung dieses Singspiels für College-Ensembles scheint uns zur Erklärung der musikalischen Anspruchslosigkeit nicht auszureichen. Etwa die Hälfte der Mu6ik hat kaum höheres Niveau als die Improvisationen eines talentierten Jazzpiani-6tenj die Volkslieder 6ind ziemlich unverändert übernommen; nur drei Nummern“ (ein pentatonischer Reigen, ein getanztes Spiritual und eine .Arie“) zeigen die Klaue des Löwen; dagegen bewegt sich der Titelschlager im Fahrwasser von .Seemanns Los“. — Mehr al6 das Versagen einzelner Partien bedrückt das Fehlen eines einheitlichen Stils, der einmal Kurt Weills Stärke war und auch dem kleinsten Stück aus seiner Werkstatt wie in scharfer Geruch von Tabak, Whisky und Juchten anhaftete.
Während der letzten Wochen wurden durch
eine Reihe von Aufführungen in Konzertsaal, Kino und Senderaum unsere Gedanken immer wieder auf diesen hochtalentiertÄ Komponisten gelenkt, über dessen Weg und Schicksal nachzusinnen schon deshalb lohnend ist, weil das zeitgenössische musikalische Theater, besonders das deutsche, durch sein Schaffen, aber auch durch 6eine scharfsinnigen dialektischen Überlegungen, stärkste Impulse empfangen hat. Impulse übrigens, die sich längst noch nicht voll ausgewirkt haben, obwohl auch schon starke Gegenströmungen gegen das „epische Theater“ spürbar sind. Weill ist also, obwohl man seit 1945 keinem seiner Bühnenwerke in Originalgestalt begegnete, auch heute hoch aktuell, und die Erinnerung daran, daß er vor einem Jahr in den USA starb, bietet uns nur den äußeren Anlaß zu diesem Rückblick.
Kurt Weill lenkte zu Beginn der zwanziger Jahre durch einige experimentelle Kammer-musdkwerke die Aufmerksamkeit auf sich. Seit 1925 widmete er sich der Oper. Diese erete Werkreihe (Der Protagonist, Der Zar läßt sich photographieren, Royal Palace und die szenische Kantate Der neue Orpheus) zeigen noch keinen einheitlichen Stil, sondern läßt nur zweierlei erkennen: ihre Herkunft aus dem Experimentierkabinett Ferruccio Busonis und eine ungewöhnliche theatralische Begabung. — Dann kam Weill, etwa 1927, zu Bert Brecht und mit der „Dreigro6chenoper“ zu seinem ersten Welterfolg. Formal griff man — 6ich auch in dieser Hinsicht an die alte Beggars Opera anlehnend — auf die geschlossenen Nummern zurück. Zu Brechts aggressiven, sozialkritischen Texten fand Weill die entsprechende Musik, die 6ich weder mit Untermalung, „Vertonung“ begnügt, noch das Wort erdrückt. Weills Musik
„serviert“ gewissermaßen. Im Song fand er seinen eigentümlichen Stil, raffiniert und s o volkstümlich, wie kaum etwas, das nach 1920 geschaffen wurde. Weill wußte und empfand genau, was die Stunde geschlagen hatte; das erweisen übrigens auch seine letzten Werke, die er drüben in den USA schrieb. Hier, in den Songs und Ensembles der „Dreigroschenoper“ und in „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“, gelang ihm jene unwahrscheinliche Synthese von Ballade und Moritat, Romanze und Parodie, Deklamation und Kan-tilene, Sentiment und Kaltschnäuzigkeit, Anklage und zynische Lebenslehre. — Die Verbindung mit Brecht verhalf dem Musiker zu breiter Publikumswirkung; 6ie bedingte aber auch die Beschränkung auf ein Milieu, auf Typen, auf Fragestellungen, kurz: auf eine Art der Welt-Anschauung, die bei weitem nicht alle Kräfte und Fähigkeiten dieses hoch-talentierten Musikers ins Spiel brachte. Daß Weill auch über andere Töne verfügte, als die der „Dreigroschenoper“, nämlich über ernste, ergreifende, ja feierliche (nur das falsche heroische Pathos darf man bei ihm nicht suchen!), hört man aus dem „Lindberghflug“ (der vor kurzem in einer Studioaufführung im Konservatorium der Stadt Wien unter der Leitung von H. U. Staep6 zu hören war), in der Schuloper „Der Jasager“ und in Weills letzter, in Deutschland geschriebenen Oper
„Die Bürgschaft', nach einem Text von Caspar Neher.
Dann kam (über Paris, wo Weill ein Ballett schrieb) die Emigration in die USA, und mit ihr die Trennung von den alten Mitarbeitern, mit ihr wahrscheinlich auch die Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Weill tat dies auf die rascheste und zweckmäßigste Art: er schrieb für die Broadwaytheater, von deren Bühnen übrigens auch durchaus ernste und wertvolle Werke, wie Gershwins „Porgy and Beß“ und Menottis „Konsul“, ihren Weg in die Welt angetreten haben. Aber Weill gab es billiger als die Professionals des Broadway, Er wußte auch jetzt genau, was die Stunde geschlagen hatte und was die neue Welt von ihm erwartete. Was wir — freilich nur in Proben — von den in den USA entstandenen Stücken kennenlernten („Knickerbockers Holi-day“, „Streetscene“ und das erwähnte Singspiel „Down in the Valley“, das von der Opernabteilung der University of Indiania berühmt gemacht wurde), läßt uns den Weg eines Künstlers beklagen, der in der alten Heimat vermutlich anders verlaufen wäre. Eine Ausnahme scheint lediglich Weills letzte Oper „Lost in the Stars“ zu bilden, die vor kurzem im Staatstheater Kassel unter dem Titel „Das verlorene Lied“ ihre erfolgreiche deutsche Erstaufführung erlebte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!