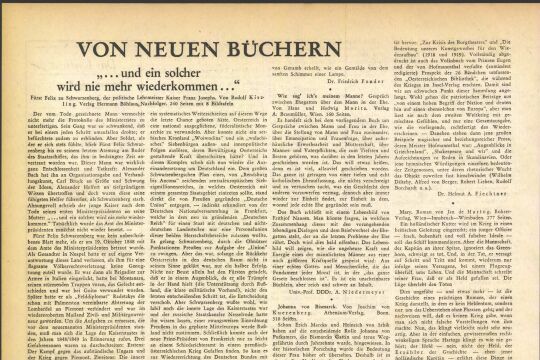Ias Schriftwerk Franz Josephs, das heute run größten Teil zugänglich ist, besitzt un- gewhnlichen Umfang. Es ist das Ergebnis eine fast achtzigjährigen Arbeit am Schreib- tisd Schon als Knabe war Franz Joseph in fleißiger, etwas frühreifer Verfasser printer Briefe. Der sehr intensive, auf die Herscheraufgabe vorbereitende Unterricht verrehrte die Schreibarbeit beachtlich, und die Übernahme des Throns im 18. Lebensjahrverdichtete sie im Banne des modernen Staasapparats zu einer fast ununterbrochenen fürotätigkeit, die buchstäblich bis zum letztn Lebenstag währte.
Ai SchreibtiscHerledigte Franz Joseph die ielsitigen politischen Agenden, die große Famienkorrespondenz und die tausend Dinge des Llltags, die innerhalb der Grenzen der Monrchie auf Entscheidung harrten oder dräuen in der Welt von Bedeutung für den Staa oder für die dynastischen Familien- bezihungen waren. Zahllose Briefe, Tele- grarmentwürfe, Akten, Tagebuchblätter, Noten usw. geben schriftliches Zeugnis für das 7erhalten des Kaisers als Mensch, Herrsche, Politiker sowie erster Beamter seines Reises und bilden eine Selbstbiographie eigeer Art.
Eeses riesige Schriftwerk und die ihm zuginde liegenden Arbeitsmethoden trugen Fraz Joseph schon zu Lebzeiten den Ruf eine nüchternen Bürokraten ein. Die Bio- grahen übernahmen dieses Urteil je nach ihren geistigen Standort mit einem negativen ode positiven Vorzeichen. Das vermag aber abe weder das Phänomen der 68jährigen Rejerungszeit in einem der kompliziertesten Staten der Geschichte zu erklären, noch er- scheßt es die psychische Substanz, in der dieunverrückbare Arbeitskraft, die Wirkung deiPersönlichkeit und die Fähigkeit, ununter- brehen schwerste Schicksalsschläge zu er- trgen, wurzelten. Man muß das sehr massive Vier der Äußerlichkeiten heben, um zum eigntlichen Wesen dieses Kaisers vorzu- dmgen.
Jm das Schriftwerk Franz Josephs zu deten, muß man den Zeitgeist der Jugend- jare Franz Josephs, des Vormärz, in Be- treht ziehen. Es sind das die Jahre, in daen die Persönlichkeit des späteren Mon- arien durch die Erziehung geprägt wurde. Dr allgemeine Brief- und Kanzleistil dieser Zct war umständlich, der Inhalt des per- sörlchen Schreibens war mit viel Sentimentalst und Schilderung alltäglichster Dinge beiden, wobei das Wetter, das Befinden des Scheibers und des Empfängers und die kleien Familienvorfälle einen wesentlichen Plaz einnahmen. Überschwengliche Höflich- keisfloskeln umrahmten das Ganze. Am Ho herrschte natürlich die gleiche Mode, und Fratz Josephs Erziehung war von ihr be- stinmt. Trotzdem eignet er sich nur gewisse Äußerlichkeiten an und behält sie bei. Gesundheit, Krankheit und Wetter werden von ihm immer ausführlich behandelt. Das bleibt das ganze Leben so. „Ich hatte”, schreibt er von Wien an seine Mutter über seine Rückreise von Ischl im Jahr 1850, „sehr schönes Wetter, so daß ich noch Donnerstag früh, die schönen Ischler Berge in der Ferne glühen sah. Hier, ist ganz Herbst, alles gelb und dürr, dabei seit meiner Ankunft sehr kalt and die Luft ist fürchterlich, wenn man von den Ischler Bergen kommt.”
Aus den vormärzlichen Jugendjahren be- lält Franz Joseph auch die Liebe zur Schilderung. Mit wenigen Strichen zeichnet :r Eindrücke, Ereignisse, Erlebnisse bildhaft inschaulich auf. Solche Stellen sind am ausführlichsten in seinen Jagdberichten an Albert von Sachsen, den engsten Freund des Lebens md den Jagdgenossen der wenigen freien Tage, enthalten. Es sind nicht die Schilde- ungen eines Dichters, aber sie machen ihm ichtlich Freude. In den Briefen der Knaben- ahre ergänzt er die Beschreibung einer Per- änlichkeit kurzerhand durch ein selbst- ezeichnetes Porträt, und noch als Kaiser eranischaulicht er in einem Brief die Unter- Hngung seines kranken Bruders Max durch ine Lageskizze des Krankenzimmers. Das lies läßt erkennen, daß es sich bei seinen schreibenden und schildernden Darstellun- ?n nįcht um ein bloß anerzogenes Können hndelt, sondern um die Äußerung einer ngeborenen Beobachtungsgabe und eines atürlichen Instinkts für das Wesentliche in iner Sache und bei einem Menschen.
Mit diesen Merkmalen sind aber die vor- närzlichen Züge in Franz Josephs Schriftwerk erschöpft, abgesehen von einigen altertümlichen Höflichkeitsformeln, die er längere Zeit gebraucht. Franz Joseph zeigt schon in seinen frühesten Briefen einen erstaunlich klaren Stil. Seine Diktion. ist eindeutig, unproblematisch, die Darstellung ist sicher, die Gedankenfolge logisch. Er schreibt gewandt und sichtlich leicht. Stilistische Probleme kennt er nicht, er ringt nicht um das Wort. Er meidet ungewöhnliche Ausdrücke, lange Sätze und starke Steigerungen. Was er schreibt, ist so gemeint, wie er es schreibt. Die Wurzel dieser Art ist nicht in der Erziehung und ihrer Zeit zu finden, sie muß daher im Charakter selbst liegen. Biographische Schwarz- Weiß-Malerei wollte daraus den Schluß auf eine kalte, „robuste”, „primitive” Natur Franz Josephs ziehen, sie übersieht aber, daß der knappe, sachliche Stil oft gerade Naturen zu eigen ist, die tiefe und komplizierte Charaktere sind, während umständliche Schwatzhaftigkeit sich häufig mit Oberflächlichkeit paart.
Der Stil Franz Josephs wird während seiner langen Arbeitsjahre immer knapper, ja fast dürr. Das ist, wenigstens zum Teil, durchaus nicht ungewollt. Die lebhafteren Farben, mit denen noch der Jüngling sein Briefe schreibt, werden schon vom jungen Kaiser, wie aus den Korrekturen an seinen Entwürfen ersichtlich ist, bewußt ausgemerzt. Das Schreiben eines Kaisers erfordert eben einen bestimmten Stil, wie auch das eines Beamten oder eines Kaufmanns. Aber diese Verknappung seiner Schreibweise ist nicht nur eine Stilfrage, sondern hat offensichtlich eine ganz elementare Ursache in seiner Arbeitstechnik. Gewohnt, alles selbst zu erledigen, lastet auf ihm eine ungeheure Arbeitsfülle. Er kümmert sich um alles, alle Fäden in der Monarchie und in der Familie laufen auf seinem Schreibtisch zusammen. Das erfordert höchste Arbeitsökonomie. Einsparung alles Nebensächlichen und Überflüssigen auch im Briefstil. Ja, der Brief selbst wird eine viel zu langwierige Sache: Franz Joseph wird zum Freund des Telegramms. Was überhaupt nur möglich, wird telegraphiscHerledigt. Es ist die kürzeste und schnellste Verbindung, und die Kürze wirkt nicht unhöflich, sie entschuldigt sich selbst. Wie auf diesem Wege vom Schreibtisch aus Brief, Akt und Gespräch ersetzt werden, zeigen folgende Beispiele: „Ist Unterstützung für die Donauüberschwemmten notwendig und wieviel?” lautet eine Anfrage an den Ministerpräsidenten Taaffe (1883). Der Oberhofmeister Fürst Hohenlohe wird angewiesen, sich um eine kaiserliche Familienangelegenheit zu kümmern: „Mein Schwager Karl und seine Frau treffen am 6. Novbr. früh in Wien ein. Bitte, wegen Wagen am Bahnhof und wegen Wohnung zu veranlassen” (1884). „Seit drei Tagen bekomme ich keine diplomatischen Berichte”, mahnt er seine Beamten. Dem Prinzen von Wales wird telegraphiert: „Ein von Dir gestern angeschossener starker Vierzehnender ist gefunden worden.” Der ungarische Ministerpräsident von Tisza wird angewiesen: „Minister-Conferenz unter meinem Vorsitz findet morgen um 2 Uhr statt. Früher Besprechung der Minister bei Graf Kalnoky.”
Das sind die typischen Telegramme Franz Josephs in vollem Wortlaut, wie sie täglich in mehr oder minder großer Zahl hinausflattern, gleichgültig, wo immer er sich aufhält. Dagegen hat er das Telephon nie benützt — was ihm als altmodische Starrheit vorgeworfen wurde —, weil man da keinen wortgetreuen Aktenbeleg erhält. Beim Telegramm ist er vorhanden, und um ganz sicher zu gehen, schreibt er sämtliche Telegrammentwürfe selbst. Sie dienen ihm als Erinnerungsvermerk, schriftliche Erledigung und Kontrollmittel, falls sich ein Mißverständnis einschlich.
Diese arbeitstechnische Beschränkung auf das Sachlichste erfaßt schließlich auch seine persönlichsten Briefe. Selbst seine interessanten Jagdberichte an Albert von Sachsen schrumpfen mit der Zeit zu bloßen Schußlisten zusammen. Diese Kürze führt aber nicht zur Blässe, sondern im Gegenteil zu höchster Konzentration des Inhalts. Jedes Wort wiegt schwer. Das beginnt bei der Adresse, die Franz Joseph immer sorgfältig selbst konzipiert. Adresse und Anrede zeigen, meist durch die Wahl des Titels, bereits Anerkennung, Unmut, Tadel, Zustimmung. Als die Briefe an Albert von Sachsen trockener werden, da tritt an die Stelle der Anrede „Lieber” die Steigerung „Liebster Albert”. Es ersetzt lange Beteuerungen noch immer bestehender Freundschaft, die schließlich doch abgedroschen klingen. Die zwei Buchstaben mehr sagen alles. Der feinfühlige Albert hat es auch verstanden.
Auch die Unterschrift ist genau überlegt. Die Paraphe „F” genügt für den größten Teil; Seiner Gattin Elisabeth unterschreibt er oft mit dem von ihr erfundenen Kosenamen „Megaliotis” — „Der Große”. Frau Schratt erhält als einziges Zeichen der persönlichen Freundschaft das volle „Franz Joseph”. Ansonst werden die Höflichkeitsformeln bald stereotyp, die Ökonomie der Arbeit läßt für Stilübungen keine Zeit.
Die kurze, trockene Art des Schreibens ist also zu einem Teil eine gewollte Folge der persönlichen Arbeitstechnik und alt solche eine Weiterentwicklung der schon früh bei Franz Joseph vorhandenen stilistischen Klarheit. Es erhebt sich die Frage, ob dieser Stil der geradlinige Ausdruck eines einfachen, unkomplizierten Charakters ist und ob mit dieser Klarheit und Kargheit die Merkmale der schriftlichen Ausdrucksmittel bei Franz Joseph erschöpft sind.
Das Schriftwerk liefert Anhaltspunkte, daß das nicht zutrifft. Zunächst die Schrift selbst. Sie ist ebenfalls bemerkenswert klar, leserlich und erstaunlich frühreif. Sie behält den Schönschreibdrill der Zeit vor 1848 und den ursprünglichen Duktus bis ins Greisenalter. Trotzdem erfährt die Schrift Franz Josephs im Laufe der Jahre wesentliche und dauerhafte Veränderungen, was die Meinung vom starren, unveränderlichen Charakter Franz Josephs in die Welt der historischen Märchen verweist. Jedoch zeigen sich diese Änderungen wie alle Ausdrucksmittel bei ihm sehr zurückhaltend. Sie betreffen vor allem das Gesamtniveau und einzelne charakteristische Buchstabenformen. Merkwürdig ist das Fehlen von psychologisch-graphologischen Kennzeichen künstlerischer Eigenschaften. Das Leben scheint dieses Fehlen zu bestätigen. Er mag das Theater nicht. Er fördert gern Künstler, umgibt sich aber nicht mit ihren Produkten. Wohin ist die ausgesprochen künstlerische Veranlagung der Knabenjahre verschwunden? Man ahnt hier seelische Vorgänge, di nicht unmittelbar greifbar sind.
Der Inhalt des Schriftwerks enthält auch manche Andeutungen von psychischen Hintergründen. Durch die Jugendbriefe blitzt echter Humor, der sich auch selbst verulken kann. Durch seine intimsten Briefe atmet ein echter, warmer Herzenston. Mit seinen Kindern befaßt er sich sehr viel. „Sie jauchzte in einem fort”, erzählt er über sein erstgeborenes Töchterl seiner Mutter, „und war sehr damit beschäftigt, ihren Fuß in den Mund zu stecken und daran zu schnullen. Sie scheint viele gymnastische Anlagen zu haben.” Und nach dem frühen Tode dieses Kindes schreibt er wieder seiner Mutter: „Gestern ist Gisela bei Sisi in dem kleinen roten Fauteuil unserer armen Kleinen (der verstorbenen Sophie), der in dem Schreibzimmer steht, gesessen und da haben wir beide zusammen geweint, Gisela aber immer vor Freude über diesen neuen Ehrenplatz so herzlich gelacht.” Das ist ungeschminkte Offenheit, geschrieben wie empfunden.
Der wichtigste Schlüssel zum eigentlichen Charakter ist das ruckartige Verdorren des Gefühlsinhalts nach jeder Katastrophe. Gerade die Briefe an Freunde werden in diesen Augenblicken schlagartig sachlicher. Es ist die wachsende Erfahrung, daß es wenig Sinn hat, persönliche Gefühle zu Papier zu bringen. Es ist eine Art Selbstschutz, eine Ökonomie der Empfindungen, die die Erhaltung des seelischen Gleichgewichts ermöglicht. Das Schriftwerk beweist hier das Vorhandensein komplizierter seelischer Konflikte. Bin primitiver Charakter hätte die Keulenschläge des Schicksals nicht in dieser Weise registriert. Erzogen dazu, nach außen hin Haltung zu bewahren — man muß seine innersten Erlebnisse nicht jedem ins Gesicht schleudern und sich nicht wie ein Klageweib benehmen —, hat er nur diesen Ausgleich finden können. Der Mensch Franz Joseph kann in seinen letzten dreißig Lebensjahren sein inneres Erleben mit niemand mehr teilen, weil es ihm niemand erleichtern kann.
Die inneren Spannungen zwischen den verdeckten und den an die Oberfläche tretenden Charakterzügen sind bei genauerer Betrachtung im ganzen Schriftwerk zu erkennen. Sie äußern sich in seinen Klagen über Zeitmangel, über frühes Altern und in seinem politischen Pessimismus. „Verzeihung! Verzeihung! Nicht viel Zeit!” heißt es in einem Schreiben des Vierzehnjährigen. „Ich hoffe, von der vielen Hetze auszuruhen”, heißt es Jahre später. Die Hetze — dieses Thema wird ständig berührt. Es ist der Notschrei eines Menschen, der nicht zur Arbeitsmaschine veranlagt ist. Diese Unrast erfüllt ihn das ganze Leben und ist die Quelle seiner größten Fehler. Das Altern beklagt er seltsam früh: „Indem ich Dir für Deine Glückwünsche zu meinem Geburtstage, der in unserem angehenden Greisenalter kein Freudentag mehr ist, innigst danke…”, sagt er 1872 — mit zweiundvierzig Jahren! — in einem Brief an Albert von Sachsen. Es ist die Müdigkeit eines nie erlaubten „privaten” Lebensgefühls, einer Natur, die die eine Seite ihres Wesens nie in tatsächlich gelebtes Leben umsetzen kann. Das Ergebnis ist der Pessimismus als Ausfluß des Zwiespalts zwischen Seins- und Wunschform des Lebens. „Es ist ein recht hartes Brot, das ich habe, und nur das Vertrauen auf Gott und der redliche Wille, das Beste zu tun, kann die Kraft geben, nicht zu unterliegen”, klagt er 1867 seiner Mutter.
Der Krieg von 1866 reißt sein dynastisches Weltbild in den Abgrund und macht den Pessimismus zu seiner politischen Maxime, weil nunmehr auch das persönliche Vertrauen zu den letzten Vertretern der patriarchalischdynastischen Welt zerbrochen ist. „Erst jetzt kommt man so recht auf alle die Infamie und den raffinierten Betrug, dem wir zum Opfer gefallen sind. Das war alles zwischen Paris, Berlin und Florenz lange vorbereitet, und wir waren sehr ehrlich, aber sehr dumm. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod, der noch lange nicht aus ist, und es ist mit Berechnung auf unsere vollkommene Zerstörung abgesehen. Wenn man alle Welt gegen sich und gar keinen Freund hat, so ist wenig Aussicht auf Erfolg, aber man muß sich so lange wehren, als es geht, seine Pflicht bis zuletzt tun und endlich mit Ehre zugrunde gehen.”
Man gewinnt aus alldem den Eindruck, daß der eigentliche Motor im Wesen Franz Josephs die sehr tief gehenden Spannungen in seinem Charakter waren und nicht eine einseitige, primitive Natur. Das Schriftwerk gibt bei genauerer Betrachtung jedenfalls ein wesentlich anderes Bild, als es gemeinhin üblich ist. Franz Joseph ist auch am Schreibtisch eine von menschlicher Tragik umwölkte Persönlichkeit.