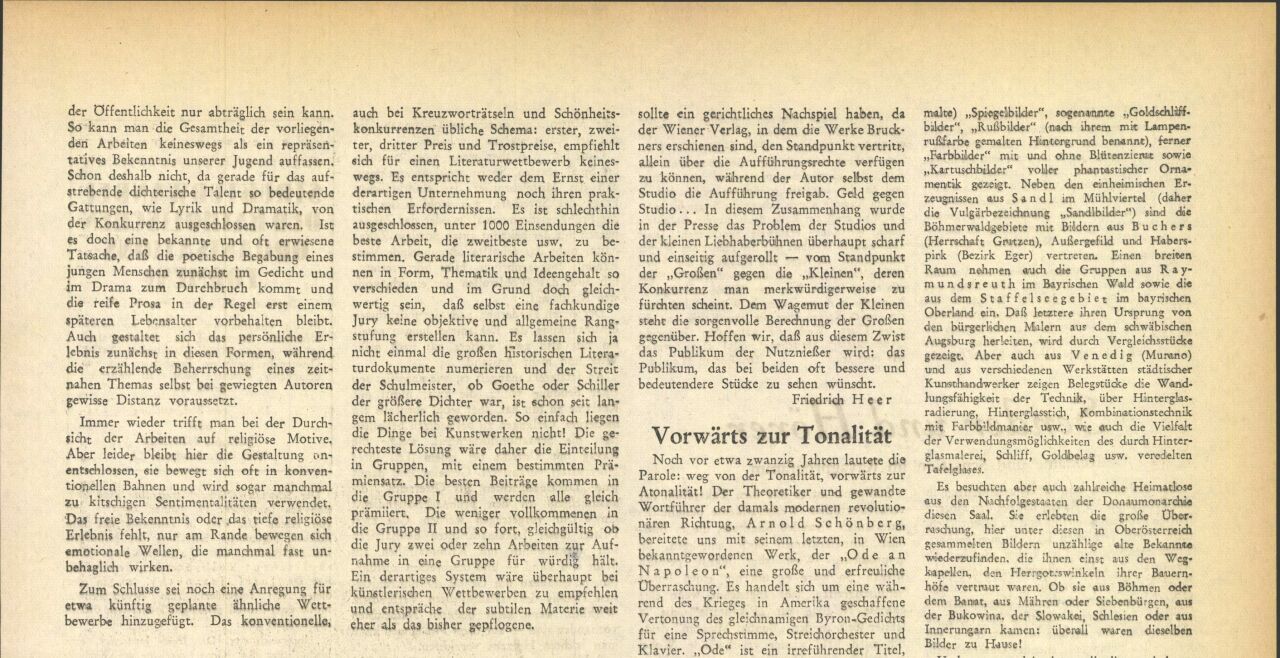
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Amerikanische Romantik
Amerika, jung, voll Lebenswillen — und romantisch. Im Zeichen eines romantischen Realismus, der Zeit und Zustände durchaus so sehen will, wie sie wirklich sind, und der dieselben, liebenden Herzens, in kritischer und poetischer Aussage verdichtet, stehen zwei Stücke, die gegenwärtig auf Wiener Bühnen laufen. Zwei echte Erfolge. „Dieg Lasmenagerie“ yon Tennessee Williams im Akademie theater darf als ein gewisser Höhepunkt des amerikanischen Neu-Biedermeier angesehen werden. Der Autor wurde berühmt durch sein Stück „A streetcar named desire — ein Stadtomnibus mit Namen Sehnsucht“. Der Titel dieses Stücks verrät bereits das allgemeine Anliegen des Dichters. Die grauen, harten, rohen, eckigen und kantigen Dinge des städtischen Alltags sollen, verdichtet in poetischen Symbolen und Gestalten, zum Klingen gebracht werden, Williams ist also ein Spürer, ein .Pfadfinder, ein Pionier. Er sucht nicht — wenigstens nicht direkt — Gold, Glück und Geld, sondern die Musik, die geheime Melodie, die begraben und verschüttet, in Zinskasernen, unter den Schlackobergen der großen und kleinen Dutzendscädte im gebrechlichen Leben der Durchschnittsmenschen aufklingt. Nicht Broadwaymelodies mit Luxuscars, Girls und Showbetrieben, sondern den leisen Ton, der gewoben ist aus verschwiegener Sehnsucht, aus Verzicht und aus täglichem Versagen. — Eine kleine Mietwohnung in St. Louis. Amanda Wingfield, die Mutter, träumt von schönen vergangenen Tagen im reichen konservativen Süden, und hält, erwachend, eine harte Hand über Sohn und Tochter. Tom entflieht schließlich, wie einst der Vater, in die „Freiheit“ — er geht zur See. Zurück bleibt Laura, das hinkende, zartschöne Mädchen mit seinen Nippesfiguren aus Glas -— weltscheu, verträumt, an der ersten und einzigen Begegnung mit der Welt zerbrechend. Ein Thema für E. Th. A. Hoffmann, für die ganze deutsche Romantik … Der junge Amerikaner ist scheinbar karg mit Worten, Gebärden und Symbolen, seine Figuren sprechen nur vom Sagbar-Täglichen die Musik schwingt zwischen den Worten und spärlichen Taten. Nur einmal wird voll und ganz der tiefdunkle Ton des Märchens und der Mythik beschworen: als Laura dem scheidenden jungen Mann als Angebinde das kleine gläserne Einhorn überreicht; das Tier der Sage und Legende, als Symbol des Schmerzensmannes und der Keuschheit verwoben in den Ranken der Stundenbücher und Tapisserien des Mittelalters. — Ein Stück, das wie dieses, ganz aus Atmosphäre bestellt, bedarf starker, tragender Kräfte — und hat sie hier gefunden: in Helene Thimig und Käthe Gold, Curd Jürgens und Josef Meinrad. Regie führte aufs Glücklichste Berthold Viertel, der nach langen Jahren heimgekehrte Dichter, der auch für die Übersetzung und Bearbeitung zeichnet.
Ein schärferer, kälterer Wind weht in Eimer Rices Schauspiel „Ein neues Leben“ in der Scala, Ein Kind wird geboren, in einer New-Yorker Klinik 1943, Die Mutter hat sich aus bescheidensten Verhältnissen emporgearbeitet, der Vater, derzeit Fliegerhauptmann, stammt aus einer reichen Industriellenfamilie Arizonas. Die beiden Eltern haben sich vor der Fleirat nur vierzehn Tage gekannt, dann mußte der Gatte an die Front. Kriegsehe, Schicksal im Kriege. Und hier setzt Rice den Hebel an: soll es so weitergehen? Von Krieg zu Krieg — „Privatleben“ nur in Atempausen des großen, lärmenden und mordenden Geschehens… Wenn dem nicht so sein soll, dann muß das Kind für eine neue Welt erzogen werden: für eine Wg’lt der Selbstdisziplin der Arbeit, des sozialen Verständnisses. Im Kampf der reichen Schwiegereltern und der Kindesmutter um das Erziebungsrecht über den Säugling bricht endlich auch in dem jungen Mann „ein neues Leben“ auf. Er tritt, gewandelt an die Seite seiner Frau. — Keine Dichtung, kein großes Drama — wohl aber: ein gutes, sauber gearbeitetes Zeitstück, jung, frisch, unsentimental und doch herzenswarm, lebensnah. Der Erfolg wird getragen von Härtens Raky, die sich selbst übertrifft.
Eine Gruppe junger Menschen hat sich zusammengetan und an der Stätte der einstigen „Literatur am Naschmarkt“, im Cafe Dobner, ein eigenes Theater eröffnet. „Theater der 49“ — ohne Konzession und, wie es bei der Eröffnung hieß, ohne Konzessionen… In seiner Eröffnungsansprache wies Hans Weigel auf das Schicksal jener Vorkriegsgeneration hin, die bis März 1938 versuchte, eigene Wege zu gehen und Wien den Wienern zu zeigen, wie es wirklich ist… Die Eröffnungsuraufführung, Reinhard Federmanns „Der Weg zum Frieden“ zeigt eine dramatische Begabung mit bemerkenswertem dialektischem Talent auf. Menschenschicksale zwischen Fronten, zwischen Völkern. Das Stück spielt in einer Bauernkate in den deutschböhmischen Grenzwäldern Ende 1944. Flüchtlinge — vor der SS, vor der Zeit, vor sich selbst. Alle gehen unter, die Aktivisten und die Passi- visten, auch das Mädchen Lida, das tapfer und vergeblich den Kampf gegen eine Übermacht aufnimmt. Die Darstellung ist bei allen lobenswerten Anstrengungen noch un- ausgereift und überakzentuiert, — Problematik des „neuen Theaters“, mehr noch einer „neuen Jugend“: noch ist keine wirklich neue Linie, keine wirklich neue Idee und Planung sichtbar. Bleibt doch die Hoffnung…
Mit ähnlichen gemischten Gefühlen verläßt man die Neuaufführung von Ferdinand Bruckners „Krankheit der Jugend“ im Studio der Hochschulen. Wie der Autor selbst in einem Brief an den Leiter des Studios betonte, will er dieses Drama von 1923 als historische Skizze gesehen wissen. Berlin 1923 also, einige Medizinstudentinnen mit Komplexen, Irrungen und Wirrungen der Gefühle — und Freder, der junge Zyniker, der dekadente Kraftmensch und Intellektuelle, Eine Vorstudie für gewisse Führertypen der SS, Also: eine medizinisch-sexualpathoJogische Studie. Das Spiel der jungen Leute von heute zeigt, wie fern ihnen und uns diese Welt bereits entrückt ist. — Ein anderes: diese Vorstellung sollte ein gerichtliches Nachspiel haben, da der Wiener Verlag, in dem die Werke Bruckners erschienen sind, den Standpunkt vertritt, allein über die Aufführungsrechte verfügen zu können, während der Autor selbst dem Studio die Aufführung freigab. Geld gegen Studio… In diesem Zusammenhang wurde in der Presse das Problem der Studios und der kleinen Liebhaberbühnen überhaupt scharf und einseitig aufgerollt — vom Standpunkt der „Großen“ gegen die „Kleinen“, deren Konkurrenz man merkwürdigerweise zu fürchten scheint. Dem Wagemut der Kleinen steht die sorgenvolle Berechnung der Großen gegenüber. Hoffen wir, daß aus diesem Zwist das Publikum der Nutznießer wird: das Publikum, das bei beiden oft bessere und bedeutendere Stücke zu sehen wünscht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!



































































































