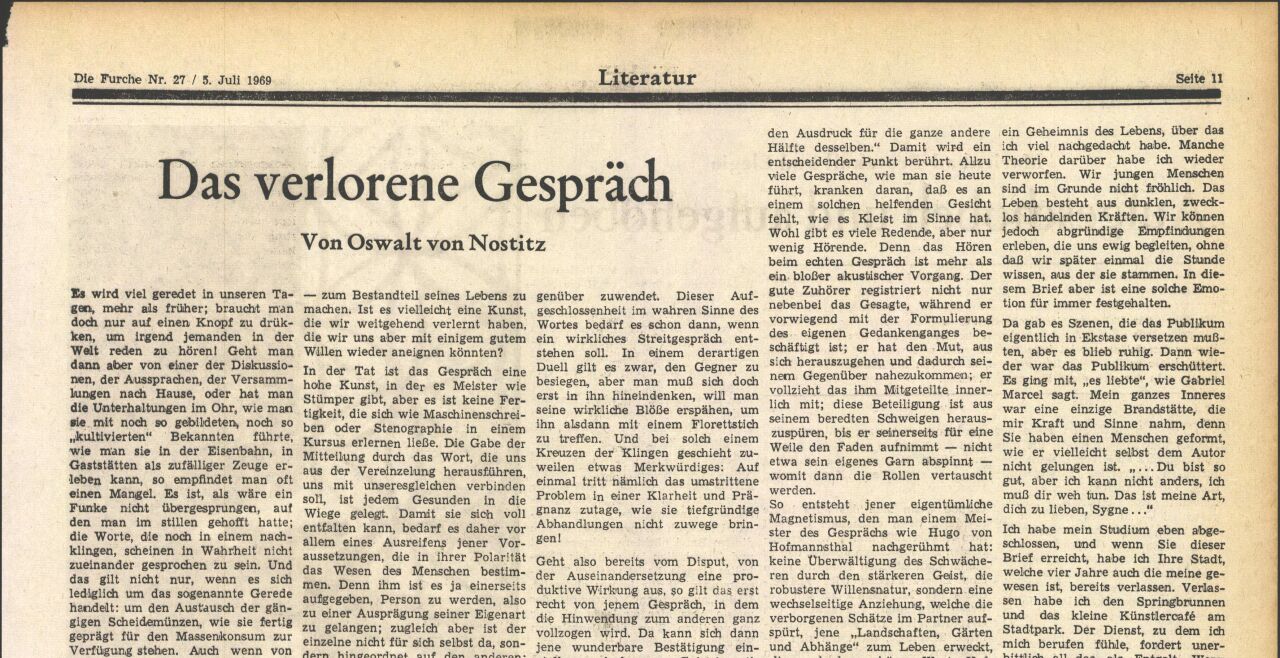
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
An einen Schauspieler
Wissen Sie ungefähr, wie hoch der Monatswechsel einer Studentin aus kleinen Verhältnissen ist? Nein, das wissen Sie nicht! Ich weiß, daß Sie es nicht ahnen und daß es Ihnen auch gleichgültig ist, sonst hätten Sie einen Blick, einen einzigen Blick aus Ihren Falkenaugen auf mich geworfen. Georges des Coüfon-taine, auf mich, die ich bei der Festpremiere im Großen Haus in der ersten Parkettreihe, eine Armlänge und eine Unendlichkeit von Ihnen entfernt, saß, ich, die ich für diesen Platz meine Wochenapanage gegeben hatte, nur um der Fiktion willen, Ihnen nahe zu sein, um eine kleine trügerische Annäherung an Sie zu erhaschen, Sie abertausendmal Entfernter! — So, und jetzt wissen Sie auch, wie hoch das Einkommen einer Studentin aus dem Stehpartarre ist, und von wem der weiße, gestrickte Handschuh kam, der während eines Wolkenbruchs von Beifall zu Ihren Füßen niederfiel, Sie ahnungsloser Blinder! Warum diese geistige Abwesenheit von Ihrem Publikum? Ist das Theater also doch eine Welt, in der alles der brutalen und blinden Herrschaft des Augenblicks unterworfen ist! Sie haben es dank Ihres Talents nicht nötig, sich der nutzlosen Billigung, dem „Geseire“ eines Regisseurs zu unterwerfen. Aphorismen kann man nicht nachspielen. Sie sind kein präparierter Spieler, und die Kunst ist nicht ihr bürgerlicher Beruf. Sie lassen den Horchenden die großen Worte in den wahren Dimensionen durchschauen und zeigen ihm alles Letzte, was hinter den Worten und Taten ist. Sie sind selbst ein Coü-fontaine, der um seinen Platz an der Sonne ringt. „... Und wie der Wein von Bouzy nicht der von Esseaume ist, so bin ich geboren als Coüfontaine kraft der Natur, worüber die Menschenrechte nichts vermögen ...“ — Wir sehen, daß wir bei Claudel sind. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie die-
ser Part anders gespielt werden könnte. Sie brauchen keinen Spiegel. Ihr Feldruf. „adsum“ ist ohne Maske echt und glaubhaft. Wenn Sie von der Bühne abtreten, sehen Sie nicht aus wie ein abgeschminkter Schauspieler, und rasch ist Ihr Name zu einer Formel geworden, die Vortreffliches aussagt. Das bat Ihnen unter dem Berg von Frauenbriefen, die Sie laufend erhalten, wohl noch kaum eine Frau, ein Mädchen gesagt. Finden Sie es rührend oder banal, daß ich Ihnen den Preis mitteile, den mich Ihr Anblick für drei Stunden gekostet hat? Mit diesem Geld muß ich eine ganze Woche leben, hören Sie: eine ganze Woche leben! Jetzt denken Sie gewiß, wie vernarrt ich in Sie sein müsse. Oder haben Sie etwas Mitgefühl, vielleicht sogar ein wenig Sorge darüber, daß ich Ihretwegen gehungert haben könnte? Beides ist zutreffend. Sind Sie etwa darauf eingebildet? Nein, ich halte Sie nicht für so eitel.
Gewiß schicken Ihnen andere Frauen Blumen, Champagner, goldene Amuletts. — Nun, das sind ja auch verheiratete Damen, die das Geld von ihren Ehemännern beziehen. Ich aber habe nur den winzig kleinen „Scheck“ von zu Hause. Dafür bekommen Sie von mir auch bloß einen Brief, einen ganz nach meiner Art, ohne Sie anzuschmachten, zum Tee zu bitten oder zum Rendezvous; denn ich habe soviel Phantasie, um mir die ganze Nüchternheit gewisser Briefe und deren Wirkung auf den Empfänger vorzustellen: „... Diese melodische Stimme! Dieser Körper, leicht und geschmeidig und in allen Verwandlungen gleich bezaubernd, am schönsten und berückendsten als Liebhaber mit der Anmut eines Ephe-ben und der Kraft eines Fechters...“ Solche Briefe schreibt man Ihnen doch!
Wie anders unsere Begegnung: Ich im Parkett — Sie auf der Bühne...
ein Geheimnis des Lebens, über das ich viel nachgedacht habe. Manche Theorie darüber habe ich wieder verworfen. Wir jungen Menschen sind im Grunde nicht fröhlich. Das Leben besteht aus dunklen, zwecklos handelnden Kräften. Wir können jedoch abgründige Empfindungen erleben, die uns ewig begleiten, ohne daß wir später einmal die Stunde wissen, aus der sie stammen. In diesem Brief aber ist eine solche Emotion für immer festgehalten.
Da gab es Szenen, die das Publikum eigentlich in Ekstase versetzen mußten, aber es blieb ruhig. Dann wieder war das Publikum erschüttert. Es ging mit, „es liebte“, wie Gabriel Marcel sagt. Mein ganzes Inneres war eine einzige Brandstätte, die mir Kraft und Sinne nahm, denn Sie haben einen Menschen geformt, wie er vielleicht selbst dem Autor nicht gelungen ist. „... Du bist so gut, aber ich kann nicht anders, ich muß dir weh tun. Das ist meine Art, dich zu lieben, Sygne ...“
Ich habe mein Studium eben abgeschlossen, und wenn Sie dieser Brief erreicht, habe ich Ihre Stadt, welche vier Jahre auch die meine gewesen ist, bereits verlassen. Verlassen habe ich den Springbrunnen und das kleine Künstleroafe am Stadtpark. Der Dienst, zu dem ich mich berufen fühle, fordert unerbittlich all das als Entgelt. Wenn der große rote Vorhang wieder vor Ihnen aufgeht, bin ich heimgekehrt in die „kleinen Verhältnisse“...
Der Essay über das „verlorene Gespräch“ ist dem bei Glock und Lutz in Nürnberg erschienenen Band „Präsenzen“ entnommen, der 20 kritische Beiträge zur europäischen Geistesgeschichte enthält, die Oswalt von Nostitz während der letzten 20 Jahre in verschiedenen Zeitschriften, vor allem in „Wort und Wahrheit“, veröffentlicht hat und nun — mit einem sehr wichtigen Vorwort eingeleitet und mit Anmerkungen und Register versehen — vorlegt. Diese Essays und Studien analysieren oder erhellen einzelne Probleme von Bergson, Peguy (den Nostitz für den Herold-Verlag übersetzt hat), Julien Green, Cesare Pavese, Kierkegaard, Buber, das Verhältnis zwischen Gide und Claudel, Rilke und Rodin, andere schildern Begegnungen mit dem Architekten Henry van de Velde und dem Bühnenbildner Gordon Craig. In die unmittelbare Gegenwart reichen die Abhandlungen über „Doktor Schiwago“, der Versuch über den Adel und eine Analyse der Veränderungen, die sich im Insel-Verlag zugetragen haben. Über Hofmannsthals „Aufzeichnungen“ zu schreiben, ist der Autor mehr legitimiert, als mancher reisende Rhetorikprofessor, denn Nostitz hat ein echtes Verhältnis zu diesem großen Konservativen; außerdem waren seine Eltern mit dem österreichischen Dichter durch viele Jahre eng befreundet.
Tradition und Aktualität: für Nostitz sind sie keine Gegensätze — obwohl die Verbindung zwischen der einen und der anderen erst durch die kulturlose Hitler-Zeit unterbrochen und darnach durch traditions/eind-
liehe Kulturmanager gefährdet wurde — und wird. Es ist der Schrei nach dem jeweils Neuesten, der so ruhige und gewichtige Stimmen wie die von Oswalt von Nostitz übertönt. Aber welche Persönlichkeiten und Kräfte in unserer Gegenwart wirklich „präsent“ und wichtig sind — das wird sich erst nach einigen Jahrzehnten erweisen. Wir meinen, daß die hier von Nostitz vorgestellten zum Wesentlichen unserer Zeit gehören, und daß auch er selbst an dem großen Erbe teilhat: durch seine Gedanken, durch die Art, wie er Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet, durch seine Person, nicht zuletzt durch den selten gewordenen Rang und Typus, den er repräsentiert.
HELMUT A. FIECHTNER
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!


































































































