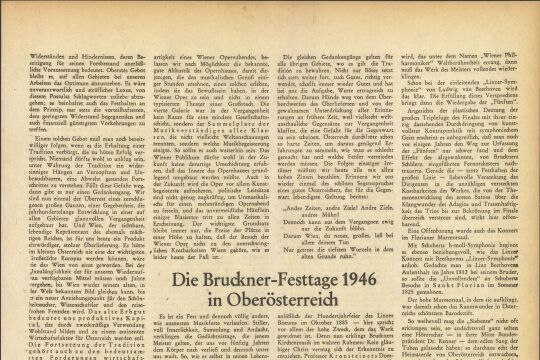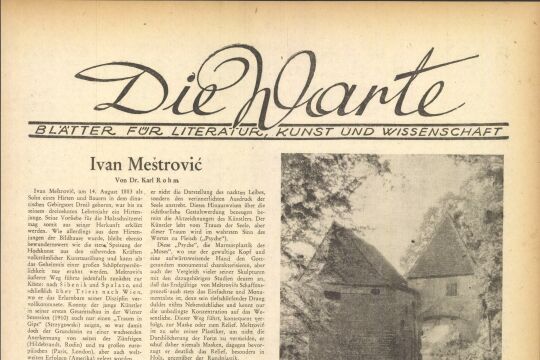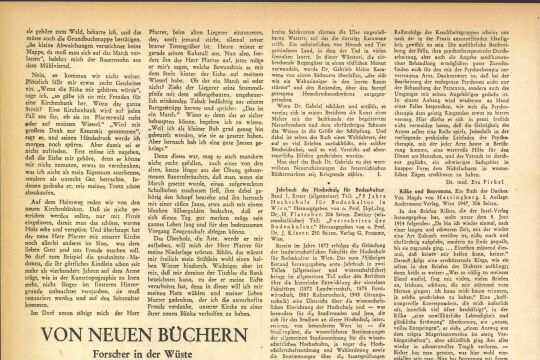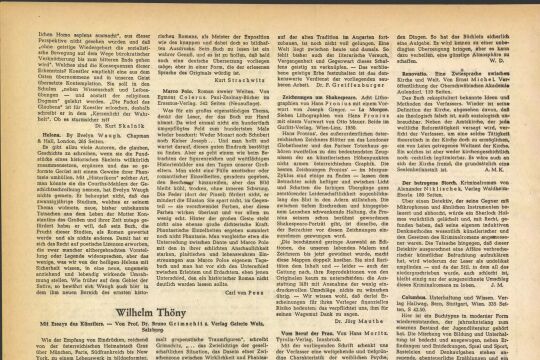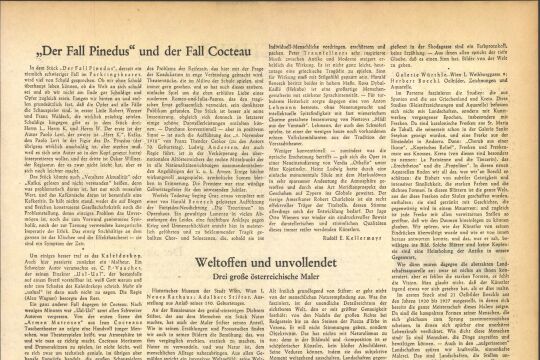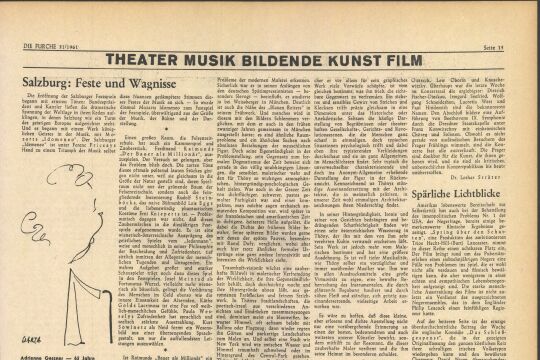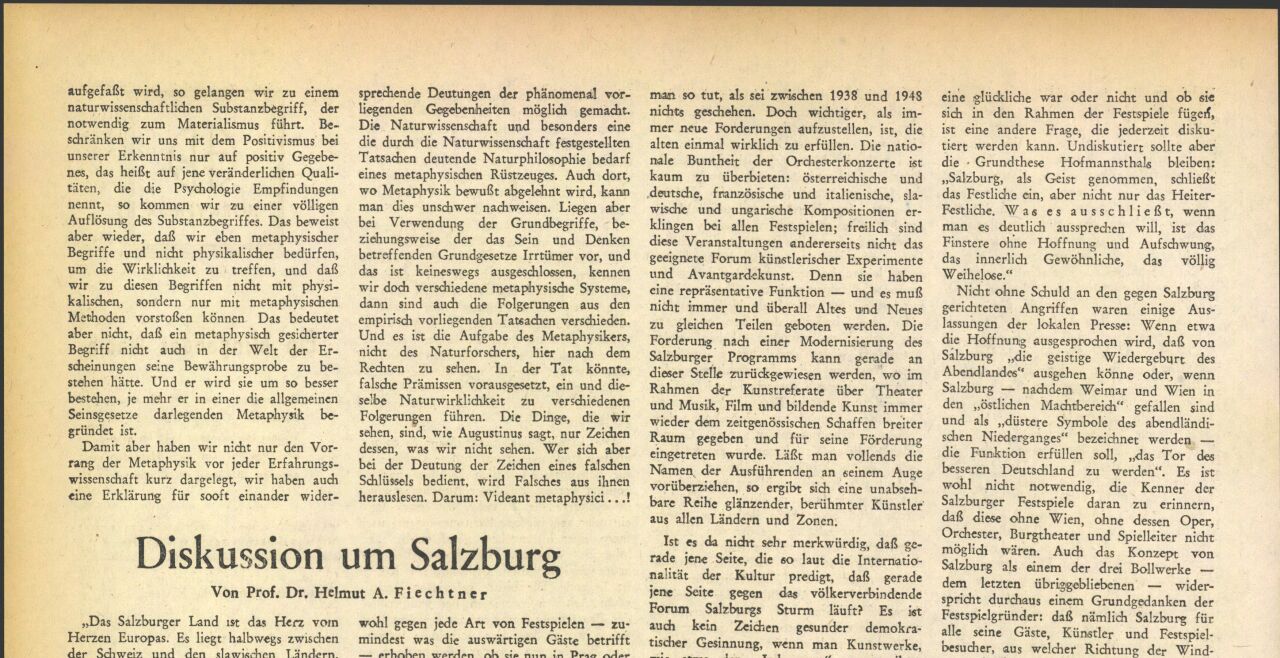
Es ist vielleicht nicht schlecht, daß Anton Faistauer bisher noch nicht allzusehr im Blickpunkt von Bio- und Monographen stand; es spreche vorerst sein Werk zu uns. Das Beste, was vorliegt, sagte Professor Dr. Hans Tietze (Wien) bisher. Aber auch er gibt einen sehr einseitig gesehenen Faistauer und ist vielleicht allzu leicht mit einer Formel bei der Hand. Auf die Dauer wird aber dieser große Künstler auch literarisch erfaßt werden müssen: er arbeitet nicht im Gleich-
mut eines abgezirkelten Könnens; tief griff das Leben in sein künstlerisches Schaffen herein, er mußte auch äußerlich ringen und suchte seine und seiner Zeitgenossen Art und Grenze zu erfassen. Sein 1923 erschienenes Buch „Neue Malerei in Österreich“ legt Rechenschaft ab vor sich und den andern und gibt Zeugnis von tiefster, auf Bewußtsein begründeter Verantwortung. Weiter führte er bis in seine letzten Lebenstage herunter Tagebücher, in denen er sich ein-gehend mit den Forderungen des Tages, seiner Aufgabe, seines Schaffens auseinandersetzte. Liegen sie noch vor? Ist davon noch etwas erreichbar? — Fragen, die wir uns mit fast bangem Gefühl stellen müssen. Für die Zeit seines Werdens wird der formell und inhaltlich nicht immer beglückende, künstlerisch primitiv gehaltene Schlüsselroman von Paris von Gütersloh „Die tanzende Törin“, wo Faistauer unter der Figur des Tonio Faustiner irgendwie repräsentiert, herangezogen werden müssen; das Buch erschien im Jahre, da der Künstler, wie nun wieder die Salzburger Ausstellung zeigt, eine Höhe seines Schaffens erreicht hatte, 1913: die Epoche wird durch die „Dame auf rotem Sofa" (dessen Glut leider etwas abgedunkelt erscheint) in der österreichischen Galerie eindrucksvoll vertreten. Wenn Faistauer in den ersten Worten seiner Ausführungen über Egon Schiele bewegt den tragischen Untergang der ganzen Familie Schiele in den Schicksalstagen des Oktober 1918 schildert, so brachte auch er dieser Zeit ein Opfer, vielleicht das bitterste seines Lebens, seine heißgeliebte erste Frau, die er nicht minder tragisch verlor. Seine Liebe und Fürsorge gehörte dann dem Vermächtnis dieser Ehe, seinem Sohne. Eine Art Verstoßung vom Elternhaus, der Tod seiner Frau, die harten Nachkriegsjahre hatten am Mark seiner Gesundheit gezehrt: „Ich habe Sie im Drängen der Abreise nicht mehr gesehen und es hat mir sehr leid getan. Ich mußte wieder spucken und hatte einen schweren Katarrh, es war ein totaler Rückfall. Ich möchte bald von Bozen weg, da es hier so staubig ist. Ich hatte schwere Tage und mich sehr geängstigt; ich habe sehr an Einsamkeit gelitten. Ein derber Hausknecht war in den ersten schweren Tagen mein Pfleger. Nun bin ich um Besuche sehr froh, es kommen zwei freundliche Mädchen, die mir die Kissen richten werden“, schreibt er mir am 16. November 1924 aus Bozen. Es folgen weitere Briefe, mit Klagen über Einsamkeit, mit Schilderungen von schweren seelischen Leiden. „Was meinen Sie? Nach uns die Sintflut? Oder wird Gott den babylonischen Bau hemmen? Hebbel schreibt irgendwo, Gott und der Teufel scheinen sich um die Welt zu streiten. Man weiß oft nicht, wer gerade Herr ist.“ (Gardone, am 17. Jänner 1925.)
Solche Töne muß man hören, noch aus dem Grabe heraus, um nicht nur den Menschen, sondern auch den Maler Faistauer richtig zu werten. Ein Bild, das diese Seiten nicht kennt, wird und muß an der Oberfläche haftenbleiben müssen. Man kann Faistauer nicht so ohne weiteres auf eine leicht zu umzirkelnde Formel bringen, „er rpalte nur, was er mit Auge und Herz erlebte, er erfüllte nur das sinnlich Erfaßte mit einer besonderen Gefühlsnote“ (Tietze). Man kann ihn nicht so obenhin zum Fortsetzer einer mehr gefühlsmäßig konzipierten als klar faßbaren „Barocktradition“ machen. Zwischen Faistauer und einer solchen steht die französische Kunst des 19. Jahrhunderts, es ist die Linie von Cezanne zu Monet, auf die sich Tonio Faustiner in der „Tanzenden Törin" prononciert beruft.
Die eben angezogenen Briefstellen fallen in die Zeit zwischen den Morzger Fresken und dem Werke am Festspielhaus. Vor den in unverblaßter Frische vorliegenden Originalwerken aber wollen wir uns des Wortes und Grübelns entschlagen und uns in die Schöpfung eines von Gott begnadeten Künstlers, des Malers, versenken. Nach all den seelischen Wirrnissen, nach dem Ringen mit Einsamkeit, Finsternis und nach dem Kampf mit dem aus dem Hintergrund drohenden Tod tritt die Seele vors Licht und vor die unerschöpfliche Welt der Farbe! Auf kleinstem Raume wechselt, oft frappierend unmittelbar, kühler Ton, kalte Farbe mit wärmendem Kolorit, die Lokalfarbe gleitet berückend hinüber in den Abglanz von Schimmer, Reflex, Glanz und Transparenz. Die schwarze Robe der Dame funkelt und sprüht wie das Gefieder eines Vogels im Sonnenglanz, und über das Weiß eines Hemdes gleitet Kreideton, spielen goldgelber Hauch und bläulich irisierende Schatten. Und dies alles schließt sich zu großartiger feierlicher Repräsentanz zusammen. Im Mai sahen wir in der Gedächtnisausstellung der Akademie in Wien den „Abgehäuteten Hammel“ eines bekannten Malers der Gegenwart. Das Bild läßt einen „Erdenrest, zu tragen peinlich“ fühlbar werden, wenn wir vor dem eben ans Licht gezogenen „Stilleben mit Fischen" Faistauers stehen. Wie meisterhaft sind die schleimigen, eben dem Moosgrund entzogenen Tierkadaver der kultivierten Atmosphäre einer gepflegten Wohnstube eingeordnet, ahne auch nur irgend etwas von ihrer stofflichen Wirklichkeit einzubüßen. Alles ist selbstverständlich, nichts erscheint „gemacht-artistisch", denn Faistauer bleibt nirgends „haften“, er verzichtet auf „Stimmung“ und „kombiniert" nicht Auseinanderliegendes um des „Effekts“ willen. Exakt und wohlausgewogen, klar umschrieben und in bestimmter Faßbarkeit —das sollte einmal neben dem Lob seiner Farbentechnik beachtet werden — treten uns die Kompositionen des Aufbaues seiner Bilder kleineren und mittleren Formats entgegen. Eben dadurch wird der Betrachter mit zwingender Gewalt auf das Wesentliche geführt, was ein Maler zu geben vermag, auf die Farbe. Faistauer ist Maler, sein Element ist die Farbe, in seiner Menschendarstellung tritt das „Porträthafte", materiell wie geistig sublimiert, zurück; er liebt und sucht vorerst die Vielfältigkeit der augenfälligen Dinge, Farbe und Ton, Glanz und Brodern („Pinzgauer Landschaft“). Das geht soweit, daß beim Versenken in seine Werke sich oft Assoziationen von konkret sinnlich faßbarem Aroma einstellen, wie sich bekanntlich oft beim Anhören bestimmter Musik Farbenempfindungen einstellen. „Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste.“
Faistauer hat mit den Mächten der Finsternis gerungen, er ahnt letzten Endes instinktiv, daß ihn ein vorzeitiges Abgleiten in die freudenlose Finsternis unabwendbar erwartet. Daraus erklärt sich auch das oft explosiv Erscheinende in seinen Farbkompositionen; denn er liebt diese ganze, durchs Auge am unmittelbarsten faßbare sinnliche Welt mit Leidenschaftlichkeit, als Künstler fühlt er sich verpflichtet, scheinbar schwankende Erscheinung durch dauernd bestehende Formung zu befestigen. Er bejaht die sinnlich faßbare Welt mit leidenschaftlichem Bewußtsein: „Der Expressionismus ist Weltuntreue und deshalb verdammenswert.“ Er verzweifelt am Weltwillen, soweit ist er auch „schwächlich“, bekennt er in seinem Buche. Die Welt ist ihm ein „Kosmos“ im wahrsten Sinne, ein Symbol von höheren Wesenseinheiten, die auszudrücken das Wort nicht mehr ausreicht, die nur das Auge sieht und durch deren Übermittlung der begnadete Künstler die Seele durch das Auge in unsagbarer Weise zu beglücken imstande ist. Wo Faistauer dieser Mission treu bleibt, erweist er sich als Psychagoge, dessen Bann man sich nicht mehr entwinden kann. Daher läßt er sich nur mit einem gewissen inneren Widerstand, dessen er nie ganz Herr wird, „Aufgaben stellen“; stört man sein Konzept, so vollendet sich Faistauer nicht mehr. Es ist zu bedauern, daß er, da und don durch äußere Widerstände ge-
zwungen, mitunter auch durch störende Reflexion abgelenkt, die Fresken des Festspielhauses, deren Erhaltung wir Susat nicht genug danken können, nicht mehr durchaus in der ersten, unmittelbaren Kozeption, die oft, schon auf der Mauer fertig, überarbeitet wurden, festzuhalten vermochte.
Unsere Liebe gehört vor allem den aus einem Gusse konzipierten und verwirklichten Morzger Fresken. Zu welcher Höhe Faistauer noch berufen gewesen, ersehen wir mit Trauer aus Landschaftsbildern, wie „Ajaccio" (1926), dann aus dem „Blick über ein Dach auf eine Stadt hin" (Wien?), wo sich die Farbe wie hinter einer opalisierenden Glasscheibe scheinbar geruhsam, in Wirklichkeit aber unergründlich schwebend ausweitet und schließlich das durch Komposition und meisterhaft gebändigtes Kolorit vorbildliche „Venedig, Santa Maria della Salute". Von seinen Stilleben wird man, zumal wenn man die große Fülle ihrer bunten Schar einigermaßen gedächtnismäßig bereit hat, zeitlebens nicht mehr loskommen. Epigonen vermögen in ihr verhaltenes Feuer, in ihren sinnbetörenden Glanz, in die Straffheit ihrer Kompositionen ebensowenig einzudringen, wie es den „Lyrikern unserer Nachkriegstage“ gelingen mag, einen Rainer Maria Rilke glaubhaft zu machen. Zu den Hauptthemen seines künstlerischen Schaffens gehört in unablässiger Variation das „Weib“, das unter seinen formenden Händen immer wieder zur Dame wird, selbst im kleinen Pinzgauer Bauernmädchen oder in der „Eva", die in gesunder Natürlichkeit ihren Apfel anbietet. In diesen Sujets tritt seine Neigung zum Repräsentativen, die — bewußt oder unbewußt bleibe dahingestellt — auf den porträthaften Einzelzug verzichtet, am sinnfälligsten vor Augen; auf diesem Felde kann man ihm weder die Franzosen noch Schiele oder Kolig oder andere irgendwie zur Seite stellen. In der Umgebung, im Kostüm, im Akt, im ganzen Air breitet er hier, unerschöpflich, sich niemals wiederholend, immer neue Überraschungen aus, die Worte der Formulierung von vorneherein erübrigen. Man spürt und fühlt, der Künstler arbeitet „instinktiv“ und formt „sinnlich“ und man weiß doch, daß er sich dessen, was er gibt, viel „bewußter" ist, als es der Konzipierende meist auch nur zu ahnen vermag. Das verleiht diesen scheinbar so klar-sinnfälligen Schöpfungen, die sich vorerst aus dem Schauen, fürs Sehen geschaffen, darbieten, ein gewisses Rätsel, zu dessen letzten Hintergründen vorzudringen schwer ist. Irgendwie steht ein Wissen um Leid und
Tod und daneben ein stolzes „Trotzdem" dahinter.
Man behängt heute in leicht geprägter Formel Salzburg mit einer billigen Etikette „Barock“. Es mag sein, daß sich diese Epoche heute am Antlitz dieser Stadt am sichtbarsten und am mühelosesten faßbar ausprägt. Die große Zeit unserer Heimat hier lag aber damals bereits im wesenlosen Scheine versunken, sie war das Hochmittelalter, die Zeit des Investiturstreites. Der heute vielgefeierte Schöpfer des „barocken Salzburg“, Wolf Dietrich, hat der großen Vergangenheit dieser Stadt bewußt, mit brutaler Hand und gründlich den Garaus gemacht. Auch Tietze operiert mit dem „barocken Element“ in Faistauers Wesen allzu leicht; es soll nicht ganz geleugnet werden. Die kleine, oft zutiefst ergriffene Schar, welche sich in der Faistauer-Gedächtnisausstellung immer wieder zusammenfand, trug das traurige Gefühl mit sich heim, wiederum einmal aus einem Stück Heimat, wie sie war, geschieden zu sein. Über Ziegelbrocken, einsturzdrohenden Ruinen, Holzplanken und Undefinierbarem, Schutthaufen, auf denen Kehricht lagert, Pfühle von sich mästenden Ratten, steigt man traurig der Höhe zu, welche die Festung, den Bau aus der wirklichen Glanzzeit der Stadt, trägt. Diese Umgebung diente einmal, als noch alles in „Esse et Floribus stand“, wie ein alter Chronist sagt, als Hintergrund einer Szenerie im „Faust“ des Festspielhauses. Es scheint, wir haben wieder einmal etwas, nicht ganz ohne eigene Schuld, von unserem Lebensgut verspielt, unersetzliches Saatgut vermahlen.