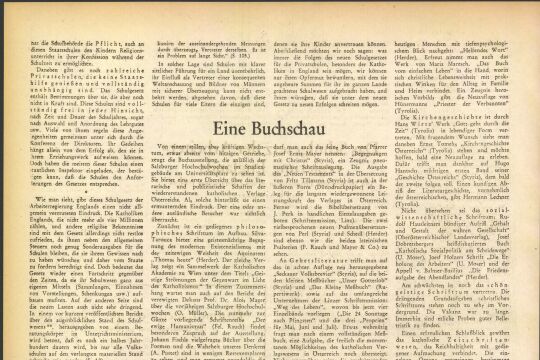Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Arbeitstage modernen Theaters
Erstmals verändert zeigte sich das Publikum. War es bei den Aufführungen des Theaterwettbewerbs im Mai noch aufgeregt gewesen, störend und aktiv teilnehmend, so blieb es jetzt, bei vereinzelten „Buhs“, im ganzen sehr ruhig, sehr gemäßigt, sehr festlich. Auch in der Kleidung. Manche Abende wurden nahezu zur Gala: Dallapiccolas „Odysseus“ in der Oper, Macbeth zum Abschluß der Festwochen, die Gastspiele der amerikanischen Tänzer und der Comedie Frangaise. Manchmal blieb das Publikum auch fern: beim italienischen Gastspiel etwa, bei den holländischen Tänzern, bei Brittens Kirchenopern. Und sehr friedlich, sehr zurückhaltend ertrug es auch Gattis Revolutionsstück „La Naissance“. Gerade deshalb aber stellt sich die Frage, wie diese schnelle Wandlung zu verstehen ist. Was ist los mit unserer Gegenwart? War die Agitation nur ein Spuk? Die Ruhe des herbstlichen Saisonauftaktes nur ein Atemholen? Wird die Kultur als irrelevant nun auch von den jungen Revolutionären ignoriert?
Ähnliche Fragen schienen auch Karajan zu bewegen, als er seine Stiftung vorstellte. Den Zusammenhang zwischen Publikum und Musik in unserer Gegenwart zu erforschen und zu vertiefen, soll ihre Hauptaufgabe sein. Und deshalb sollte ein Bericht über die Berliner Festwochen mit den beiden Berliner Kindertheatern beginnen: wenn sie die Brücke nicht schlagen zu der kommenden Generation, iVd man niefit’ mehr allzUlangT W TheaterW ferB? nen. Das Reichskabarett brachte für die Kleinsten „Die Reise nach Pitschepatsch“: ein quirliges Spiel mit einer Fülle von Stationen, die jeweils ein kindliches Problem (die Meckertante, die Bonbonsucht, den Polizisten) rational und theatralisch zu klären versuchten. Mitreißend wiederum die Regie von Siegrid Hackenberg, von entscheidender Qualität die Musik von Horst A. Haß. Ein guter Anfang also. Nicht ganz so glücklich waren diesmal die Berliner Kammerspiele. Der russische Autor Michalkow verbirgt sein Stück „Lachen und Weinen“ (nach Gozzi) hinter allzuviel Verschachtelungen, so daß es der Regisseur Jürgen von Alten sehr schwer hatte, die Aufführung dennoch zu starker emotionaler Wirkung zu bringen. Mitreißend dann der englische Beitrag. Präzise und temperamentvoll brachte das National Youth Theatre „Zigger-Zagger“; der Heranwach sende zwischen dem (falschen) Abenteuer des Fußballplatzes und der Langeweile der Arbeitswelt. Das amüsante Stück schließt tief pessimistisch und hinterläßt gerade deshalb einen starken Eindruck. Für die jungen Besucher war also gesorgt — was aber blieb für das „normale“ Publikum?
Fragen dieser Art hatten die Festwochen. der j letzten Jahre kaupa provoziert. Sie behandelten ein Thema, sammelten Material (Aufführungen und Ausstellungen) zu Afrika oder zu Japan, zum Barock oder zu Osteuropa. Da konnte man als Besucher eine angenehme Rolle spielen, fühlte sich ein in eine fremde Welt, ließ sich wohlig reizen, lernte und nahm auf, entwickelte Sensibilität für Fremdes, Ungewohntes. Niemals aber brauchte man das Gefühl zu haben, selbst gemeint zu sein.
Jetzt aber: das war doch die normale Welt — in diesen Stücken sollte man zu Hause sein; zumindest aber: von da kam man her (wie in den Kunstausstellungen, die zumeist das 19. Jahrhundert beschworen).
Bei diesem Thema dann aber Ruhe, passives Aufnehmen, stiller, festlicher Genuß (auch wenn man, zum erstenmal, ohne eine feierliche Eröffnung begann!). Ein Phänomen, das zunächst einmal nur konstatiert werden kann. Sicherlich, es gab auch in diesem Jahr die Gastspiele. Vielfach brachten sie umjubelte Höhe- punkte. Die Comedie Frangaise kam mit zwei Stücken von Moliere: ein reines Vergnügen, durch einen beängstigend intensiven Darsteller (Robert Hirsch als Sosias) in die Nähe einer zerrissenen Gegenwart gespielt. — Auch Italien brachte einen Nationalautor: Beolco genannt
Ruzante. Die Truppe aus Bologna setzt zwei Stücke und zwei Vorreden dieses frühen Hans Jjijchs z.u,Kejngni( Theaterabend zusammen;, man läßt’ ‘die AtrfÖihrig ämifef eines Prata-J ten stattfinden und kann so beide Welten gleichzeitig sichtbar machen: den Luxus des Hofes, die schmierige Verderbnis des im Krieg zerrissenen Volkes. Intensive Schauspieler auch hier: Franco Parenti in der Ruzante- Rolle, Milva als seine Gegenspielerin. — Schließlich ein neues Stück von Armand Gatti, von einer französischen Truppe gespielt: zu wirr in der Anlage (obwohl ich froh war, daß das Thema der Revolution hier nicht in primitiver Schwarzweißdialektik abgehandelt wurde), zu realistisch zudem gespielt, in Nebensächlichkeiten erstickt, zu bieder, um noch theatralisch wirken zu können. Nennen wir noch das Nederlands Dans Theater (seine Primärqualität das genaue Hinhorchen auf die Musik) und das Alwin Nikolais Dance Theatre aus den USA (anregend im Mittanzen von Kostüm und Requisit).
Da gab es einen jungen öster- reichischen Autor (Hans Krendles- berger: Die Frage), der nach allgemeinem Verriß so schnell wieder abgesetzt wurde, daß ich sein Stück nicht einmal mehr sehen konnte; einen jungen Franzosen (Dabadie: Die scharlachrote Familie), der unter Regie von Helmut Käutner zu einem gewissen Erfolg kam. Großartige Schauspieler errangen einen Triumph für den Engländer Charles Dyer „Unter der Treppe“ (Leonard Steckei und Will Quadflieg in der Regie von Harry Meyen). Ähnlich begeisternd spielten Lieselotte Rau und Horst Bollmann unter Barlog im Schloßparktheater. „Ein Tag im Sterben von Joe Egg“ heißt das Stück des Engländers Peter Nichols. Meist wurde es als ein Beitrag zum Euthanasieproblem angesehen: ein Ehepaar quält sich und andere mit einem spastisch-.gelähmten Kind; es kommt schließlich zu einem Mordversuch des Vaters an seiner kranken Tochter; das Kind wird gerettet; der Vater aber verläßt das Haus, verläßt seine Frau.
‘ Ähnlich offferi’ arbeitet’ audi’ttef’ Amerikaner Heiler in seinem . Fliegerstück „Wir bombardieren Regensburg“. Aber außer einem guten Ausgangspunkt hat der Autor nicht mehr viel zu bieten; sein Stück ist geistig so unbedarft, daß man spätestens nach der Pause jeden Zug vorausweiß und sich schließlich sehr darüber ärgern muß, daß dem Autor augenscheinlich nur eines am Krieg mißfällt: daß man selbst darin getötet wird. Viel formaler Aufwand für ein schmales Ergebnis.
Da ist Gerlind Reinshagen bescheidener. Ihr „Doppelkopf“ wurde von der Werkstatt nachgespielt. Ein holzschnitthaft grobes Stück, das mich zunächst durch sein Thema ansprach: der Mensch in der Arbeitswelt, genauer gesagt: die Belegschaft einer Maschinenfabrik auf dem Betriebsfest. Besonders gut wird die Autorin, wenn sie ihre Form noch weiter versimpelt und nun eine Laienspielgruppe auf die Bühne schickt: die Arbeiter spielen die Geschichte ihres Werkes. Damit kommt in der Rekapitulation nicht nur die historische Dimension in das Stück, sondern für Augenblicke auch die Vision einer anderen Zukunft, die vertan wurde, weil der Aufbau der Stunde Null überholte Strukturen rekonstruierte.
Auch Peter Handkes „Kaspar" wurde in Berlin nur nachgespielt (Forum-Theater). Trotzdem scheint mir dieses Stück das zentrale Ereignis der Festwochen zu sein. Handke ist einen gewaltigen Schritt weitergekommen. Zeigte er bisher nur eine erstaunliche sprachliche Reife, ließ er Sprache materialverliebt wachsen, so hat er diesmal sehr zuchtvoll Sprache benutzt, um etwas mitzuteilen und zu gestalten.
Leider wurde Handke von seinem Regisseur nicht gut bedient. Günther Büch lieferte eine bestechende Inszenierung, die nur über das Stück rücksichtslos hinweggeht; er klebt an Äußerlichkeiten, macht minutenlang den Text (schon rein akustisch) unverständlich und verschmiert den Sinn des Stückes mit Spielastik und Trallalatheater.
Zwei Ereignisse brachte die Musikbühne. Auch hier wurde deutlich die Frage nach dem Publikum gestellt. Dallapiccolas „Odysseus“, der von der Deutschen Oper uraufgeführt wurde — die „Furche“ hat darüber bereits berichtet —, ist ein reifes Werk, in seinen symmetrischen Entsprechungen bis ins feinste durchkalkuliert und zugleich inspiriert. Noch deutlicher wurde die Diskrepanz zu unserer Zeit in Brittens Kirchenopern, die als Gastspiel von der English Opera Group gegeben wurden. Auch hier eine meisterhafte Musik, ein strenger szenischer Stil, ein Inhalt mit zeitloser Gültigkeit. Aber der Chor der Mönche, der da mit gregorianischem Gesang in die Kirche einzog, bestand aus Opernsängern; der Aufruf des Priesters kam von einem Künstler; die Festwochengäste waren leicht geniert; die Gemeindemitglieder nicht minder. Kunst ohne soziologischen Ort. Brittens Kirchenopern könnten ihren Ort finden, wenn sich eine Kongregation zusammenfände, um sie aufzuführen; wenn sie als Gottesdienst gefeiert und nicht als Oper realisiert wurden. Sö wär W reizvd», ‘ natfi- denkenswert-echt war es nicht, öida Resümieren wir die Berliner Aufführungen: zu zwölf Stücken aus den letzten Jahren kamen sechs weitere aus dem 20. Jahrhundert (Ghelderode, Shaw, Brecht, Sartre) und nur zwei ältere: Macbeth und ein weiterer Engländer: Vanbrugh, trotz seines Alters ein unbekannter Autor (Der Rückfall, 1696). Nicht durchweg Meisterwerke, sondern hartes Mühen um die Gegenwart. Also nicht eigentlich Festwochen, sondern Arbeitstage modernen Theaters: ganz ähnlich wie bei der Musik. Auch dort gab es zwar die festlichen Ereignisse: Bernstein und die New Yorker, Karajan mit Brahms und den Berliner Philharmonikern; einmal eher die große Weihe des Festes, zum anderen Showbeigeschmack; entscheidend aber war auch dort die Fülle der Erst- und Uraufführungen bis hin zu den Sondertagen der elektronischen Musik: Arbeit an der Gegenwart.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!