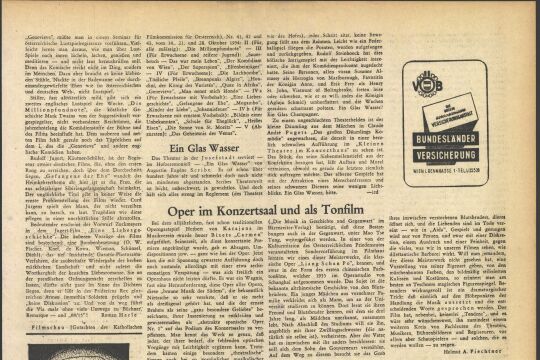Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Begegnung der Nationen
Die größte Attraktion des Hol- landfestivals ist Holland selber: mit der weltoffenen Freundlichkeit seiner Bewohner, dem Eigensinn der Städte, dem fast unglaublichen Bilderreichtum. Ist auch das Fest nach neunzehn Jahren noch attraktiv? Die Abnutzungserscheinungen vieler europäischer Festivitäten sind gelegentlich auch hier spürbar, aber Einsicht und Selbstkritik bewirken immer wieder eine Art von Regeneration. Weniger den Touristen gilt es mit immer neuen Reizen anzulocken: das aufmerksamste, dankbarste Publikum kommt aus dem Lande selber. Dort, wo man dem kulinarischen Bedürfnis der Fremden folgt — in der Oper —, ist die Qualität zumindest uneinheitlich. Das Konzept indes bewährt sich immer wieder: vorzuzeigen, was typisch ist, voller Eigenart und national geprägt. Der polyphone Klang hat unverwechselbares Fluidum.
Man hat Sinn für das Abseitige. Junge Polen kamen aus Wroclaw, dem früheren Breslau: Sie nannten sich Polnisches Theaterlaboratorium „13 Reihen“ und brachten eine Studioaufführung des „Standhaften Prinzen" von Calderön mit. Der polnischen Sprache nicht mächtig, wäre ich ohne Programm auf alles Mögliche verfallen, kaum auf Calderön. Mit rasendem Sprechtempo wurden nur Stationen des gefangenen Prinzen vorgeführt, eigentlich nur seine Geißelung, sein Todeskampf, seine Todeszuckungen, die Erlösung im Tode. Alle Mitspieler — seine Widersacher — schienen von seinen Reaktionen beherrscht. Seine Schmerzensschreie formten sich zur Tanzmelodie. Das Theater Artauds, ein Theater der Grausamkeit, der Schreie, hat wieder einmal späte Nachfahren gefunden. Jerzy Gro- towskis Theaterlaboratorium arbeitet körperbetont. Yoga spielt eine große Rolle. Wenn nichts mehr konkret sei, die Philosophie keine Handhabe mehr biete — sagt Grotowski —, sei es notwendig, diese Konkretheit über das Körperliche zu gewinnen. Der Spieler des Prinzen war am Ende wie in Trance: Aber er fühle sich frisch, gab er Auskunft, während er zuvor sehr müde gewesen sei. Die jungen Peilen glauben nicht an die Religion, aber sie glauben an eine christliche Kunst: Das bleibt unklar, trotz intensiver Befragung. Diese Unklarheit entspricht der Situation eines Landes, das katholisch und zugleich kommunistisch ist.
Im äußersten Gegensatz dazu stand ein sehr englisches Werk von Benjamin Britten, verdichtet zur ästhetischen und religiösen Essenz. Britten verwendete im Anschluß an seine Erstlingsoper „Peter Grimes“ fast nur noch Kammerbesetzungen: in „Der Raub der Lukretia“, in „Albert Herring“, in „The Tum of the Serew“. Vor zwei Jahren schrieb er seine erste Parabel zur Aufführung in einer Kirche: „Curlew River“, nach einem japanischen No-Spiel. Im gleichen Geist, neu1 alttestamentarisch grundiert, ist „The Burning Fiery Furnace“ gehalten, uraufge- führt in Aldeburgh und jetzt einer der künstlerischen Höhepunkte des Hollandfestivals. Die Geschichte von den drei Männern im Feuerofen wird von Mönchen gespielt, die zu Beginn und am Ende — in einer Prozession durch das Kirchenschiff ziehend — einen ergreifenden gregorianischen Gesang anstimmen. Acht Instrumentalisten begleiten das Geschehen mit feinfädigem, exotisie- rendem Klang. Zweifellos bezieht das gut einstündige Stück seine Wirkung aus einer gewissen Decadence, einer Überfeinerung, die aber durch den Kunstgeschmack Brittens in Grenzen gehalten wird. Vor allem die „robing-music“ zu der Kostümie rung der Mönche, der polyrhythmi- sierte Marsch, mit dem die Instru- mentalisten eine Prozession der Höflinge anführen, und die babylonische Hymne, mit der das Götzenbild verehrt wird, sind — ungeachtet einer leicht kunstgewerblichen Finesse — Eingebungen von hohem Rang. Die Aufführung durch die English Opera Group, musikalisch von Britten selber einstudiert, war makellos. Sie wird verbindliches Muster bleiben. Die Stilisierung der Szene erinnerte an die Choreuten- Praxis des griechischen Theaters: Kulturen begegneten einander.
Natürlich stand auch die große Oper auf dem Programm. Verdis „Don Carlos“, szenisch von Georg Reinhardt und Heinrich Wendel dem Düsseldorfer Modell nachgebildet, musikalisch von Bernard Haitink geleitet, und Bellinis „I Capuleti e i Montecchi“, halb eine Scala-Produktion mit dem vielbewunderten Claudio Abbado am Pult, waren gewiß als Höhepunkte ausersehen. Doch bei so komplexen Unternehmen gelangt Ambition nur selten zur restlosen Erfüllung, und die Erinnerung sondiert unerbittlich: das groß Gewollte blieb — aufs Ganze gesehen — Mittelmaß. Reinhardt (als Regisseur) und Wendel (als Bühnenbildner) präsentierten — auf einer diagonal gestellten Schräge in Kreuzform — sehr bewußt und durchdacht arrangiertes Musiktheater deutscher Prägung mit leicht manieristischen Zügen (eindrucksvoll wie kaum je zuvor: das Autodafė), Der niederländische Dirigent Bernard Haitink, offenbar erfahrungsarm im Umgang mit der italienischen Oper, wenn nicht der Oper überhaupt, legte eine im unguten Sinn deutsche Auffassung zugrunde: Er schien Verdi mit Wagner zu verwechseln, aber mit einem Wagner, wie man ihn heute nicht mehr hören möchte. Ein Nicola Ghiuselev als König Philipp, eine Grė van Swol- Brouwenstijn als Elisabeth, eine Mimi Aarden als Prinzessin Eboli erreichten Weltformat. — Die Oper von Bellini, ein Jahr vor der „Sonnambula“ entstanden, ist ein Werk mit schönen, lyrischen Zügen, mehr eine Häufung von Stimmungsbildern als ein Drama, wie man es von dem „Romeo- und-Julia“-Stoff erwartet hätte. Abbado dirigierte umsichtig und feinfühlig, erreichte aber nicht jenes persönliche Format, das bei anderen Gelegenheiten kommenden Weltrang ahnen ließ. Szenisch herrschte die Attitüde italienischen Stadttheaters mit unfreiwilligen Parodien, an gesanglichen Höhepunkten mangelte es. Doch die Italianitä erntete unbeschreiblichen Jubel: Am Bedürfnis der Menge nach sinnenhaf- tem Operngenuß ist nicht zu zweifeln.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!