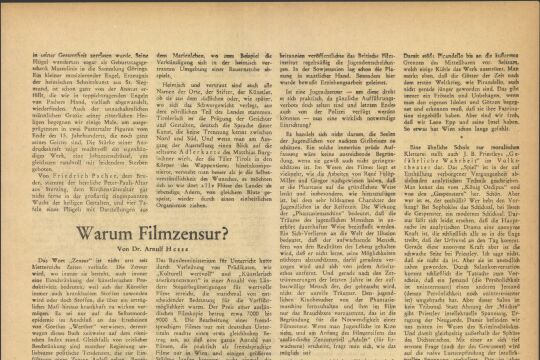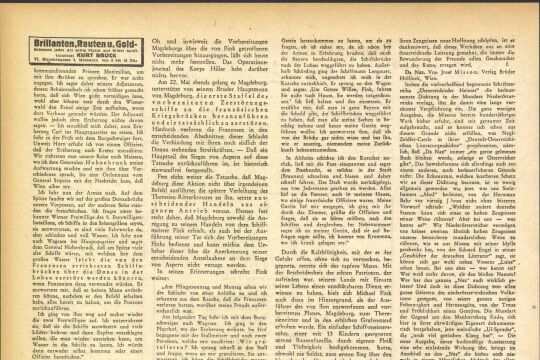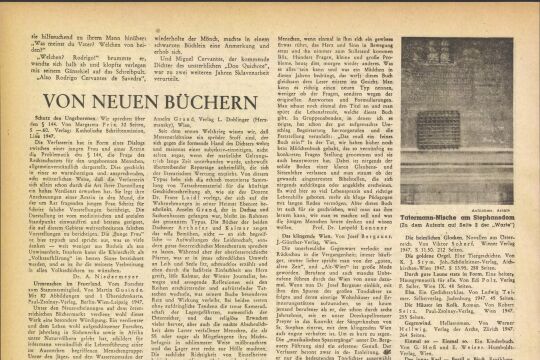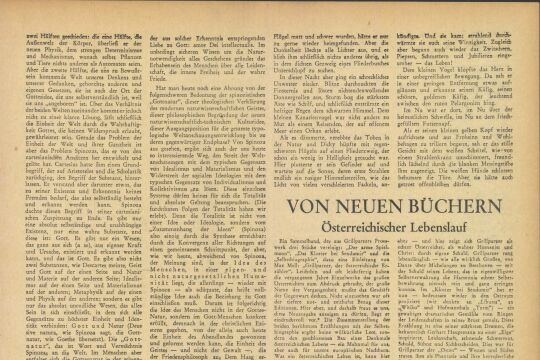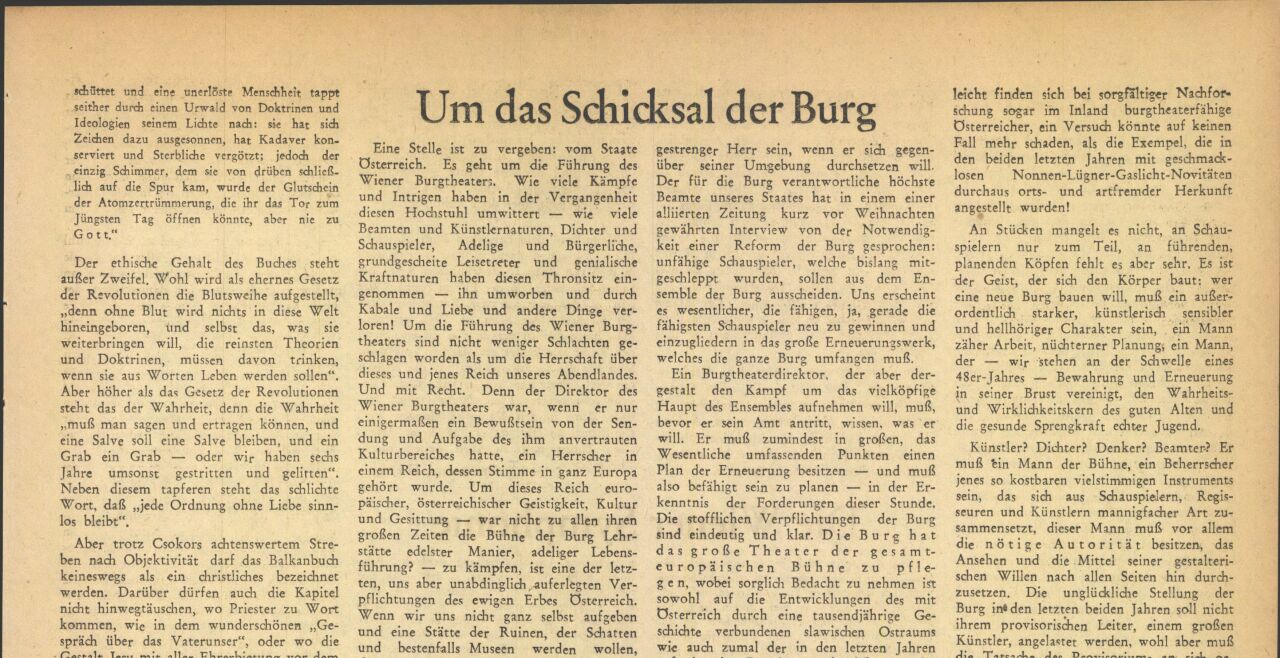
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Besonnte Vergangenheit
Glückliche Reprisen — dies der vorherrschende Eindruck des Wiener Theaterhimmels um die Jahreswende: es leuchten keine neuen Sterne, wohl aber springen alte Stücke auf die Bühne und offenbaren sich in überraschend frischem Glanze. Die Renaissance-Bühne bringt ein Jugendwerk Bernard Shaws, „Der Teufelsschüle r“, ein Stück, das zum Vergnügen des Publikums und wohl auch des greisen Meisters der Masken selbst ihn als unverwüstlichen Romantiker, Optimisten und Weltverbesserer entlarvt. Da, seht nur: dieses scheinbar mißratene Enfant terrible der Literaturgeschichte, nein, Christoph Dudgeon, der Außenseitersohn einer puritanischen Familie in der kleinen nordamerikanischen Stadt Websterbridge, was ist er doch für ein Kerl! Läßt sich, so ganz ohne Phrasen und besondere gute oder schlechte Meinung für den Herrn Pastor, der mit knapper Not zu den Aufständischen entrinnen kann, von den englischen Truppen aufknüpfen. Zeit seines Lebens hat er weder die Schule seiner Familie, seiner Gesellschaft, seines Pastors und seines Gottes sehr geliebt und augenscheinlich auch ohne besonderen Erfolg absolviert. Nun aber legt er wider alle papiernen, ledernen und zungenfertigen Zeugnisse seiner Mitmenschen das einzige Zeugnis ab, das zu allen Zeiten alle anderen schlägt: er ist bereit, für einen Mitmenschen zu sterben — und für die „Freiheit". Für die Freiheit, zu tun und zu lassen, was ihm beliebt, ein Querkopf Gottes, der Herz und Sinn merkwürdig sicher am rechten Fleck hat. Und die großen Kinder sehen und hören es gerne: Robinson soll nicht sterben. Nach amüsanten Wortgefechten mit dem englischen General Burgoyne vor dem Todestribunal des Kriegsgerichtes (was ist aus diesen Gerichten in der Wirklichkeit geworden, seit Shaw sie in ihrer tödlich treffenden Armseligkeit sah und bekannte!) wird unser Teufelsschüler und Menschenfreund auf- und abgehängt und kommt gerade noch zurecht, diese unheitere Begebenheit mit einem Festmahl abzuschließen. Speise des Menschlichen — dies ist das Signum der besten Werke Shaws. So wird er in die Geschichte eingehen. Dieser sehr wache Kopf ist ein nimmermüder Kämpfer wider die Würgschlingen geistiger, gesellschaftlicher und politischer Systeme, welche den nicht schuld- aber ahnungslosen Menschen des letzten halben Jahrhunderts von allen Seiten her einzufangen streben, bis er, Trophäe der neuen Zeit, am Galgen des „Absoluten“ und der Absolutismen baumelt. Der Kampf wider diese Schlingen fordert nicht nur die Gewandtheit des Dichters heraus, seine Fähig keit, Scherz, Ernst, Ironie und tiefere Bedeutung schlagfertig zu mischen, sondern auch -die des Schauspielers. Der Ambiguität und Reichweite eines Könners, wie Ernst Deutsch, blieb es Vorbehalten, das strukturell einfach gebaute Stück bis zum glücklichen Ende durchzufechten.
Das alte „Konzert" Hermann B a h r s wird also in der Josefstadt wieder gespielt. Das ist schon seltsam. Wie ferne steht uns die stoffliche Problematik dieses Stückes aus der Zeit der Gartenlaube und des Münchner „Jugend“-Stils (der im Bühnenornament leise anklingt), als aus Klavierstunden noch gesellschaftliche Tragödien, zumindest Tragikomödien wachsen konnten, als die Vorläufer unserer Filmstars, Geiger, Sänger und immer wieder Klaviervirtuosen, die Salonlöwen einer theatralisch versponnenen, romanlesenden und romantisierenden Plüschwelt waren: Paganini, Liszt, Wagner — mit' Nietzsche und Wedekind klingt die musikalische Soiree eines Jahrhunderte aus, physisch und metaphysisch krankes Überbrettl. So uninteressant sind für uns die Amouren des Pianisten Gustav Heink, die Lügen- und Sentimentanfälle seiner hysterischen Verehrerinnen, Delfine, das naive Gänschen die Löwinger Waldbauernkomik des Ehepaars Pollinger. Was für eine kostbare, herzerfrischende Aufführung hat aber die Josefstadt zustande gebracht! Vilma Degischer als Frau Marie und Karl Paryla als Doktor Franz Jura bezeugen einen Triumph gesunder Eh’leutlogik, weihe dieses Stück zu einem vorbildlichen Spectaculum gerade für das Wiener Publikum werden läßt... Wie da zwei Ehen, weihe durh die Dummheit und Fahrlässigkeit zweier Partner (Rudolf Forster als Heink und Hortense Raky als Delfine) in die Brüche zu gehen drohen, durch die Herzenklugheit der beiden unbelasteten Teile auf höchstergötzliche Weise reparieret und in die Seligkeit eines Ur- standes restaurieret werden, verfolgt das sehr beteiligte Publikum von Anfang bis zu Ende mit sichtlich — berechtigtem Interesse.
Kann shon dem Konzert Hermann Bahrs die typish wienerische Note nicht abgesprochen, so sollte die österreichische Note bei dem Grillparzer-Stück des Volkstheaters nicht, wie es geshehen ist, verkannt werden. „Der Herr H o f r a t“ Piero Rismondos hieß im Originaltitel „Grillparzer" und trug den Untertitel „ein österreichisches Dram a". Walter Firner, dem Bearbeiten)
erschienen anscheinend beide Titel zu anmaßend; trotzdem ist es ein Stück, das in durchaus echter und aufrichtiger Weise von seiner Liebe zu Grillparzer und Österreich Zeugnis ablegt. Es ist bemerkenswert: soviel Österreich auch beredet wird, so hat sich seit 1945 doch kein Dichter gefunden, der discs Land für würdig hielt, auch; auf der Bühne des Geistes und des Theaters neu zu erstehen. Wir wollen nicht mißverstanden werden: Wir wünschen nicht, daß alle die vielen gutösterreichischen Dichter, welche ehedem durch Hitlergedichte glänzten, nun, als Restbuße für ihre Entlastung, etwa „österreichische“ Stücke schreiben sollten. Nein, wir wollen dies wirklich nicht. Mit dem literarischen Zeugnisablegen für Österreich wollen wir es uns nicht so billig machen, wie es das Dritte Reich und seine Kunstkammer ihrerseits getan haben. Auch Rismondo, der Wiener Journalist und Kritiker, hat es sich 1936 mit dem Bekenntnis seiner Liebe zu diesem seltsamen Lande durchaus nicht leicht gemacht. Sein Grillparzer ist keine biedermännische Figur von der Art unserer österreichischen Operetten- und Film- Schuberts, -Haydns, -Mozarts usw., sondern tief verhangen in das herbe Geblüt, das schwermütige Sein jenes spätreifen Menschenbaums, an dessen hartem Rebstock die süßdunklen Früchte der Libussa reifen. Sein Österreich ist jene zwielichtige Welt verschranzter Narrheit, unweiser Klugheit „g’scheiter" Männer und lebensseliger Frauen, von weitsichtiger Altheit, kurzsichtiger ängstlicher Greisenhaftigkeit und versagender Jungenhaftigkeit, die scheinbar überschäumt und rasch, allzu rasch versiegt. Der Vergangenheit und ihrem Schatten erliegend, weil zu schwach, um die Gegenwart mit dem Geist der Zukunft zu bestehen. Reaktion? Revolution? Keines von beiden. Ein sich scheinbares Verwehren, ein scheues Sichverhaken, das den andern erst erkennen läßt, wie reich er beschenkt worden, wenn der Geber selbst nicht mehr ist. Was wissen die Völker, die Erben der Donaumonarchie, was sie von Österreich an lebendigem Erbgut erhalten haben? Was wissen die Wiener selbst von ihrem Grillparzer? Rismondo geht mit seinem Grillparzer-Stück einen Weg, der uns beachtenswert erscheint: er schminkt seinen Figuren keine Gloriolen an, sondern läßt sie selbst aussagen und in und mit ihnen das alte große Reich. Gewiß, wie viel Narrheit, Engheit, Dürftigkeit des Sinns. Aber dahinter stehen: ein stilltiefer Enthusiasmus des Herzens, eine warme bergende Kraft leidenschaftlichen Gefühls, eine große heimliche Ordnung des Geistes und der Seele, schwebend über den unruhigen Wassern der Zeitlichkeit: Österreich. F. H.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!