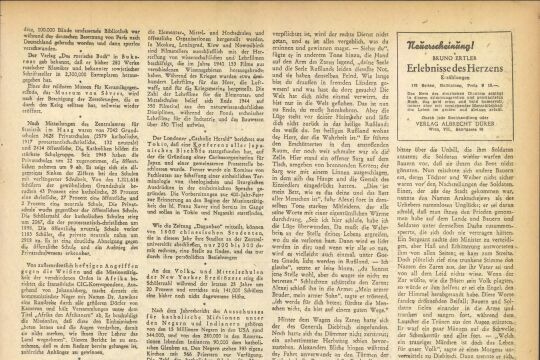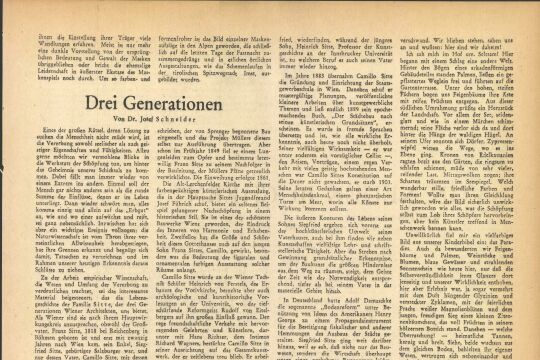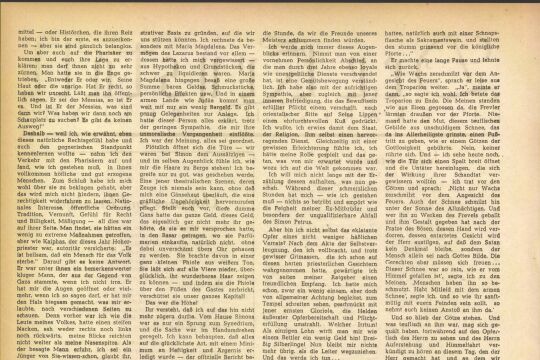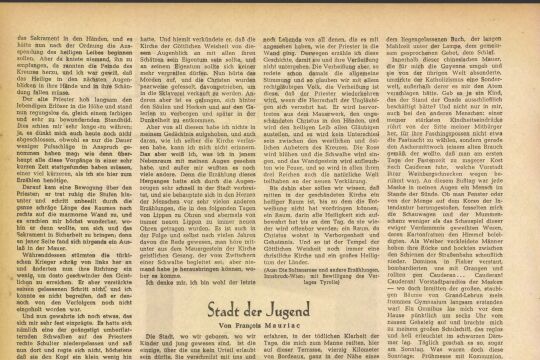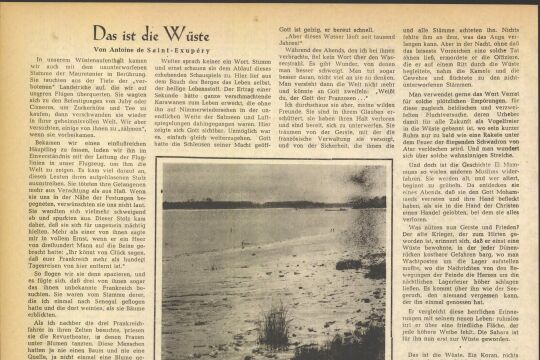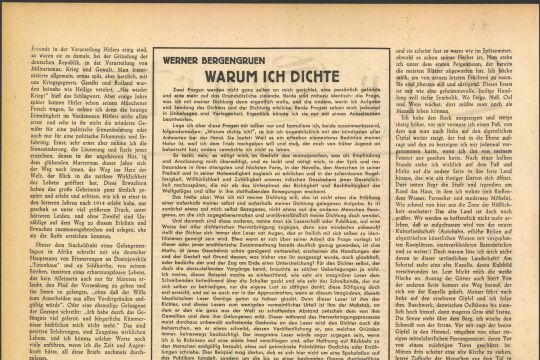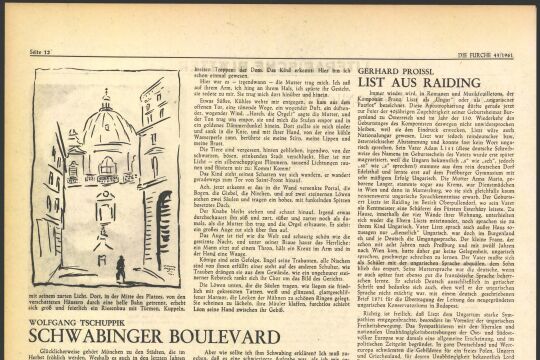Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Betrachtung in der Nacht
Ein erschütternder Bericht von der Not der Seelsorge, die ihre Wurzeln in der sozialen Not hat. Hier wird die Bedeutung der Entwicklungshilfe deutlieh.
(Die Redaktion)
Es ist Nacht in Pindare Mirim. Palmen wiegen sich wie Federbüsche gegen den Himmel. Ein schwüler Wind gleitet flüsternd durch die zerfaserten Blätter. Fern im Wald dröhnt die Trommel. Da tanzen Neger bei Zuckerrohrschnaps die Batucada. Eine nächtliche Orgie aus alter Zeit, damals Von den Pflanzern veranstaltet, um den Geschlechtstrieb der erschöpften Sklaven aufzustacheln, damit ihr menschlicher Viehtrieb nicht aussterbe. Nach Abschaffung der Sklaverei verringerte sich das Elend kaum, so daß der Rausch der Batucada in den früheren Sklavenzentren Bahia, Ricife und Sao Luiz der Trost der Armen blieb.
Ich kann nicht schlafen, rutsche aus meiner Hängematte und schaue auf zu den Sternen, die hier soviel klarer sind als am nebligen Firmament der Niederlande.
Es war ein schwerer Tag. In einem Jeep durchkreuzte ich mit dem Erzbischof von Sao Luiz und zwei deutschen Franziskanern dieses nordost-brasilianische Land aus rotem Lehm und grünen Wäldern. Eine halbe Million Flüchtlinge aus der Hölle der Seca, der sengenden Dürre, hat sich an der im Bau befindlichen Straße, die quer durch den Dschungel zur neuen Hauptstadt Brasilia führt, niedergelassen.
Die Straße ist noch nicht fertig, aber mit gutem Willen befahrbar. Unser Jeep bäumt sich auf wie ein Schiff im Orkan. Wir rumpeln eine Stunde lang im Sog einer schlingernden LKW-Kolonne, die hier nicht zu überholen ist. Es ist helllichter Tag, aber der Gegenverkehr taucht mit brennenden Scheinwerfern aus der ockerfarbenen Wolke auf, die uns wie eine Gewitterbö umhüllt. Das Gestrüpp ist rostbraun vor Staub. Dürre Hütten aus Lehm und Palmblättern kauern im Gras. Eine halbe Million Einwanderer hockt an diesem roten, langsam südwärts kriechenden Strich beisammen.
Hier baut die Ostpriesterhilfe zusammen mit Adveniat und Misereor eine neue Festung für Gott mit Kirchen, Pfarrhäusern, Katechetenschulen, Jeeps und einem Kapellenwagen, der dauernd über den schnurgeraden Weg hin- und herpendeln wird, um Gottes verlassene Herde zu besuchen.
Mühsam wird hier die Seelsorge ausgeübt von den deutschen Franziskanern, die in Bacabal ihr Kloster haben, und dem 40jährigen brasilianischen Pfarrer von Pindare Mirim, dessen Gäste wir sind. Er heißt Padre Francisco das Chagas Vasconcelles.
Er betreut vier Kirchen, 45 Kapellen und 80.000 Seelen auf einem langgestreckten Gebiet von 11.000
Quadratkilometern. Sein Pferd trägt ihn im Jahr 7000 Kilometer. In den letzten drei Wochen hat er 999 Kinder getauft und 105 Ehen eingesegnet. Seine Pfarrei ist 200 Kilometer lang. Das am weitesten entfernte Drittel kann er zu Pferd nicht erreichen. Dort war noch nie ein Priester.
Der Padre hob ungläubig die Schultern, als ich ihm (auf Eure Rechnung, liebe Freunde!) eine Kirche und einen Jeep versprach. Ich weiß nicht, ob er mehr an Euch oder an mir zweifelte. Aber der Erzbischof, der Euren Opfermut schon am eigenen Leib erfahren hat* wußte seine Kleingläubigkeit zu überwinden. Und der Pater lächelte. Jetzt schnarcht er zufrieden in seiner Hängematte neben der meinen und der des Erzbischofs unter der Veranda seines kümmerlichen Hauses.
Vorgestern hat Pater Celsus in Bacabal auch gelächelt, als ich ihn bat, mich auf Kapellenbesuch mitzunehmen. Er ist ein 43jähriger klapperdürrer deutscher Franziskaner, der mit vier Jahren Front, fünf Verwundungen, zwei Jahren Gefangenschaft und ein bißchen Theologie 1949 die Priesterweihe empfangen hat. Jetzt ist er Großraumseelsorger in zwei Pfarreien mit 250 Dörfern und insgesamt 125.000 Seelen. Er bedient zwei Kirchen und 83 Kapellen, die er wenigstens einmal im Jahr besuchen muß.
Die Reise ging durch unwegsame Gegenden. Ein Schwärm von Photographen, Marktkrämern, Kuchenbäckern, Wahrsagern und Gauklern folgte auf Eseln und Pferden. Denn die Desobrigo, der Tag, an dem ein Dorf seine Ostern hält, ist zugleich Kirmes und Jahrmarkt. Gut 2000 Menschen, von fern und nah zur Kapelle geströmt, hießen uns mit Donnerbüchsen und Gejauchze willkommen. Man brachte uns einen Petroleumkanister mit trübem Wasser in einen Bananenbusch. Wir zogen uns aus und gössen das kostbare Naß mit einer Konservenbüchse über unsere staubbraunen Köpfe. Dann verschwand Pater Celsus im Beichtstuhl. Beichtkinder von „vor drei Monaten“ ließ er nicht zu Wort kommen: die anderen hatten Vorfahrt. Es dauerte acht Stunden bis tief in die Nacht. Dann montierten wir unsere Hängematten in der Sakristei. Wir schliefen kurz und schnell. Als ich um sechs erwachte, saß der Pater schon wieder im Beichtstuhl. Bis zehn Uhr. Er zelebrierte, hielt seine jährliche Predigt und teilte mit mir die Kommunion aus. Um elf frühstückte er in der Sakristei. Dort herrschte eine glühende Hitze. Noch beim Kauen fing er an, die Taufen einzutragen. Es waren 117. Mit einer Stundengeschwindigkeit von 40 Taufen schrieb er bis fünf Minuten vor zwei. Seine Finger waren steif, und der Schweiß rann ihm in Strömen vom Gesicht. Ich konnte ihm nicht helfen, denn ich kann beim besten Willen kein portugiesisch.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!