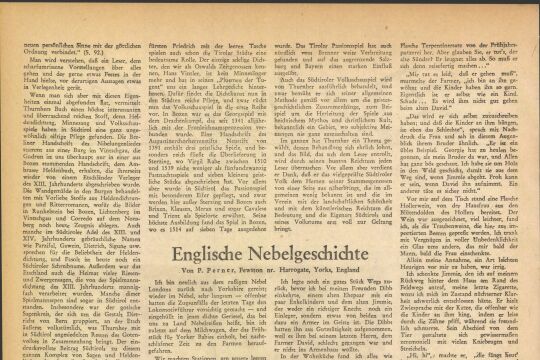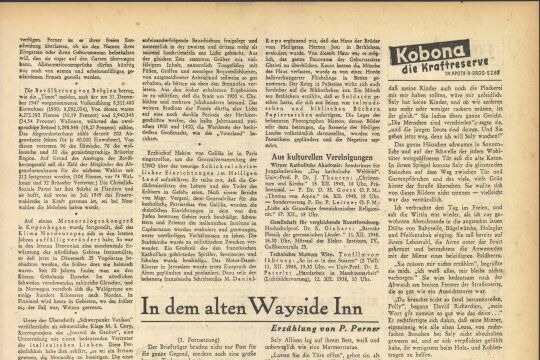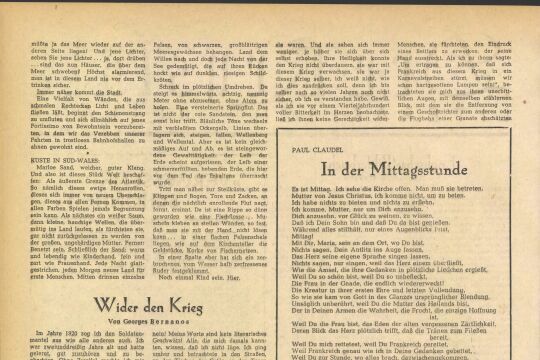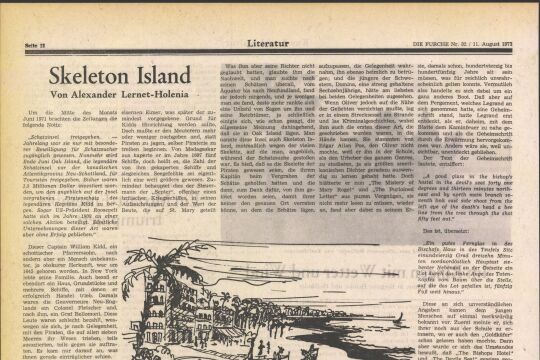Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Bloody Foreigner“
„THE COMMON MARKET OF THE COMMON PEOPLE.“ - Erich Fried, ein österreichischer Dichter, der in London lebt, prägte diesen Satz für Petticoat Lane, den großen Markt im East-End Londons. Seine englischen Freunde nahmen diesen Ausspruch auf. Nach zwei Wochen hieß der Markt fast allgemein „The common market of the common people“. Das Wortspiel des Emigranten war von Mund zu Mund gegangen, weit über den Kreis hinaus, der mit emigrierten Dichtern verkehrt und in dem der Name Erich Fried ein Begriff ist. Das ist London.
Scheinbar kontaktlos leben die Menschen nebeneinander. Worte sind so kostbar, daß sie wie Perlen auf die Waagschale gelegt werden. Aber nur in den ersten Minuten, bis das Eis gebrochen ist, bis man glaubt, mit einiger Würde die „Times“ oder den „Daily Mirror“ weglegen und mit einem Gespräch heginnen zu können. Hinter der Fassade aus Reserviertheit, Kühle und viktorianischer Steifheit liegt eine erstaunliche Bereitschaft zur Mitteilung. London ist eigentlich eine Stadt der guten Nachbarschaft, und die Nachbarschaft besteht oft nur aus der gemeinsamen Fahrt vom Vorort in die City.
ALS ICH VOR ZWEIUNDZWANZIG JAHREN als Emigrant zum erstenmal nach London kam, begrüßte mich Erich Fried mit einer Warnung: „Die Stadt ist kälter als der Nordpol, wenn du nicht verstehst, unter die Eisdecke zu schlüpfen. Hast du die Eisdecke durchbrochen — das kann eine Woche dauern oder ein Jahr —, dann bist du in London zu Hause. Natürlich bleibst du trotzdem ein bloody foreigner.“
Erich Fried selbst ist das Beispiel für dieses Leben, im Widerspruch zwischen endgültiger Zugehörigkeit und lebenslanger Fremdheit. Er kam vor vierundzwanzig Jahren in diese
Stadt und ist heute dort zu Hause, im vollsten Sinn des Wortes. Er lebt in einem Einfamilienhaus in der Vorstadt, er hat eine schottische Frau, drei Kinder, zwei Schildkröten und eine feste Stelle im BBC. Er gehört heute zu London — wie der riesige Abessinier, der an jedem Sonntag in der Petticoat Lane gefärbte Pfauenfedern verkauft und vom Weltuntergang predigt. Man kann sich die Stadt ohne sie kaum noch vorstellen, und Erich Fried sagt: „Ich kann mir ein Leben in keiner anderen Stadt mehr denken.“ Aber dabei weiß er, wie wahrscheinlich auch der Abessinier, daß er niemals etwas anderes werden kann als ein „bloody foreigner“. Erich Fried spricht diese beiden Wörter fast so liebevoll und ironisch aus wie seine englischen Nachbarn und seine schottische Frau, wenn sie über ihn sprechen.
Natürlich, „bloody foreigner“ kann
auch ganz anders ausgesprochen und ganz anders betont werden. In der Betonung dieser beiden Wörter spiegelt sich der ganze Bogen: von der nachbarlichen Toleranz bis zum bitteren Fremdenhaß, der plötzlich die Farbigen trifft und in ein ganz neues Problem mündet: das Rassenproblem.
ICH KAM DER LÖSUNG der vielfältigen Widersprüche im „bloody foreigner“ etwas näher, als ich London verließ. Auf meinem Weg zum Air Terminal mußte ich durch den Hyde-park gehen, an der Serpentine vorbei. Ein alter Mann setzte ein Modellschiff aus Holz sorgsam aufs Wasser. Der Frühjahrswind blies in die kleinen Segel und trieb das Boot in die Mitte der Serpentine. Ich stellte die Koffer ab, zog die Kapuze meines Dufflecoat über den Kopf — denn es nieselte — und beobachtete, wie das Boot eine Rinne durch das gelbe Laub auf der Wasseroberfläche zog. Damit war das Eis zwischen mir und dem alten Mann gebrochen, und er sagte, als kenne er mich seit Jahren: „Now she is happy“ — Wenn der Wind geht, freut sie sich. So wie alle guten Schiffe, auf denen der Alte gesegelt war. Das Boot hat er sich geschnitzt, als er zu alt für die großen Schiffe geworden war. Es segelte nun im diffusen Wind Londons über die Serpentine und wird nach Stunden, vielleicht erst gegen Abend, an irgendeinem Ufer landen. Der Alte merkte, daß ich ihn verstand, und er wollte mit mir weitersprechen, über das Boot, das, wie alle guten Boote, „happy“ ist, wenn eine feuchte Brise die Segel bläht. Aber ich war in Eile, und ich sagte ihm, daß ich mein Flugzeug erreichen müsse. Da merkte ich, wie er bei aller Sympathie dachte: „Bloody foreigner“.
•
AM WEG ZUM FLUGHAFEN hörte ich dann die andere Betonung des
„bloody foreigner“. In South Kensington fragte ich nach dem Weg. Ich fragte einen Westinder, der eine Zeitlang vor mir gegangen war. Er drehte sich um: mit einem Bindfaden um den Hals gehängt, trug er auf seiner Brust ein Schild: „I am vaccinated“ — Ich bin geimpft.
Zu dieser Zeit lagen Hunderte von Pockenverdächtigen in den Spitälern. England, das mit stoischer Ruhe den deutschen Blitz über sich hatte ergehen lassen, geriet an den Rand einer nationalen Hysterie. Die Angst vor der Seuche traf mit dem steigenden Haß gegen die einwandernden Westinder zusammen. Um Farbige auf den Straßen und in der Untergrundbahn bildete sich ein menschenleerer Kreis, wie um einen Leprakranken. Erschien ein Schwarzer neu an einer Arbeitsstelle, zogen sich die Engländer zurück und drohten mit Streiks.
Aus Pockenangst und neuerwachter Farbigenfeindschaft wächst die Pogromstimmung. In den übleren Arbeitervierteln und den Wohnblocks des Lumpenproletariats werden Neger, Araber, Inder verprügelt. Wo die Farbigen zusammenhalten, kommt es zu „race riots“ wie in den USA. „Go back into the jungle“, steht morgens an den Wohnungstüren von Farbigen. In soliden Kleinbürgervierteln klirren
nächtens die Fensterscheiben. Am Morgen sieht man Polizisten vor den leeren Fensterrahmen der Einfamilienhäuser, der Läden farbiger Geschäftsinhaber stehen. Auf den Mauern der Einfamilienhäuser steht: „Don't poison our childrenf“
DIE ANGST VOR DER EINWANDERUNGSWELLE der Farbigen begann schon vor einigen Jahren. Das Empire war verloren, aber aus allen Windrichtungen strömten Farbige aus den zu Staaten des Commonwealth gewordenen ehemaligen Kolonialgebieten nach England. Bürger dieser Staaten brauchten kein Visum, um in England zu leben und zu arbeiten. Das gehörte zu den letzten Bindemitteln, um das Commonwealth zusammenzuhalten und den einzelnen Bürger der Commonwealth-Staaten das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu lassen. In den meisten der Länder, die aus Kolonien zu selbständigen Mitgliedern des Commonwealth geworden waren, verschlechterte sich die wirtschaftliche Situation der Armen. Es kamen wirklich immer mehr aus Pakistan, aus Indien, aus Westindien und aus den ehemaligen Kolonialterritorien in Afrika nach London, das aus der Hauptstadt eines Kolonialreiches zur wirtschaftlichen Zufluchtstätte der ehemaligen „Kolonialsklaven“ geworden war.
Langsam begann diese Einwanderungswelle das Leben der Engländer, besonders der niedrigen Schichten, zu beeinflussen, ihren Standard zu gefährden. Das war nicht der Arbeitsplatz und der wirtschaftliche Standard, der in Gefahr geriet, denn England leidet an Arbeitermangel, sondern der soziale Standard.
In einer Sackgasse der Westindiendocks sind die Häuser seit Generationen baufällig, die Wände feucht und die Ratten die Nachbarschaft. Das war alles „good old England“. Aber die Straße und ihre Bewohner waren plötzlich deklassiert, als eine Pakistani-Familie das leergewordene Haus am Ende der Straße bezog. Die „Deklas-sierung“ durch die Farbigen griff um sich und machte alte Straßen des Mittelstandsviertels zu zweifelhaften Quartieren. Ähnlich ist es bei den Arbeitsstätten.
Ein Mann arbeitete jahrelang als Wagenwäscher in einer Großgarage. Eine Arbeit wie jede andere, durch zahlreiche Teepausen in der Werkskantine unterbrochen. In der Nachbarschaft dieses Mannes heißt es: „Er arbeitet in der London-Transport-Garage.“ Da findet sein jüngerer Arbeitskollege plötzlich eine bessere Stellung, und ein Mann aus Pakistan erhält den freigewordenen Posten. ,,A coloured people's job“ ist plötzlich das
Wagenwaschen in der Garage der London-Transport-Corporation geworden.
Der neue Rassenhaß bahnt sich seinen Weg bis in die Krankensäle der Spitäler. Als ich eine Freundin im Krankenhaus in Elephant & Castle besuchte, stand ich im Krankensaal plötzlich mitten im Rassenkampf. Im großen Saal mit dreißig Betten lagen drei „coloureds“; boykottiert von den anderen, doppelt armselig als Kranke und als Ausgestoßene. Die Cöckney-Frauen im Saal waren prächtige Exemplare: gutmütig, lebensklug, mit großer Mütterlichkeit um die junge Österreicherin im Spital besorgt. Wie
konnten diese Frauen von einem Haß erfaßt sein, der bis an den Rand des Todes reicht? Eine Patientin erklärte es mir: „Sie liegen in dem Bett, das von unseren Steuern gekauft wurde. Sie werden von Ärzten behandelt, die wir bezahlen. Sie sollen hier gesundgepflegt werden, wo sie noch nicht lange genug leben, um sich das Recht auf Kranksein erworben zu haben.“ — Auch der Wohlfahrtsstaat und die allgemeine unentgeltliche Krankenpflege kennt das Eigentumsbewußtsein — auf ein Bett im Spital.
IM FLUGZEUG DER AUA flog ich bequem und angenehm umsorgt in fünf Stunden von Wien nach London. Der
Schatten der großen Maschine zeichnete sich nur einige Minuten lang im Wasser ab, das zwischen dem Kontinent und England liegt. Der Ärmelkanal schien nicht breiter zu sein als ein Donauarm. In einigen Jahren wird man vielleicht durch einen Tunnel oder über eine Brücke am Steuer seines Wagens von Calais nach Dover fahren. Was ist heute noch eine Insel? Aber England, das ich seit zweiundzwanzig Jahren kenne, ist in den letzten zwei Jahren viel stärker zu einer Insel geworden, als es dies jemals seit dem Krieg war. Man hat das Weltreich verloren.
Man trauert ihm nicht nach. Man hat sich aus der Welt in das Einfamilienhaus zurückgezogen und lebt dort ein Leben im Frieden, wie ich es sonst nirgends am Globus fand. Ich verstand erst die englische- Angst vor dem Krieg, das Mißtrauen gegen die Weltpolitik, die Abneigung gegen den Gemeinsamen Markt, nachdem ich dieses Leben im Frieden des Einfamilienhauses im Londoner Vorort kennenaelernt hatte. Die Insel duldet den Fremden aus Europa, der ihren Rhythmus erfaßt hat und der das insulare Leben liebt. Sie wehrt sich gegen die Wellen, die, von fremden Gestaden kommend, ihr Gefühl der Sicherheit und des Lebens im Frieden des Einfamilienhauses gefährden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!