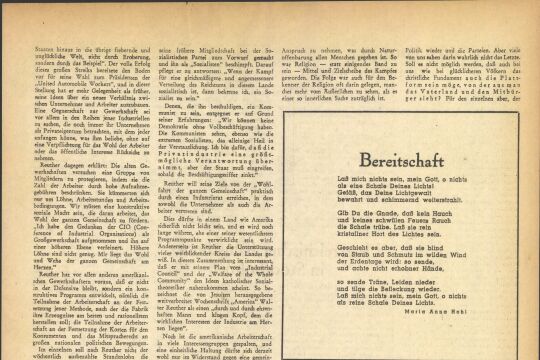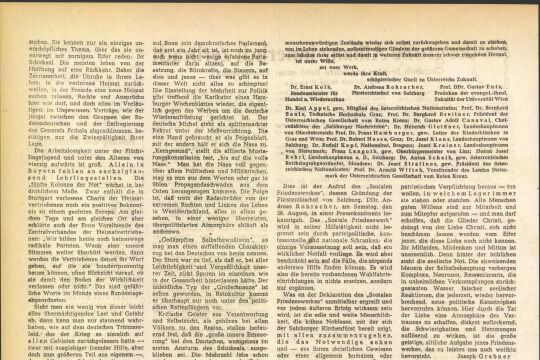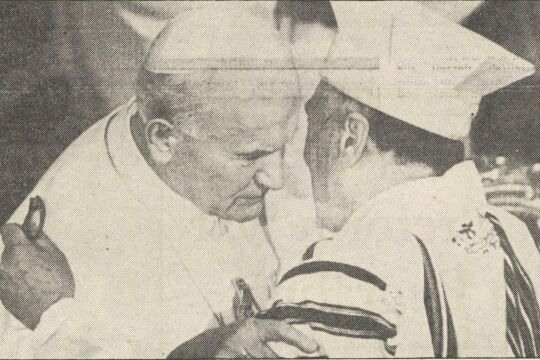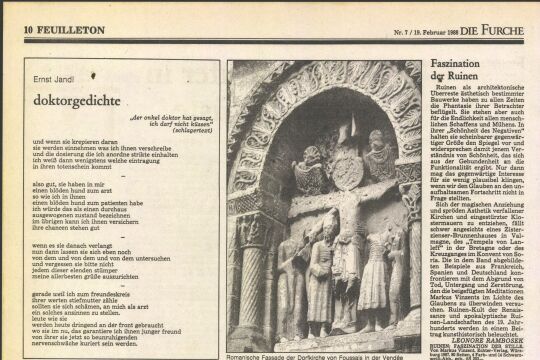In einer Festung leben
Ein Land im Dauerkonflikt: die gegenwärtige Literatur in Israel versucht ihren Beitrag zur Lösung der Konflikte.
Ein Land im Dauerkonflikt: die gegenwärtige Literatur in Israel versucht ihren Beitrag zur Lösung der Konflikte.
In der Kreuzfahrerfestung Beaufort im Südlibanon hausen junge Israelis: die wunderbare Aussicht auf das schöne Land können sie nicht genießen, sie erwarten Angriffe der Hisbollah und kommen nur nachts ins Freie. Soldaten, fast Kinder noch, die in dieser Welt eine eigene Sprache kreieren: „Purple Rain“ bedeutet Mörsergranaten, und statt Angst sagen sie „aufgegessen.“
Es ist eine Stärke der Literatur, dass sie wie Ron Leshem in seinem Roman „Wenn es ein Paradies gibt“ (2008) die Lesenden in jene Räume versetzen kann, von denen sie erzählt, dass sie bewegende Bilder malen kann auch über jene Ereignisse, die zwar täglich über die Fernsehschirme flimmern, aber vielleicht gerade deswegen längst an der Begreif- und Erlebbarkeit vorbei. Es ist auch eine Stärke der Literatur, dass sie einen kleinen, überschau- und erzählbaren Raum gestalten kann, in dem der große Raum sichtbar wird. Das Leben in der Festung Beaufort ist dann das Leben in der Festung Israel, ein Leben in einem schönen Land, das vielen Heimat und Paradies sein sollte, das aber nicht zu funktionieren scheint ohne Mauer, ohne Krieg, ohne Attentat, ohne Angst, ohne Feind – und das damit nicht nur den anderen, dem „Feind“, zur engen Hölle geworden ist.
Wenn Nir Baram (geb. 1977) in seinem Roman „Der Wiederträumer“ (2009) von einer unheimlichen Naturkatastrophe in Tel Aviv erzählt und einen Sturm aufkommen lässt, so furchterregend und unerklärbar wie ein Gottesgericht, kann man dieses apokalyptische Bild auch als Bild jenes permanenten „Katastrophenzustandes“ lesen, und man kann lesen, wie eine Gesellschaft darauf reagiert: „Mit welchen anderen Waffen als mit denen der Gewöhnung kann man ein solches Unheil bekämpfen? Der Mensch ist doch verpflichtet, seine tägliche Existenz zu behaupten. Es gibt keinen Tag ohne Pflichten und Aufgaben. Ein Mensch muss sich um seine Kinder kümmern, um seine Lieben, muss Rechnungen bezahlen, muss arbeiten, ruhen, schlafen und aufwachen, seinen Hunger stillen. Bald herrschte eine Art wortloses Einverständnis, dass Sturm und fehlendes Licht auch nichts Anderes waren als weitere schwerwiegende Mängel einer seit eh und je fehlerhaften Welt.“
In Israel sterben die Kinder als Soldaten vor ihren Eltern oder, wie es in Yoram Kaniuks Roman „Die Vermisste“ (2007) heißt: „Sie sagte, sie hätte mich nicht geboren, damit ich gegen sie sterbe.“ David Grossman (geb. 1954) ging in seinen Essays („Die Kraft zur Korrektur“, 2007) der Frage nach, was es heißt, in einem derartigen Katastrophengebiet zu leben: Man gewöhnt sich an den Zustand und beginnt fatalistisch in Kauf zu nehmen, dass es so ist, wie es ist.
In Barams Roman liest sich dieses Phänomen so: „Das gewohnte Ordnungssystem war ins Wanken geraten, und die Menschen griffen zu äußerst einfachen Lösungen: Emigration, vorübergehender Ortswechsel, endgültiges Wegziehen, Rückkehr ins Elternhaus außerhalb der Stadt. Die, die blieben, zogen sich in ihre vier Wände zurück und mussten sich anpassen. Sie fassten nur kurzfristige provisorische Entschlüsse und warteten ansonsten, bis etwas Neues geschah. Sie mussten sich eingestehen, dass sie unfähig waren, das Licht am Himmel zu entzünden, den Regen zu entwaffnen, die Flüsse trockenzulegen oder die Bäume am Zusammenbrechen zu hindern.“
Man lebt, als wäre das Leben „normal“, aber die Angst verengt Leben und Denken des Individuums und der Gesellschaft, stellt Grossman in seinen Essays fest. „Man kann sich nicht an solch eine verzerrte Lage gewöhnen, ohne einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Den höchsten Preis: den Preis der Lebendigkeit, den Preis der Sensibilität, Menschlichkeit, Neugier, Gedankenfreiheit. Den Preis, vor lauter Angst und Schrecken nicht mehr als ganzer Mensch und wach vor dem Nächsten zu stehen: nicht nur vor dem Feind, sondern vor jedem Anderen.“
Fatale Gewöhnung
Diesen fatalen Gewöhnungszustand unterstützt eine Sprache, die verschleiert, vertuscht, beschönigt. In den Medien ist dann von den „Gebieten“ die Rede, nicht von den „besetzten Gebieten“, da „wird getötet“, denn, so Grossman, „wer wollte schon zugeben, dass unsere Hände dieses Blut vergossen haben. (Das Passiv ist mitunter die letzte Rettung des Patrioten.)“ Die Sprache verflacht, „bis sie zu einer Aneinanderreihung von Schlagworten und Parolen verkommt“. Auf dem Humus der Klischees stirbt der öffentliche Diskurs und erblühen die Vorurteile.
Abraham B. Jehoschua spielt im Titel seines Romans „Freundesfeuer“ (2009) auf den Ausdruck „freundliches Feuer“ an, der „das Feuer der eigenen Truppen“ meint (und verbindet es im Buch mit dem Anzünden der Chanukka-Kerzen). Ein „Gefallenenvater“ will erfahren, wer dieser „Freund“ war, der das Feuer auf seinen Sohn eröffnet hat. Das gestaltet sich aber als schwierig, denn: „Das individuelle freundliche Feuer geht im kollektiven Feuer unserer eigenen Truppen unter, wird dann nach und nach vom militärischen Feuer zum zivilen und vom zivilen zum unbestimmten, bis der Schütze sich selbst nicht mehr sicher ist, ob er eines Nachts wirklich irrtümlich seinen Kameraden erschossen hat.“
Welche Rolle kann nun Literatur in einer solchen politischen Situation spielen, außer Worte und Bilder kritisch zu hinterfragen? Jede. Denn immer und überall gab es Literatur, die Vorurteile und Klischees transportierte, sich vor den Karren von Kollektivmythen und Nationalismus spannen ließ und Helden als Transportmittel für Ideale und Ideologien erfand, um den Status quo und das Recht darauf (nicht selten gegen andere) zu erklären und zu befestigen. Die vorstaatliche israelische Literatur etwa erfand den zionistischen Pionier als Norm. Doch mit den einwandernden Shoah-Flüchtlingen und -Überlebenden kamen nicht nur grauenhafte Erinnerungen ins Land, sondern gerieten auch bisherige Normen ins Wanken.
Das Interesse vieler Autorinnen und Autoren galt nicht mehr der Verklärung der Vergangenheit. Sie schrieben entweder aus Sicht der Überlebenden, wie Aharon Appelfeld (geb. 1932), oder stellten für die Gesellschaft unbequeme Fragen, wie Abraham B. Jehoschua (geb. 1936), Yoram Kaniuk (geb. 1930) oder Amos Oz (geb. 1939). Zweifel an den zionistischen Normen fanden ebenso Platz wie Schuldgefühle gegenüber den Arabern. Und die vorgebliche Einheit des Staates wurde provokant in Frage gestellt, die kulturellen, religiösen und politischen Risse kamen in den Blick.
Gegen die Masse
Viele Werke der zeitgenössischen israelischen (und der palästinensischen!) Literatur zeigen, dass Literatur auch einen bedeutenden Beitrag leisten kann in und gegen augenscheinlich ausweglose politische Situationen wie jene in Israel und Palästina. Der Kriegsberichterstattung im Passiv entspricht die Erfahrung, dass der Krieg eine namen- und gesichtslose Masse braucht. Literatur hingegen macht aus einer Masse Individuen mit Gesicht und Namen, erzählt viele Geschichten gegen die eine offizielle (Norm-)Geschichte.
Ob das nun Ora in David Grossmans großartigem Roman „Eine Frau flieht vor einer Nachricht“ (2009) ist, die dem System zu trotzen versucht: „Und wie kommt es, dass ich denen, die ihn dorthin ausrücken lassen … mehr die Treue halte als meinem eigenen Muttersein?“ Sie verweigert vorauseilend die befürchtete Entgegennahme der Nachricht vom Tod ihres Sohnes, indem sie mit einem Freund (seinem Vater) durch Galiläa wandert und ihre Familiengeschichte Revue passieren lässt, die nicht so harmonisch und glücklich war, wie sie sie gerne erinnern würde. Ob es der Vater eines im „freundlichen Feuer“ gefallenen Soldaten im Roman „Freundesfeuer“ ist, der aus Sehnsucht nach einem Ort, „an dem wir in keiner Erinnerung vorkommen“, nach Ostafrika zieht. Oder ob es jener junge Araber ist, der in Amoz Oz’ Erzählband „Geschichten aus Tel Ilan“ (2009) in einem jüdischen Dorf zu leben versucht: „Vielleicht würde er über die Unterschiede zwischen einem jüdischen und einem arabischen Dorf schreiben. Euer Dorf wurde aus einem Traum heraus erschaffen, nach einem Plan, sagte er, sein Dorf hingegen sei überhaupt nicht erschaffen worden, sondern schon immer da gewesen, aber es gebe dennoch etwas, in dem sie sich ähnelten. Träume gebe es auch bei ihnen. Nein. Jeder Vergleich sei immer ein bißchen falsch. Aber das, was er hier liebe, sei in seinen Augen nicht falsch.“
„Die Literatur – nicht unbedingt dieses oder jenes Buch, sondern die Art des Zuhörens, die echte Literatur bewirkt – ruft uns dazu auf, uns aus der Umklammerung der ‚politischen Lage‘ zu lösen und unser Recht auf Individualität und Einzigartigkeit zu reklamieren“, schreibt David Grossman. Sie erinnert an „die differenzierte, einfühlsame Hinwendung zu dem einzelnen Menschen, der in dem Konflikt gefangen ist, ob auf unserer Seite oder auf der anderen.“ Als Erspüren von Möglichkeiten, als einen Akt gegen die Erstarrung will Grossman solche Literatur verstanden wissen, die sich gegen Gewöhnung und Fatalismus wendet und daran erinnert, „dass man die freie Wahl hat, der Wirklichkeit auf eigene Weise entgegenzutreten“. Die Freiheit der Literatur ist die Freiheit, anders zu denken – und das auf jede mögliche Art.
Gegen die Verzweiflung
Dass Literatur auch gegen den Tod, die Verzweiflung, die Negation anschreiben kann, ist Grossmans persönliche leidvolle Erfahrung. „Das Unglück, das mir geschehen ist, als mein Sohn Uri im zweiten Libanonkrieg gefallen ist, begleitet mich permanent. Die Macht der Erinnerung ist in der Tat kolossal und schwer und hat bisweilen eine lähmende Qualität. Und doch verschafft der Akt des Schreibens an sich mir in dieser Zeit auch eine Art ‚Ort‘, einen ungekannten seelischen Raum, in dem der Tod nicht nur die absolute, eindimensionale Negation des Lebens ist.“
Es ist eine Binsenweisheit, dass Literatur den Blick auf den anderen werfen kann, sogar in ihn hinein. In Zeiten, in denen die eigenen Kinder gegen den anderen in den Krieg ziehen müssen, um ihn zu töten oder von ihm getötet zu werden, in Zeiten, in denen man glaubt, sich durch eine Mauer vom anderen schützen zu müssen, stellt diese Einladung, sich mit anderen zu identifizieren, allerdings eine besondere Herausforderung da. Wenn Grossman vom Prinzip des Anderen spricht, dessen tiefste Bedeutung „sein Recht auf Existenz ist (sowie sein Recht auf seine Geschichten, seine Schmerzen und seine Hoffnungen)“, so meint er damit auch den „Feind“.
Solches Sehen kann die offizielle Geschichte erschüttern, die womöglich gerade der Grund für den andauernden Konflikt ist. „Denn wenn es uns gelänge, den Text der Realität mit den Augen des Feindes zu lesen, würde die Realität, in der wir und unser Feind leben und handeln, plötzlich komplexer und realistischer.“ Einfacher macht eine solche Literatur nichts. Sie sieht auch die verhängnisvollen simplen Dichotomien, von denen Kriege und Konflikte leben, etwa jene: hier das Opfer, dort der Aggressor. Sie negiert das „doppelköpfige Ungeheuer“, wie Raymond Federman die Dualität nannte, und sucht sie erzählend außer Kraft zu setzen.
„Manchmal richte ich mich während der Arbeit, nachdem ich mehrere Stunden geschrieben habe, auf“, schreibt Grossman, „und denke: Genau in diesem Moment sitzt ein anderer Autor, den ich möglicherweise nicht einmal kenne, in Damaskus oder Teheran, in Ruanda oder Dublin ebenso wie ich über einer seltsamen, widersprüchlichen, wunderbaren, kreativen Arbeit, inmitten einer Realität, die aus so viel Gewalt, Entfremdung, Gleichgültigkeit und Einschränkungen besteht. Ich habe dort irgendwo einen fernen Verbündeten, der nichts von mir weiß. Und dennoch weben wir gemeinsam an diesem abstrakten Netz, das ungeheuer stark ist, das die Kraft besitzt, die Welt zu verändern und eine eigene Welt zu schaffen, die Kraft, Stumme zum Reden zu bringen, die Kraft des Tikkun, der Korrektur – in dem tiefen Sinn, den ihr die Kabbala verleiht.“
Der Wiederträumer
Roman von Nir Baram. Aus dem Hebr. von Lydia Böhmer und Harry Oberländer, Schöffling & Co. 2009. 477 S.,
geb., e 25,60
Freundesfeuer
Roman von Abraham B. Jehoschua Aus dem Hebr. von Ruth Achlama
Piper 2009 475 S., geb., e 23,60
Eine Frau flieht vor einer Nachricht
Roman von David Grossman. Aus dem Hebr. von Anne Birkenhauer, Hanser 2009, 727 S., geb., e 25,60
Geschichten aus Tel Ilan
Von Amos Oz
Aus dem Hebr. von Mirjam Pressler Suhrkamp 2009 187 S., geb., e 17,30