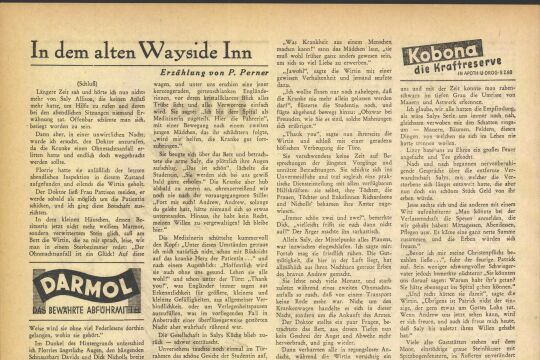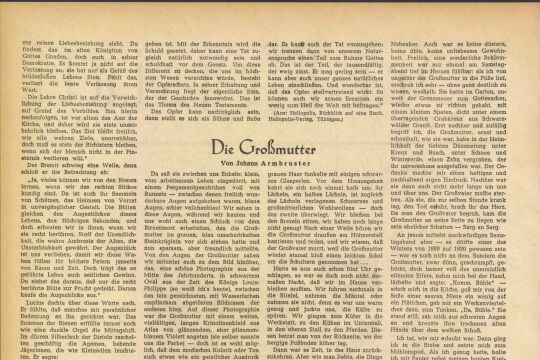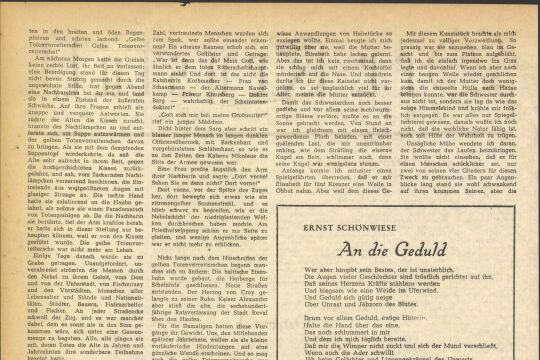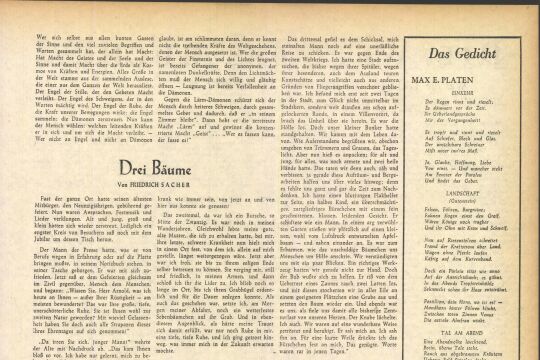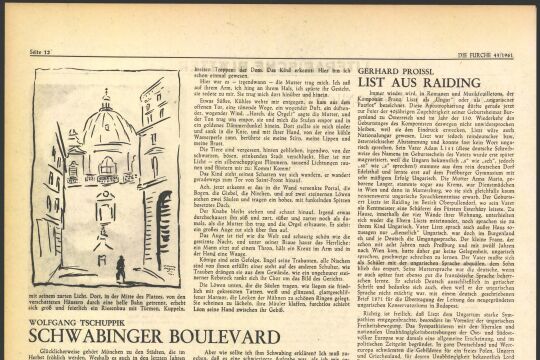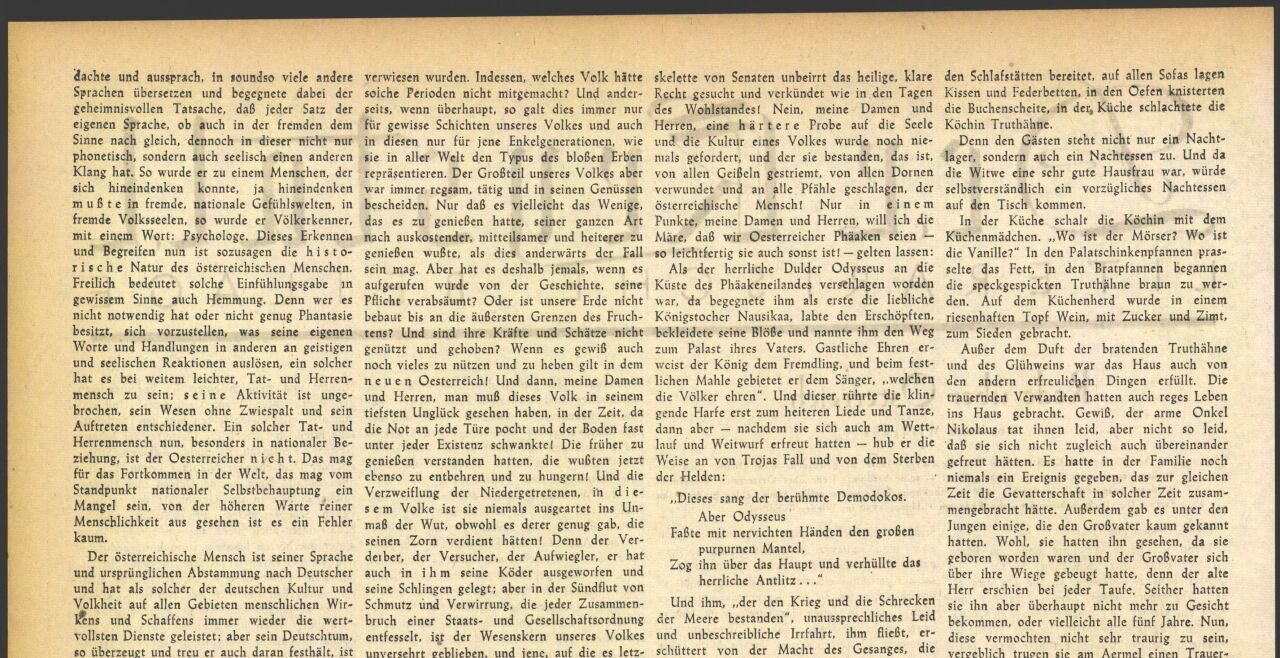
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Begrabnis des frortlicrten Armeniers
Es lebte in Siebenbürgen ein armenischer Weinhändler namens Nikolaus Asbey. Er war sechzig Jahre alt und hatte zwölf Kinder. Sieben Söhne und fünf Töchter. Sieben Enkel, fünf Schwiegersöhne, sieben Schwiegertöchter, unzählige Schwäger, Neffen, Nichten, Gevatter und allerhand Verwandtschaft. Seine Familie vermehrte sich in biblischem Maßstab im Lande. Manche Verwandten kannten einander nicht. Es gab unter ihnen Geschwisterkinder, die einander im Leben noch nie begegnet waren. Das Schicksal hatte sie in den Städten von Siebenbürgen verstreut, auf viele hundert Kilometer voneinander entfernt.
Der Armenier war ein rotgesichtiger, dicker, dunkelhäutiger Mann mit großem Schnurrbart. Aus seinen Ohren und Nasenlöchern brachen gewaltige Haarbüs'chel hervor. Er liebt es, zu rauchen, zu essen, zu trinken, sich zu unterhalten. Sein Arzt hatte ihn wohl zur Vorsicht ermahnt, sein Herz sei bereits ein müder Motor, er würde sein Leben um viele Jahre verkürzen, wenn er seine Vergnügungen nicht ändere.
Er verzichtete jedoch auf keine Freude des Lebens. Nicht einmal seine Arbeit gab er auf, wenngleich es ein richtig mühsames Gewerbe ist, immerfort im Eisenbahnzug zu sitzen, zwischen den vielen Ortschaften zu pendeln, mit Gastwirten zu feilschen, mit Weinbauern sich zu ärgern, ewig in fremden Betten zu schlafen, in schlechten Provinzgasthöfen, wo die Wände feucht sind und die Kissen nach Chlorkalk riechen.
Es gibt Menschen, die sich immer verspäten. Ein solcher Mensch war auch der Armenier. Hatte er sich irgendwo niedergesetzt, so blieb er dort sitzen, um des Essens, Trinkens, des Kartenspiels, der lustigen Kumpane willen.
Einmal begab es sich, daß der Armenier in Marosujvar Station gemacht hatte, um den Wein des Grafen Teleki zu kaufen. Es war am Vormittag, doch saß er bereits im Cafe und frühstückte Wein, bei Musik. In der einen Hand das Glas, in der anderen die Zigarre, und hinter seinem Rücken der Zigeunerprimas, der ihm ins Ohr fiedelte.
. Er fühlte sich herrlich. Er stieß bisweilen einen Jauchzer aus, trank, dirigierte die Zigeunerkapelle.
Unvermittelt hatte er das Gefühl, ein heißer Vorhang sause vor seinen Augen nieder. Der übermütige Jauchzer blieb in seiner Kehle stekken, sein Stierkopf sank seitwärts. Sein schwerer Körper stürzte zu Boden, mit solcher Wucht, daß die Silbermiinzen aus seiner Tasche rollten.
Die Kellner eilten zu ihm hin, hoben ihn auf, säuberten seinen Anzug, der vom Fußboden schmutzig geworden war. Der wuchtige, rotgesichtige, behaarte Armenier lebte nicht mehr. Ein Schlaganfall hatte ihn binnen eines Augenblicks erledigt, wie er sich das schon immer gewünscht hatte.
Die traurige Kunde erreichte seine Familie. Die Frau des Armeniers, die vom vielen Kindersegen im Alter zu einer mageren kleinen Person zusammengeschrumpelt war, weinte, wehklagte, war aber eigentlich nicht überrascht. Sie wußte, dies würde einmal das Ende ihres Mannes sein.
Die Vorbereitungen für das Begräbnis wurden getroffen. Bei der Leichenbestattungsanstalt wurde das Galabegräbnis erster Klasse mit einem Sechsergespann und mit Musik bestellt. Es war Samstag, die Zeremonie wurde für Dienstagnachmittag anberaumt. Bis dahin mußte von Marosujvar der Sarg mit dem Verstorbenen eingetroffen sein.
Und wie es zu einem reichen Toten paßt: die lange Front des Asbey-Hauses war mit silbergerändertem schwarzen Tuch überzogen. Im Schlafzimmer war der Katafalk aufgestellt, ringsum brannten die Kandelaber, das ganze Zimmer war erfüllt vom wehmütigen Lorbeergeruch der Kränze.
Die Verwandten trafen aus allen Gegenden des Landes ein, die vielen Kinder, Enkel, Schwiegersöhne, Schwiegertöchter, Gevatter und Schwäger. Der Hof füllte sich mit Trauergästen. Der Priester war ebenfalls anwesend, im weißen Chorhemd, und anwesend waren auch die kleinen Ministranten mit dem Weihrauchkessel. Vor dem Haus, auf der Straße, stand der Leichenwagen mit den federbuschigen, silbergeschirrigen schwarzen Rossen.
Alles wäre in Ordnung gewesen, nur der Tote war nicht angekommen. Diesmal war nicht er daran schuld. Es war Winter, und der Winter in Siebenbürgen ist wie der russische Winter. In der furchtbaren Schneeverwehung war irgendwo die Lokalbahn steckengeblieben, die den Sarg bringen sollte.
Gegen diese Fügung des Schicksals ließ sich nichts machen; das Begräbnis mußte verschoben werden. Der Priester und die kleinen Ministranten gingen nach Hause. Die Freunde aus der Stadt gingen ebenfalls.
Die Verwandtschaft jedoch konnte nicht heimgeschickt werden. Diese Leute waren von weither aus den verschiedenen siebenbürgischen Städten und Dörfern gekommen, um an dem Begräbnis teilzunehmen. Sie waren müde angekommen, den Pelz voller Schnee, das Gesicht steif vor Kälte. Wie groß auch ihre Zahl sein mochte, es ließ sich nicht vermeiden, ihnen im Familienhaus Unterkunft zu geben.
Ein emsiges Treiben setzte ein. Für alle wurden Schlafstätten bereitet, auf allen Sofas lagen Kissen und Federbetten, in den Oefen knisterten die Buchenscheite, in der, Küche schlachtete die Köchin Truthähne.
Denn den Gästen steht nicht nur ein Nachtlager, sondern auch ein Nachtessen zu. Und da die Witwe eine sehr gute Hausfrau war, würde selbstverständlich ein vorzügliches Nachtessen auf den Tisch kommen.
In der Küche schalt die Köchin mit dem Küchenmädchen. „Wo ist der Mörser? Wo ist die Vanille?“ In den Palatschinkenpfannen prasselte das Fett, in den Bratpfannen begannen die speckgespickten Truthähne braun zu werden. Auf dem Küchenherd wurde in einem riesenhaften Topf Wein, mit Zucker und Zimt, zum Sieden gebracht.
Außer dem Duft der bratenden Truthähne und des Glühweins war das Haus auch von den andern erfreulichen Dingen erfüllt. Die trauernden Verwandten hatten auch reges Leben ins Haus gebracht. Gewiß, der arme Onkel Nikolaus tat ihnen leid, aber nicht so leid, daß sie sich nicht zugleich auch übereinander gefreut hätten. Es hatte in der Familie noch niemals ein Ereignis gegeben, das zur gleichen Zeit die Gevatterschaft in solcher Zeit zusammengebracht hätte. Außerdem gab es unter den Jungen einige, die den Großvater kaum gekannt hatten. Wohl, sie hatten ihn gesehen, da sie geboren worden waren und der Großvater sich über ihre Wiege gebeugt hatte, denn der alte Herr erschien bei jeder Taufe. Seither hatten sie ihn aber überhaupt nicht mehr zu Gesicht bekommen, oder vielleicht alle fünf Jahre. Nun, diese vermochten nicht sehr traurig zu sein, vergeblich truecn sie am Aermel einen Trauerflor. Mit der Selbstsucht der Jugend kümmerten sie sich nur um einander, betrachteten sich neugierig. Die erwachende gegenseitige Sympathie ließ sie kleine Gruppen, einzelne Paare bilden. Zwischen einem schwarzäugigen Mädchen und einem ebenfalls schwarzäugigen Jüngling entflammte das Gefühl so jählings, daß sie in der dritten Stunde ihrer Begegnung unter dem Vorwand des Handwaschens ins Badezimmer gingen, wo sie sich sofort zu küssen anfingen. Aber warum denn auch nicht? Sie waren ja Geschwisterkinder!
Die trauernde Witwe bemerkte mit tränenumflorten, aber alles beobachtenden Gluckhennenaugen die zwischen ihren Enkeln aufsprießende Liebe. Sie erweckte in ihr keinen Widerspruch. Der Vater des Burschen besitzt eine Apotheke. Das Mädel bekommt eine schöne Mitgift. Daß die beiden Geschwisterkinder sind? Bisweilen glücken solche Ehen. Die eine Hälfte des Herzens der kleinen alten Person war voller Kummer, die andere Hälfte voller Strahlen. Sie trauerte zugleich, und war zugleich selig, da sie eine Art Glück über ihren beiden Kücken aufdämmern sah. Und beim Nachtessen setzte sie die beiden nebeneinander.
Nach Mitternacht verstreuten sich die Jungen in dem großen Haus, lachten und verlöschten die Kerzen, denn zum Freundschaftschließen braucht man kein Licht. Die Frauen setzten sich beiseite, um zu plaudern. Die Männer blieben am Tisch sitzen, sprachen über ihr Leben. Als es zu dämmern und der schwere Wein ihnen zu Kopf zu steigen begann, kamen sie auf die Idee, Anekdoten über das verschiedene Familienoberhaupt zu erzählen. Es tat ihnen wohl, zu lachen. Sie schrieben es dem Toten zu, es sei seine Schuld, warum hatte er so prächtige Streiche gespielt?
Zu dieser Stunde saß die Witwe nicht mehr am Tisch zwischen den Gästen. Um drei Uhr morgens traf der Tote ein. Der Sarg wurde vom Wagen gehoben, heimlich ins Haus getragen, hinauf ins Schlafzimmer. Er wurde auf die Bahre gestellt, zwischen die vielen Lorbeerkränze und Chrysanthemen. Die Witwe sagte davon niemand etwas. Warum sollte sie das lustige Familienfest stören? Sie zündete in den Kandelabern die Kerzen an, setzte sich dann aufs Bett und betrachtete den mit Goldlettern verzierten schwarzen Sarg. In ihm war ihr ganzes Leben. Die Erinnerung an so viel Leid und so viel Glück. Die Geburt der Kinder, Krankheiten, schöne Sommer, die Qualen der Eifersucht. Die kleine Person war all die Zeit verliebt gewesen in ihren heißblütigen, fröhlichen Mann. Und sie fühlte auch jetzt diese Liebe, die sich nie verflüchtigt, sondern sich nur verdünnt, ätherisch verfeinert hatte, wie der Duft trocknenden Lavendels.
Aus dem Speisezimmer tönte der ausgelassene Gesang herüber. Die Witwe dachte einen Augenblick daran, die Unterhaltung, um des Anstan-des willen, ja doch zu beenden und die Familie ins Bett zu schicken.
Aber dann tat sie es trotzdem nicht. Sie hatte immer gewußt, was für ein Mensch ihr Mann war, hatte ihm jeden Gedanken nachgefühlt. Sie lächelte wehmütig und brummte, mit ihren mageren, alten Händen zärtlich den Sarg streichelnd, leise vor sich hin:
„Sie sollen sich nur unterhalten! Nicht wahr, so gefällt es auch dir, mein Liebster, mein Einziger ..
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!