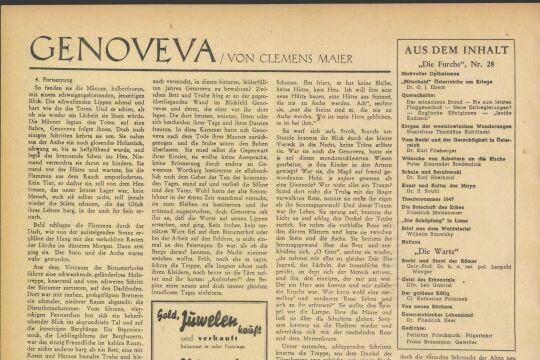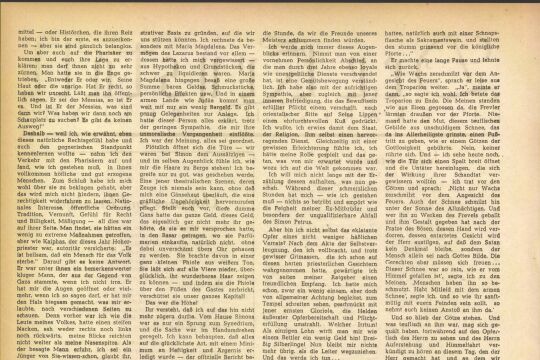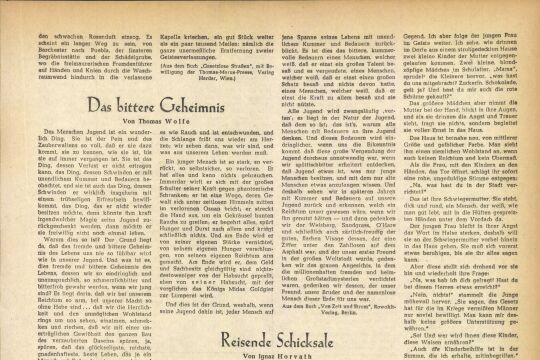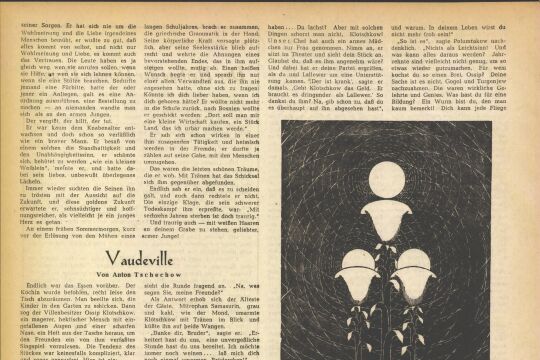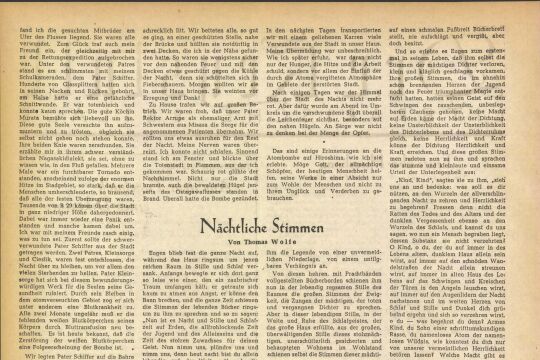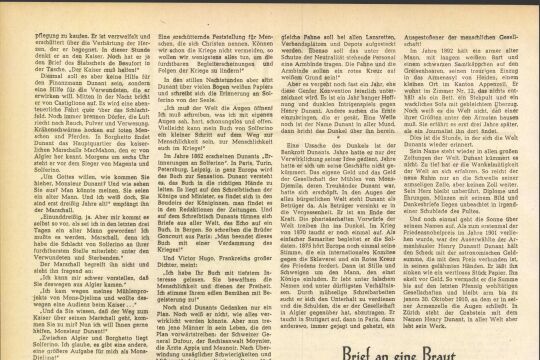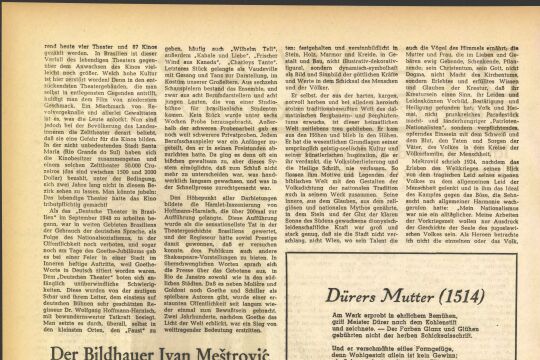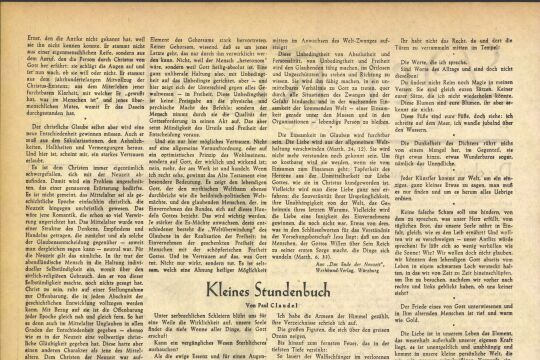Cormac McCarthys Roman "Die Straße" führt in eine Welt aus Asche und Staub und an die Fragen nach Gott und Mitmenschlichkeit, verkörpert durch ein Kind.
Tote Bäume, die Tage dunkel vor Asche und Staub, Städte verbrannt, Häuser verlassen, die Landschaft eine Kohleskizze: ein postapokalyptisches Szenario. Vielleicht aber auch nur die bekannte Welt, konsequent zu Ende gedacht: zersplittert in Gute und Böse, beherrscht von Misstrauen, Angst und Gewalt, kurz: ziemlich unmenschlich. Jedenfalls die Welt, die Cormac McCarthy in seinem neuen Roman Die Straße entwirft, für den er soeben den renommierten Pulitzerpreis erhalten hat.
Kein sicheres Heim
Ein Vater schleppt sich mit seinem Sohn durch eine unheimliche Aschelandschaft Richtung Meer. Er kann seinem Sohn nicht erklären, wer gut, wer böse ist. Er kann auch das Unterscheidungsmerkmal - sie, die Guten, bewahren das Feuer - nicht näher erläutern. Die beiden, "jeder die ganze Welt des anderen", versuchen zu überleben, indem sie Essen, Wasser und Öl suchen und sich verstecken. Die Angst vor den Bösen erlaubt nicht, irgendwo länger zu bleiben - nicht einmal der Bunker, der ihnen alles böte, was sie brauchen, ist ein sicheres Heim. Das Meer schließlich, zu dem sie nach Jahren gelangen, wird nicht blau, der Süden nicht warm und freundlich sein.
Das Szenario würde sich dazu eignen, in guter literarischer Tradition Zivilisationskritik zu üben, doch McCarthy vermeidet das. Er erzählt weder Ort noch Zeit noch Namen. Die schrecklichen Geschehnisse, die dieser Handlung vorausgegangen sind, werden nicht näher benannt. Nur soviel ist zu erfahren: Städte haben gebrannt, Menschen wurden ermordet, Häuser geplündert, die Erde verwüstet. Um einer solchen Welt zu entfliehen, hat die Mutter des Kindes sich umgebracht.
Warum so etwas lesen, fragen sich nun vielleicht jene, die wenig oder kein Interesse an apokalyptischen Endzeitvisionen haben. Weil McCarthys Roman leise und trotz aller Grausamkeit poetisch ist. Gerade weil keine Filmeffekte erzählt werden, keine Nuklearbomben gezündet werden, wird aber das schaurige Danach, in dem kaum Menschliches übrig geblieben scheint, umso schauriger. Die Fragen des Jungen treffen meist ins Schwarze: "Wenn man die ganze Zeit aufpasst, heißt das dann, dass man die ganze Zeit Angst hat?"
Der Roman erzählt unter anderem von der Angst eines Vaters, sein Kind alleine zurücklassen zu müssen. Die berührenden, knappen Dialoge zwischen Vater und Sohn sorgen dafür, dass man nicht zu lesen aufhören will.
"Ich muss dich ständig im Auge behalten, sagte der Junge.
Ich weiß.
Wenn man kleine Versprechen bricht, bricht man auch große. Das hast du selber gesagt."
Einmal begegnet ihnen ein alter Mann und dem Kind ist es zu verdanken, dass er zu essen bekommt. Er nennt sich Ely: "Es gibt keinen Gott, und wir sind seine Propheten." Nicht nur hier leuchtet auf, dass es in diesem Roman letztlich um Gott (und um Gottverlassenheit) geht. Auch so manch biblischer Topos macht das deutlich: "Dann kniete er einfach in der Asche. Er hob das Gesicht dem erblassenden Tag entgegen. Bist du da?, flüsterte er. Werde ich dich endlich sehen? Hast du einen Hals, damit ich dich erwürgen kann? Hast du ein Herz? Hol dich der Teufel, hast du eine Seele? O Gott, flüsterte er. O Gott."
Geboren, während die Welt bereits in Flammen stand, also ohne Erinnerung an ein heiles Davor, ist dieses Kind selbst eine "Stimme Gottes". Ein Schlüsselsatz fällt schon zu Beginn: "Wenn er nicht das Wort Gottes ist, hat Gott nie gesprochen." Der Vater hört aber zunächst nicht auf sein Kind. Dieses nämlich will nicht vorbeigehen an Hungernden und Leidenden. Nachdem der Vater einen Mann erschossen hat, um seinen Sohn zu schützen, schweigt das Kind tagelang, um dann die Frage zu stellen: "Sind wir immer noch die Guten?" Als sie ein Kind ignorieren, weint der Sohn: "Wir könnten zurückgehen … Es ist nicht zu spät." Zu Beginn wollte er noch Geschichten hören, am Ende nicht mehr. Denn: "… in den Geschichten helfen wir andauernd jemandem, dabei tun wir das in Wirklichkeit gar nicht."
Buntstifte findet dieses Kind in der Aschewelt, es zieht eine Lichtspur durch die dunkle Landschaft: "Goldener Kelch, gut um einen Gott zu beherbergen." Der Kontrast beginnt schon beim ersten Satz: "Wenn er im Dunkel und in der Kälte der Nacht im Wald erwachte, streckte er den Arm aus, um das Kind zu berühren, das neben ihm schlief."
Sprich eine Litanei
McCarthys Roman zeigt, dass die häufig geäußerte These, Religion in der Literatur neige zum Kitsch, verallgemeinert nicht stimmt. Auch dass in den USA Literatur mit religiösen Inhalten bloß aus der Feder frömmelnder, missionarisch ambitionierter Literaten entstehe, widerlegt der 1933 geborene McCarthy. In diesem kargen Roman ist Menschenleben auf das Elementarste beschränkt - überleben, essen, trinken, schlafen, nicht erfrieren. "Mach eine Liste. Sprich eine Litanei. Vergiss nicht." - und kommt damit auch bei der Frage nach Gott und Mitmenschlichkeit an, in Gestalt eines Kindes. "Du bist nicht derjenige, der sich um alles Gedanken machen muss", sagt der Vater zu seinem Kind. "Doch, das bin ich", antwortet dieses. "Ich bin derjenige."
Die Straße
Roman von Cormac McCarthy
Deutsch v. Nikolaus Stingl
Verlag Rowohlt, Reinbek 2007
252 Seiten, geb., € 20,50
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!