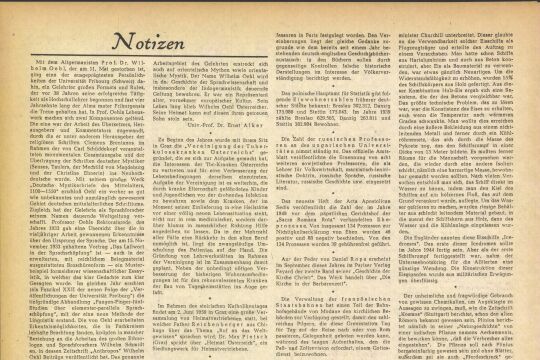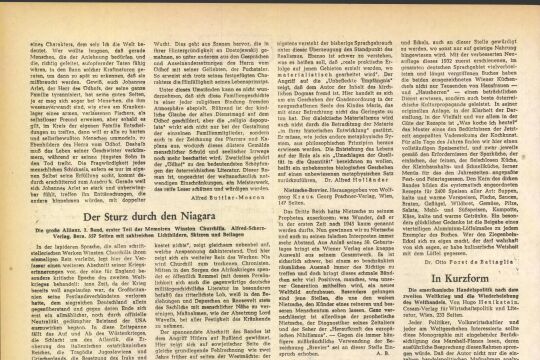Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das fraulein ist blase
Nein, dem Setzer sind keine Druckfehler unterlaufen. Der kuriose Titel will nur zeigen, wie man seit einiger Zeit selbst in den angesehendsten amerikanischen Zeitungen und Magazinen die „tongue franoaise“ und die „Deutsche spräche“ behandelt. (Auch in diesem Satz hat sich der Setzer ganz an das Original des Berichtes gehalten, er hat sich sozusagen amerikanisiert...) Die akzenit- und umlautlose Schreibweise, die sich wehrlose Fremdwörter täglich gefallen lassen müssen, zieht allerdings schwerere Folgen nach sich, als man es dem ersten verblüffenden Anschein nach vermuten könnte. In der* ,Gesellschafts-nachrichten“ großer Tageszeitungen ist ununterbrochen von einem „fiance“ die Rede, der bald heiraten wird, oder von einer „debutante“, die in hochstehende Kreise eingeführt werden soll. Ein französischer Politiker erscheint stets mit dem Vornamen Rene, ein bekannter Dirigent mit dem Vornamen Andre. In den Kreuzworträtseln der „New York Times“ (Fundgrube für alle Karl-Kraus-Jünger, die nach Verballhornungen der Sprache fahnden!) heißt es, um ein paar Beispiele zu zitieren: „above (Germain)“ — über; bekannter deutscher Maler — durer; „warnen in Berlins“ — fraus; „City on the Rhine“ — koln. Einen Haupttreffer leistete sich die Zeitschrift „Saturday Review“, als sie in einem Bericht über einen deutschen Bierkellerbesitzer mitteilte, der Wirt riefe, sobald ihm das Treiben seiner Gäste zu bunt werde, laut und vernehmlich: „Rouse!“ Ein witziger Leser wagte es, den Verfasser dieses „Rouse“-Berichtes mit einer Wette auf zwei Seidel Helles zu überraschen, falls der deutsche Wirt nicht „Rrraus!“ riefe. Vor einigen Tagen hieß es in einem von der „Times“ veröffentlichten Artikel, daß man auf dem ehemaligen Wertausstellungsgelände jetzt viele „haus-fraus“ malen sehen könne. Im gleichen Blatt wird auch fleißig über eine Aufwertung der „Deutsche marks“ orakelt.
Die drucktechnische Ausmerzung der französischen Akzente, wozu auch das fast niemals vorzufindende „c“ zählt, sowie der deutschen Umlaute gehört zu den neuesten Errungenschaften der amerikanischen Presse. Was damit bezweckt wird, läßt sich nicht erraten. Hingegen ist es eine unleugbare Tatsache, daß der Amerikaner — vom „kleinen“ Mann bis zum Fernsehansager — vor Fremdwörtern eine Heidenangst hat. Hätte er das Gegenteil, nämlich einen Heidenrespekt, dann würde man sich bemühen, wenigstens jene fast täglich wiederkehrenden Namen richtig auszusprechen, wie Pompidou und Kiesinger, die der Amerikaner nur als Pömimpidju (mit Betonung der ersten Silbe) und Kisinscher hört und — kennt. Im Rundfunk wird
lebte, bald im Wiederbesitz seiner Freiheit, zumeist in Frankreich von dem Ertrag seiner ununterbrochenen Fischzüge. Die Urkunde, die ich in Händen halte, trägt die Unterschriften von Gregor MacGregor und vier „trustess for the Exchange and Redemption of certain of the out-standing Securities of Poyaisian Territory“ und wurde erst am 28. April 1834 ausgestellt 1839 waren die Taschen Gregors I. leer. Dank der Freundschaft' seines Waffengefährten auf dem Marsche von Ocumare, General Carlos Soub-lette, erhielt er von der Regierung Venezuelas einen seinem hohen militärischen Rang entsprechenden Ruhegehalt. Er starb 59 Jahre alt 1845 in Caracas, verehrt als einer der großen Helden des Befreiungskrieges und treu seinem Wahlspruch NES-CIUS VINCI.
Die Plantagen von Poyais bringen mir nach 150 Jahren doch noch einen Ertrag: Das Zeilenhonorar der „Furche“.
für das deutsche Bier „Lo-enforauw“ geworben, wiewohl das Namensetikett der Flaschen auch für den Export nach Amerika die richtige Schreibart („Löwenbräu“) verwendet. Die Zigarettensorte „du Maurier“ unterstreicht in ihren Riesenanzeigen die (unrichtige) Aussprache: „Say Dew-Moriah!“ Beispiele ähnlicher, noch krasserer Art ließen sich ad infinitum anführen. Die „Amerikanisierung“ von Fremdsprachen in einem von Mitgliedern aller Nationen bewohnten Land ist eine Frage angleichender Freiheit. Man kann es verständlich finden, wenn sich ein chinesischer Einwanderer, fein Pole,“ ein Tscheche, ein, Italiener usw. seinen' Familiennamen anglisieren läßt, da diesen im Original auszusprechen dem Amerikaner oft ein Ding sprachlicher Unmöglichkeit bedeutet. Man kann sogar verstehen, wenn in Amerika geborene Kinder von Einwandererin mit unverändert gebliebenen Familiennamen Taufnamen tragen, die ^typisch“ amerikanisch sind, jedoch zu den „unaussprechbaren“ Zunamen so passen wie die Faust aufs Auge. Man kann es passabel erachten, daß Leibgerichte wie „Frankfurter“ und „Wiener“ in Amerika zu „frankfor-ters“ und weiners“ werden, daß ein Schweizer Fondue („Fondu“) seine Betonung auf der ersten Silbe findet und sein „ü“ in ein „u“ wechselt, daß sich der Lachs in „lox“ und die Bologna-Wurst in „baloney“ verwandeln, daß Automobilisten jetzt in „Wolksuagen“, „Sitrons“ und „Rinolts“ fahren und daß viele andere populär gewordene Dinge ihren verständnisvollen sprachlichen Klang erhielten. Dennoch stellt die beharrliche Mißachtung der grammatikalisch richtigen Schreibart nichtenglischer Wörter ein Novum der jüngsten Zeit dar. Fremdsprachenstudien werden, so nimmt man wohl an, nur von einem geringen Teil der heranwachsenden Jugend betrieben — und der Rest der Leser wüßte wohl mit Akzenten und Umlauten nichts anzufangen. Diese Mißachtung treibt Hochblüten. Kürzlich war in verschiedenen Zeitungen über eine postume Ehrung Fritz Kreislers zu lesen, daß in einer Gedenksendung seine Kompositionen „liebesfreud“ und „liebeslied“ zur Darbietung kämen. Und in dem „sorgfältig redigierten“ Programmbuch eines Spitzenorchesters fanden sich kürzlich nebst der Behauptung, daß Linz eine steiermärkische Stadt sei, nachstehende Blüten sprachlicher Verballhorniung: „Frauelein Obermeyer“, „Viennas' Redoutensall“, der Name des Komponisten Beeth-oven zweimal in dieser Schreibweise getrennt, „Dresden Hopofer“, „Tannhäuser“ usw. Was soll ein Konzertbesucher denken, dem eine Folge von Gesängen Shuberts vorgesetzt wird — oder Balladen Ferdinand Lowes? Ein Historiker, dem Fouche, Goring
und Gobbels begegnen. Ein Literaturbeflissener, der in einem Inserat für handwaschbare Herrenhemden liest: „Voltaire sagte: Tres interessant!“? Das angebliche Unvermögen der Amerikaner, Fremdworte „richtig“ auszusprechen, erhält dadurch eine — allerdings anfechtbare — Untermauerung. Mehr noch: es kommen die mit der Fremdsprache Vertrauten in den Verdacht der Unbildung.
Gerade dort, wo Zeitungen und Magazine von Rang ergänzende erzieherische Aufgaben vorzufinden und zu erfüllen hätten, versagt ihre Macht. Die „Times“, die wiederholt über die „armselige Fremdsprachenkenntnis“ der amerikanischen Jugend leitartikelt, schreibt stets von „open-air-cafes“, verkündete in ihren Anzeigen Stellungssuchen, den Bewerbungsschreiben ein „resume“ beizufügen, und tischt den Leserinnen der „menu“-Sparte „Sauerbraten with knodels“ oder „wiener-schnitzels“ auf.
Die Amerikaner, deren Lust am Buchstabieren bekannt ist, („How do you spell it?“ fragt jede einer Untermittelschule entkommene Büromamsell beim Diktat, sobald ein ungewöhnliches englisches Wort oder gar ein Fremdwort auftaucht), sind wenigstens für ihre Bravourleistungen im 100-Kilometer-Tempo-Buch-stabieren zu bewundern; denn da kommt keiner mit, der diese Kunst nicht auf einer amerikanischen Schulbank erlernt hat. Wehe aber, wenn es darum geht, Namen wie Eisenstein, Esposito, Utrecht oder Salzburg von „Einheimischen“ richtig ausgesprochen zu verlangen! Als ich gtomal einer Brooklyner Miß ver; ständlich machen wollte, daß eine „chaise-longue“ eben keinesfalls ein „tschess-launsch“ sei, wie sie hartnäckig behauptete, gab ich den Lehrversuch nach einstundiger Debatte als geschlagener Mann auf. Erstens behalten in Amerika immer die Frauen recht — und zweitens scheinen angesichts publizistischer Annektierung der Fremdsprachen derartige Reformpläne eines „rou blase“ tatsächlich „passe“ zu sein — oder auf gut deutsch: für die Katz!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!