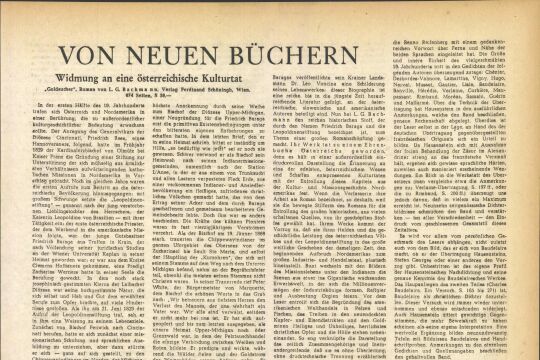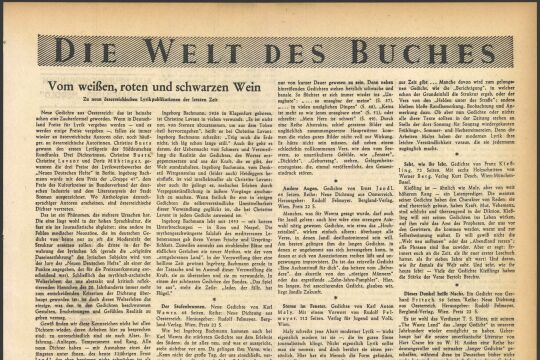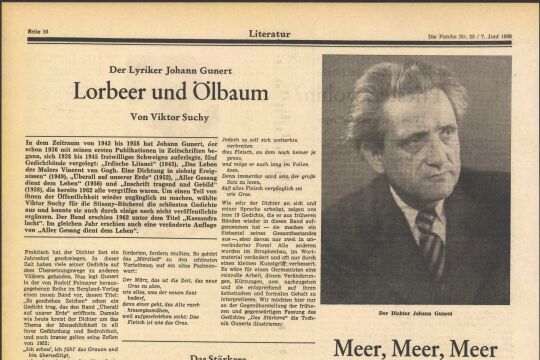Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
DAS GEDICHT IN UNSERER ZEIT
Du gabst im Schlafe, Gott, mir das Gedicht.
Ich werde es im Wachen nie begreifen.
(Weinheber)
Der Ruf der Sehnsucht, Angst oder Trauer, gehauen aus den Steinbrüchen sprachlichen Rohstoffes, geläutert zur Gestalt im Feuer der Form und des Geistes — dringt er noch bis zu uns? Anders formuliert, gibt es das Gedicht noch, wird es noch geschrieben, gelesen?
Eine solche Fragestellung mag vielleicht merkwürdig erscheinen. Warum soll man sich ausgerechnet damit auseinandersetzen, ob es heute noch jemanden gibt, der ab und zu nach einem Gedichtband greift? Die Antwort wird ziemlich eindeutig ausfallen, denn Tatsachen sprechen für sich. Wolf- gang Kayser etwa stellt in der Einleitung zu seinen Untersuchungen über den Roman fest, daß die literarische Ausdrucksform, die unserer Zeit entspricht, eben der Roman ist und nicht das Gedicht. Diese Behauptung wird damit begründet, daß der Roman dem Bestreben nach Auffaltung der einzelnen Schichten des Seins von der Fassade ibis in das Winkelwerk des Unterbewußten besser entgegenkommt als das Gedicht, die Indifferenz der Prosa deshalb der lyrischen Kunstform den Rang abgelaufen hat.
Tatsächlich führt das Gedicht, einst die reinste und höchste Form sprachlicher Kunstübung — könnte man sich etwa Vergils Aeneis oder Dantes Divina Commedia als Prosawerk vorstellen? —, nur noch ein Schattendasein. Immer mehr macht sich verhohlenes Desinteresse geltend, so daß sich die Frage aufdrängt, ob es überhaupt noch existent ist.
Nun, das Gedicht ist auch heute noch da und es wird auch heute noch geschrieben. Ja es gibt sogar in der Nachfolge Benns eine Reihe von Dichtern, die im lyrischen Gedicht ihre ureigenste Ausdrucksform gefunden haben, wie etwa Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Karl Krolow und viele andere.
Und doch wird die Herausgabe eines Gedichtbandes immer mit Schwierigkeiten verbunden bleiben, es sei denn, es handelt sich um Anthologien, die bei den Merseburger Zaubersprüchen beginnen und zu einem Drittel die Lyrik Goethes enthalten. Der moderne Dichter scheint mit seinem Gedicht isoliert zu sein, seine Wohnstätte ist „der Ararat der Einsamkeit“ (Loerke), wo er auf das Neuwerden der Welt wartet.
Gibt es also keinen Platz mehr für den modernen Dichter in der Gesellschaft? Dichter sein ist allerdings kein Beruf im Sinne des Lohnstreifens, auch Leistungs- und Erfolgsdenken, das sich vor allem nach dem Greifbaren und Sichtbaren orientiert, muß an der Existenz des Dichters versagen.
Die Zeiten, in welchen der Dichter als Gesellschafter, Unterhalter, Erzeuger von Hochzeitshymnen, Grabgesängen, Enko-
mien und Preisgedichten aller Art eine echte soziale Funktion hatte, sind vorüber. In den Cohortes praetoriae der Großen des 20. Jahrhunderts scheint der Poetą nicht mehr auf. Dort hat der Dichter längst dem Propagandisten das Feld geräumt.
Ist also der Rückzug aus der Gesellschaft schuld an der tiefen Kluft, die sich aufgetan hat zwischen dem Dichter und — sagen wir — seinem Gesprächspartner, dem Leser?
Die Entwicklung der modernen Lyrik, etwa vor 100 Jahren eingeleitet durch Baudelaire und Rimbaud, fortgesetzt durch die deutschen Expressionisten, zeigt die Tendenz der Ablehnung, ja man kann sagen die Sucht der Zerstörung der Gesellschaft. Damit Hand in Hand geht die immer stärker werdende Isolation des Dichters. Das moderne Gedicht will auch nicht mehr verstanden werden. Das Wort, unter Hintansetzung seiner semantischen Dimension tritt in den Vordergrund, nur noch Medium der Faszination und Evokation verschiedener Assoziationen, Gefühle, Empfindungen.
Benn erläutert diese Artistik des Wortes in seinen „Problemen der Lyrik“ als den Versuch der Kunst innerhalb des allgemeinen Verfalls der Inhalte, sich selbst als Inhalt zu erleben und an diesem Erlebnis einen neuen Stil zu bilden, es ist der Versuch, gegen den Nihilismus der Werte eine neue Transzendenz zu setzen, die Transzendenz der schöpferischen Lust. Damit fordert Benn die Absolutsetzung der Kunst, die Absolutsetzung des Nichts in der Verpackung durch nichts mehr zu steigernden Könnertums, dämonischer Wortmagie verbunden mit zerebraler Artistik.
Wirre Kombinationen, Suibstantiva faszinierend montiert, Reduktion auf Worte, Klänge, Rhythmen, das ist das reine Gedicht, das Gedicht, das nur um seiner selbst willen geschaffen ist, „das Gedicht ohne Glauben, das Gedicht Ohne Hoffnung, das Gedicht an niemanden gerichtet“.
Der Dichter verzichtet also freiwillig darauf, daß sein Wort gehört werde. Er hat sich frei gemacht, die letzten Rücksichten abgeworfen, die ihm bis jetzt auferlegt waren. Wohin führt dieser Weg? Gibt es ein Zurück? Kann dieses Sterilwerden des sprachlichen Kunstwerkes verhindert werden? Verlangt die Sprache, die uns und dem Dichter gemeinsam ist, nicht ihrem Wesen nach und besonders im Kunstwerk in ihrer geläuterten Form, die Kommunikation?
Sicher kann man die Entwicklung der letzten Jahre nicht überspringen. Es ist nun einmal so, der poetą vates, der Träumerdichter, kann in der modernen Gesellschaft nicht mehr bestehen. Er wurde wenig sanft aus dem Schlaf gerissen, und vielleicht hat er noch nicht begriffen. So fügt er Wort an Wort, wie ein Kind seine Bausteine, ohne nach dem Sinn zu fragen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!