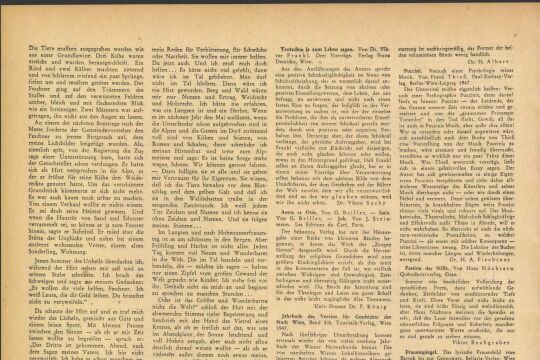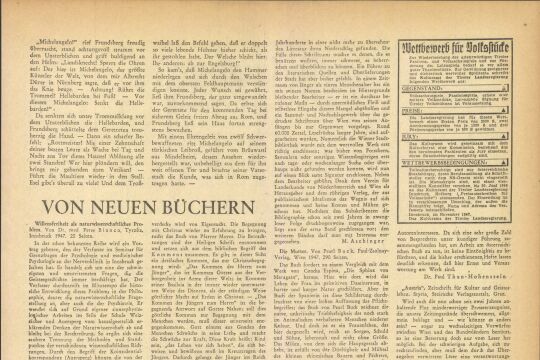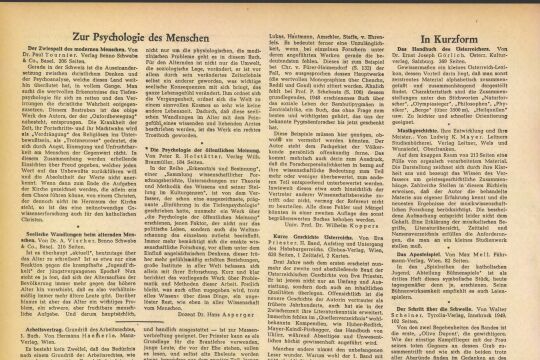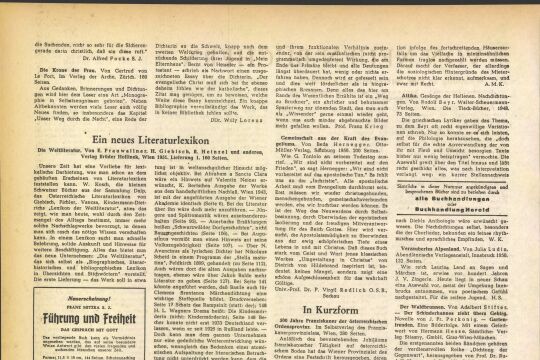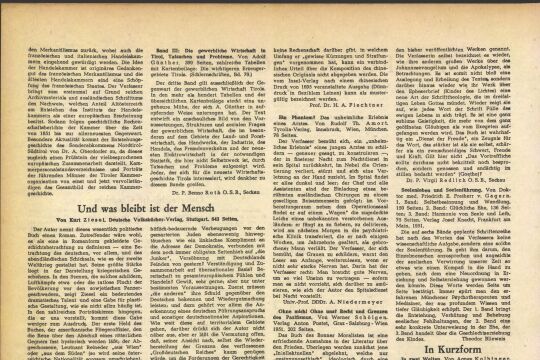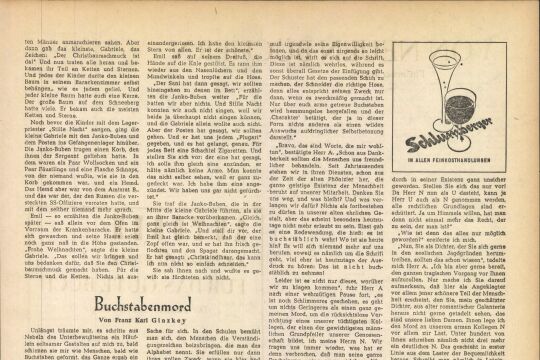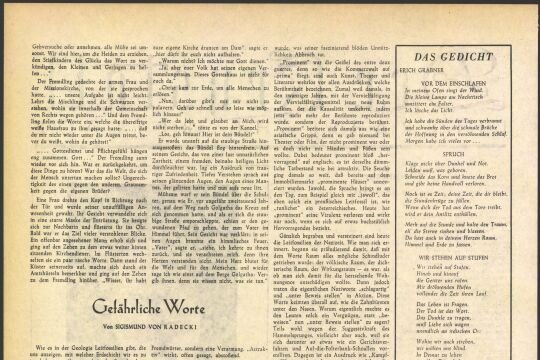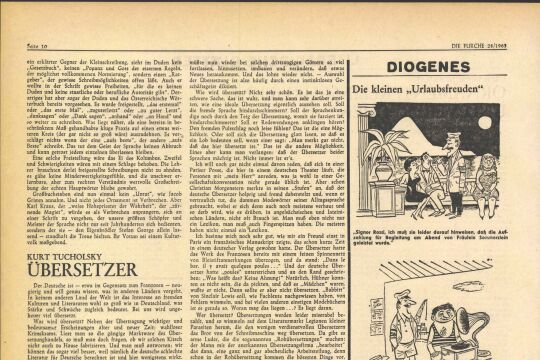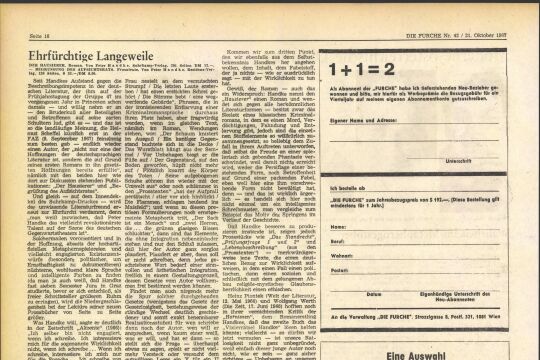Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Gesicht der Worter
Im Femen Osten gilt es als sehr schlimm, „sein Gesicht zu verlieren“. Haben denn auch Wörter ein „Gesicht“, das sie etwa auch noch verlieren könnten? Die armen Chinesen und Japaner haben für jedes Wort ein eigenes Zeichen. Es ist eine sehr mühevolle Arbeit, diese viel tausend Zeichen zu erlernen; aber sie leisten sich diesen Luxus, sie haben eine Wortschrift und damit hat jedes Wort seine unverlierbare Gestalt, eben „sein Gesicht“.
Wir Verstandesmenschen des Abendlandes halten so ein kompliziertes Schriftsystem für rückständig. Wir sollten uns lieber davor hüten, alles mit dem bloßen Verstände beurteilen zu wollen. Die Seele des Menschen ist wie ein schwimmender Eisberg; nur ein Zehntel seines Wesens liegt im grellen Licht des Bewußtseins, die anderen neun tauchen ins dunkle Meer des Unbewußten und Schöpferischen. So liegt auch der Ursprung der Schrift in Urgründen der Seele. Die ersten Bücher aller Völker sind „heilige Schriften“, Hüterinnen der Ueberlieferung, also der Erfahrungen und Kenntnisse langer Geschlechterfolgen.
Das soll uns auch heute mahnen, uns nicht leichtfertig von der Schriftart und der Schreibung zu trennen, die von unseren Vätern in jahrhundertelanger Entwicklung geschaffen wurde und mit der unser Heimat- und Volksgefühl verbunden ist.
Wenn man genau und aufmerksam hinschaut, dann entdeckt man, daß auch wir eine „Wortschrift“ haben, obwohl unsere Wörter aus Buchstaben zusammengesetzt sind. Uns, in.der Mitte des Abendlandes, ist eine Synthese, eine echte Vereinigung der beiden gegensätzlichen Möglichkeiten gelungen. Wir bauen unsere Wörter aus Lautzeichen (wie jene Völker, die heute erst lesen und schreiben lernen), aber wir sind nicht bloß keine Analphabeten mehr, sondern wir sind auch dem „Alphabeten-tum“ längst entronnen. Wir buchstabieren nicht beim Lesen, sondern packen das ganze Wort (ja manchmal eine ganze Wortgruppe) mit einem Blick unserer Augen, also „simultan“. Das ist aber nur möglich, weil jedes Wort seine charakteristische Form, seine eigene Gestalt, sein „Gesicht“ hat. .■' ' ♦ :■'<
Das Wortbild steht aber unter dem Gesetz des Auges und nicht unter dem des O h-r e s. Wir dürfen uns also nicht wundern, daß unsere Schreibung nicht mehr so 1 a u 11 r e u ist wie in den mittelalterlichen, Anfängen. Die Schrift hat selbständiges Leben gewonnen. Der beste Teil unseres Schrifttums besteht aus Sätzen, die wohl vorgelesen, aber nicht gesprochen werden können. Ein geschriebener Satz hat einen Rhythmus, ein Gefälle, einen gedanklichen Aufbau, der anderen Bedingungen gerecht wird, als der gesprochene Satz es tun muß. Wer seine Sprache nur durch das Ohr erlernt hat', vergißt sie in fremder Umgebung; wer sie schreiben und lesen kann, dem haftet sie. Erst durch die Optik (und durch die Motorik beim Schreiben) wird eine Sprache befestigt.
Was für die Sprache als Ganzes gilt, stimmt erst recht für das einzelne, geschriebene Wort. Es gehorcht der optischen Konsequenz, nicht der phonetischen. In der römischen Steinschrift war jedes Wort ein einfaches Band. Man hatte ja Zeit, die Inschrift zu entziffern. Als aber die Mönche des Mittelalters ganze Bücher schrieben, da sind gewisse Buchstaben aus dem Band oben und unten herausgewachsen. Das Wort bekam Arme und Beine, aus dem gestaltlosen Wurm wurde ein Gliedertier. Welche Buchstaben waren das? Nun, die k, t, p, g, d, b, kurz gesagt: die Mitlautbuchstaben. Die Selbstlaute blieben brav im Wortband. Man kann ja die Wörter meistens auch dann lesen, wenn die Selbstlaute ausgelassen werden. Dieses Experiment kann jeder machen. (Was heißt etwa Schrftbld oder Bchstb?) Dieser Prozeß ist bei der deutschen Schrift weiter gediehen als bei der zur Renaissancezeit künstlich wiedereingeführten lateinischen. Bei dieser bleiben s und z und x im Zwischenraum, während sie in der „gotischen“ Schrift ihrer Aufgabe, am Wortskelett mitzubauen, gerecht werden. Die „Halbselbstlaute“ m, n und r bleiben in beiden Schriften in Deckung. Deshalb setzt man ihnen gerne ein stummes h vor, um dem Wort dennoch eine Form zu geben. Das stumme h kommt auch vor 1 vor, weil das 1 in alten Lettern den Zwischenraum nur wenig überragt hat.
Seit etwa 300 Jahren hat nun eine bestimmte Wortsorte sogar einen Kopf bekommen, einen großen Anfangsbuchstaben. Es sind jene Wörter, die häufig den Ton tragen und deren Heraushebung daher die Uebersicht über den Satz gewaltig fördert und ein flüssiges, sinnvolles Lesen gestattet. Diese Großschreibung macht nun manchen Leuten arge Kopfschmerzen. Sie haben sich aber ein einfaches Rezept zurechtgelegt. Wenn der Kopf weh tut, dann weg mit dem Kopf! Das heiße ich „das Kind mit dem Bade ausschütten“. Wäre es nicht einfacher, die alte, klare Regel wieder aufzunehmen, daß nur v/irkliche Substantiva („Hauptwörter“) groß geschrieben werden? Für die „Zweifelsfälle“ aber wage ich (allen Wörterbüchern zum Trotz!) um — Freiheit zu bitten. Wer sich nicht in die Unkosten einer genaueren Ueberlegung stürzen will, soll in solchen Fällen ruhig klein schreiben. Aber er soll auch den anderen, die gerne feinere gedankliche Linterschiede mit Hilfe der verschiedenen Schreibung herausarbeiten möchten, dies nicht verbieten.
Im übrigen aber wird es das beste sein, die Schreibung in Ehrfurcht so zu lassen, wie sie ist. Denn die tz, die ß, die stummen h und stumme e und auch die großen Anfangsbuchstaben der Hauptwörter sind keine „barocken Floskeln“ (wie man oft sagt), sondern Forme 1 e 1 e m e n t e, die wesentlich mithelfen, den Wörtern ihr „Gesicht“ zu geben. Wer schreibt oder setzt, muß sich zwar ein bißchen anstrengen, dadurch haben es aber jeweils Tausende von Lesern leichter. Hüten wir uns, die Architektur unserer Wortbilder bis zum Barackenstil abzubauen, es könnte sein, daß nicht bloß ein Wortbild, sondern auch unsere Kultur das Gesicht verliert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!