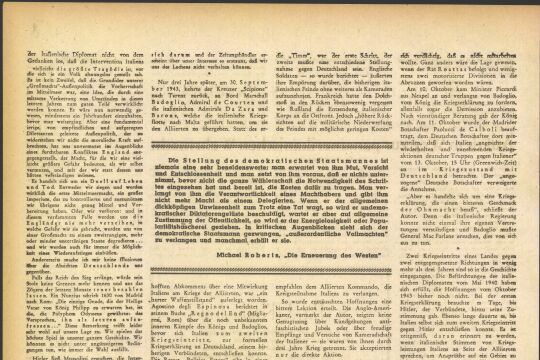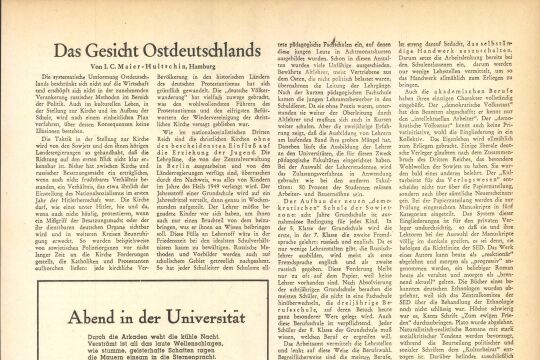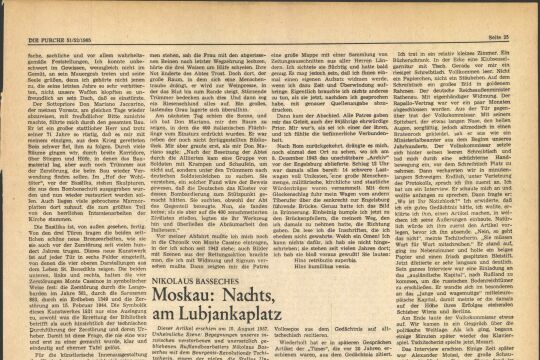Das Lager ist grau. Es liegt irgendwo, und sein Name ist unwichtig, denn es gibt viele solcher Lager, und eins trägt das Gesicht des anderen. Das Gesicht ist grau wie der Novembernebel, wie der Regen, der von den Dächern rinnt, und wie der Schotter der Straße, die draußen vorbeiführt. Das Lager ist irgendwann in der Vergangenheit geboren worden, an einem schönen Tag vielleicht, an dem die Sonne schien, die Fahnen an hohen Masten hingen, grüne Girlanden die Toreinfahrt schmückten und die Kommandostimmen, das Knallen von Stiefelabsätzen und klingende Marschmusik die Luft erfüllten. Vielleicht hat jemand eine Rede gehalten, ein Gauleiter, der längst verschollen ist, oder ein Reichsärbeitsdienst-führer, der heute irgendwo in einem kleinen Nest in Schleswig seifte Pension bezieht. So wird es angefangen haben: mit frischgestrichenen und gut geteerten Baracken, mit ordentlichen Straßen, mit überfüllten Kantinen, blitzend sauberen Küchen und grünen Gärten, die hinter den Baracken lagen. Und dann kamen die Jahre und mit den Jahren das Schicksal des Lagers, und aus dem heiterstrengen Gesicht wurde langsam ein hartes, zerfurchtes, graues Gesicht, das Gesicht von heute, in dem Leid, Grausamkeit, Trauer, Kummer und Tragik steht. Aber •immer hat dieses Lager seinen Zweck erfüllt. Es hat vielen Herren gedient, und Menschen aller Nationen, aller Klassen und fast aller Rassen sind durch seine Baracken gezogen, Immer diente es, aber nicht den Menschen, die in den Baracken wohnten, sondern den Mächten, die sie dort hinbeordert hatten, der Regierung, dem Staat, und Staat und Regierung wechselten, ohne daß das Lager seinen Zweck veränderte. Es diente dem staatspolitischen Zweck. Es diente, als mit den Einweihungsfeiern der Reichsarbeitsdienst in die Baracken zog; es diente, als der Staat seine politischen Gegner konzentrierte und sie in Lagern zusammentrieb; es diente, als die Rassenverfdlgung begann und die Juden konzentriert und vernichtet wurden; es diente, als im Krieg die russischen Gefangenen durch das Einfahrtstor marschierten; es diente, als später die politisch verdächtigen Franzosen und Belgier kamen; es diente, als die Angehörigen der SS in den Baracken interniert wurden, und es diente, als die heimatlosen Letten hier vorübergehend LTnterschlupf fanden. Immer war es Mittel zum Zweck, kein humaner Zweck und kein humanes Mittel, aber im Sinne der Regierenden staätspolitisch notwendig.
Nun aber hatte es seinen Sinn und seinen Zweck verloren. Es stand da im Regen, unter einem bleischweren Himmel, grau und alt geworden. Die Türen hingen in den Angeln, die Dächer begannen rissig zu werden, der zuletzt noch grüne Fliegertarnungsanstrich war verwaschen, schmutzig gelb und grau, die Straßen waren verwildert, mit Gras und Unkraut überwachsen, und die Schuttberge hinter den Baracken türmten sich bis an die Spitzen der Dachsparren. Nur das christliche Kreuz, das orthodoxe Kreuz, und den jüdischen Davidstern über den Massengräbern hatte die Zeit und der Verfall verschont. Ja, es sollte abgerissen werden, das Lager. Man schrieb 1949, und es hatte keinen Sinn mehr. In der nahegelegenen Stadt sprach man davon, daß die Landesregierung sich, mit den Grundstückseigentümern nicht über die Höhe des Schadenersatzes einigen könne. Und das Lager stand da, an der Straße mit dem grauen Schotter, wie ein Polyp und wartete. Es hatte Menschen, Ströme von Menschen angezogen und abgestoßen, und es wollte wieder Mepschen anziehen und abstoßen wie bisher. Und dann geschah es. Uber Nacht wurde das Lager selbständig, wurde aus einem Dienenden zu einem Herrschenden und zeigte sich plötzlich stärker als alle Abbruchsgef Uchte. Es hatte seinen eigenen Zweck gefunden, und es zeigte sich als das, was es wirklich war: als Symbol unserer Zeit und vielleicht als das alles bedrohende Schicksal von morgen.
DIE NEUEN LAGERBEWOHNER
Und sie kämen, die neuen Lagerbewohner, sie kamen durch das Einfahrtstor an einem Nachmittag im Herbst des Jahres 1949, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche, Greise und Mütter, ein endloser Zug. Sie kamen, als hätte das Lager sie angezogen; sie kamen aus allen Nationen: Ungarn, Polen, Spanier, Ägypter, Jugoslawen, Russen; sie kamen aus allen Weltanschauungen: Kommunismus, Faschismus, Demokratie; sie kamen aus allen Klassen: Bürger und Bauern, Arbeiter und Soldaten. Sie kamen, und niemand war daran interessiert, sie hieher ZU schicken, weder der Staat, noch eine Regierung, noch eine Partei. Alles, was sie trieb, war ihr eigenes Verlorensein. Sie waren überflüssige und überzählige. Niemand wollte sie mehr haben, weder ihre Klasse, noch die Vertreter ihrer Weltanschauungen, noch ihre Nationen. Niemand wollte sie bestrafen oder konzentrieren oder zu irgend etwas verwenden, so wie es früher mit allen beabsichtigt war, die durch das Lager zogen. Sie waren Verlorene, so wie das Lager gestern noch verloren war, und das Lager hatte sie angezogen, magisch fast und unerbittlich. Sie zogen in die Baracken, in denen die Türen in den Angeln hingen, in denen die Fenster mit Pappe verklebt waren, und in denen es keine Zimmer, sondern nur immer einen einzigen großen Raum gab. Sie legten sich auf die Betten, untereinander und übereinander, Männer neben Kinder, Spanier neben Russen, Jugoslawen neben Polen, ehemalige Kommunisten neben ehemalige Faschisten, ein buntes Durcheinander aller Nationen, aller Weltanschauungen, aller Schicksale. Und sie liegen auf den Betten und warten Tag für Tag und Nacht fftr Nacht, und niemand weiß worauf, und sie selbst wissen es auch nicht. Ihr Schicksal ist eingefroren.
DER ROTSPANISCHE HAUPTMANN
Da sitzen die beiden Spanier in einer Ecke auf dem Holzbett und unterhalten sich in ihrer Sprache. Ihr Weg war weit bis zu diesem Bett, er führte in einer dunklen Nacht über die Pyrenäen, und er begann, als in Madrid die Revolution ausbrach. Ja, sie waren Republikaner gewesen, beide, und sie sind es vielleicht immer noch. Sie haben bei Alicante und Teruel gekämpft, und einer von ihnen, Francisco Gerdalles, ist Hauptmann in der rotspanischen Armee gewesen. In einer Nacht ist er über die Pyrenäen gegangen, unter den Nachzüglern der geschlagenen rotspanischen Armee, auf die rettende französische Grenze zu. In Frankreich aber wartete nicht die Freiheit, sondern das Konzentrationslager, und hinter den Stacheldrahtzäunen am Strand von Saint-Cyperien ging das Sterben weiter, an Hunger und Typhus, an Überanstrengung und an Ruhr. Und der zweite Weltkrieg begann. Französische Werber kamen in das Lager,, und die Alternative hieß: kämpfen in der französischen Infanterie oder sofortiger Abtransport nach Spanien. Spanien, das war der sofortige Tod, und die französische Infanterie, das war der Tod mit Bewährungsfrist, und Francisco Gerdalles entschloß sich für die französische Infanterie. Der rotspanische Hauptmann kämpfte voller Verzweiflung am Westwall, im Elsaß, bei Verdun als französischer Poilu und verlor zum zweitenmal, wurde gefangengenommen, wurde gegen das Versprechen, als Arbeiter in die OT einzutreten, freigelassen und arbeitete am Atlantikwall gegen seine Überzeugung für die Faschisten. Aber eines Nachts standen die Viehwaggons auf dem Bahnhof von Le Havre, die sie nach Rußland brachten. Das war 1944. Die Russen waren überall im Vormarsch, und der ehemals rotspanische Hauptmann geriet in russische Gefangenschaft. Da er Spanier war und auf der Seite der Deutschen gekämpft hatte, sperrten sie ihn als Faschisten mit den Angehörigen der spanischen Blauen Division in das gleiche Lager. Der rotspanische Hauptmann teilte das Schicksal des weißspanischen Offiziers, und keine Unterschiede waren mehr sichtbar, als die der schweigenden Verbissenheit. Aber nach dem Kriege gelang es ihm doch, den Russen klarzumachen, daß er bei Teruel, bei Alicante und in Barcelona auf der Seite der Roten, wenn auch nur als Republikaner, gekämpft hatte. Und die Russen entließen ihn. Er zog nach Leipzig, kaufte sich ein Auto und lebte vom Schwarzhandel. Aber eines Tages wurde die spanische Kommunistische Partei drüben neu gegründet, und er bekam die Aufforderung, dieser Partei beizutreten. Er weigerte sich, immer noch ein überzeugter Republikaner, Drohungen kamen, und immer schärfer wurde die Aufforderung zum Beitritt zur spanischen Kommunistischen Partei. Im Herbst 1949 kam von guten Freunden die Warnung, daß seine Verhaftung vor der Tür stände, und in der Nacht darauf floh Francisco Gerdalles über die Zonengrenze, ging zum Flüchtlingskommissar in München, der nichts mit ihm anzufangen wußte, und irgendein kleiner Beamter drückte ihm einen Zettel in die Hand, der nichts anderes war als ein Freifahrschein in dieses Lager. Und der rotspanische Hauptmann, klein, zierlich, mit melancholischen dunklen Augen, im weißgestreiften, blauen Anzug sitzt auf dem Bett und wartet, sinnlos, verloren, immer noch Republikaner, und langsam frißt sich der Haß in ihm fest gegen alles und alle. Wenn aber das Bett über ihm unter dem schweren Körper des Russen, der sich dort hin und her wirft, knarrt, dann blickt er etwas verächtlich nach oben.
DER RUSSISCHE JAGDFLIEGER
Kostja Wagow war Kommunist, ein begeisterter Idealist, der mit sechzehn Jahren seinen Eltern in Leningrad davonlief, um in Südrußland in eine Fliegerschule einzutreten. Er hatte Glück, er kam schnell vorwärts, und als der Krieg begann, galt er als einer der hoffnungsvollsten jungen Jagdflieger in seinem Geschwader. Nach den ersten Abschüssen wurde er zum Leutnant befördert, die Orden auf seiner Brust häuften sich, und bei seinem sechzehnten Abschuß bekam er den Lenin-Orden. Aber dann kam der unglückliche Luftkampf über Woronesch, Kostja wurde abgeschossen und hinter den deutschen Linien gefangengenommen. Die Fahrt in die Gefangenschaft begann, der Hunger begann, und die Verzweiflung kam. Der Stacheldrahtzaun war unüberwindbar, und die Kartoffelschalen wurden von Tag zu Tag stinkiger. Offiziere der Wlassow-Armee kamen in das Lager und warben mit viel Versprechungen für den Kampf gegen Stalin. Und der ehemalige Jagdflieger ließ sich anwerben, nicht aus Überzeugung, sondern weil der Hunger die Därme zerriß und kein Ausweg mehr sichtbar war. Der Jagdflieger wurde Kavallerist. Mit den Kosaken zusammen ritt er in seine Heimat zurück. Aber sie wurden geschlagen und zurückgetrieben, Woche für Woche und Monat für Monat, bis er in der Tschechoslowakei in amerikanische Gefangenschaft geriet. Wieder saß er hinter Stacheldraht, und wieder kamen russische Offiziere in das Lager, aber keiner von ihnen bemerkte, daß er bei Wlassow gekämpft hatte. Er fuhr zurück nach Rußland als befreiter Gefangener, kam in ein Arbeitslager bei Kiew zur vorläufigen Säuberung vom westlichen Einflüssen, floh nach zehn Monaten und befand sich zu Beginn des Jahres 1947 wieder in Deutschland. Aber Deutschland war ein geschlagenes Land, ein hungerndes Land ohne Zukunft. Der ehemalige russische Jagdflieger ging nach Frankreich, ließ sich bei der Fremdenlegion anwerben und fuhr wenige Monate später auf einem Truppentransporter nach Indochina. Der Kampf in Sumpf und brütender Hitze begann, ein hinterhältiger Kampf, der die Nerven zerstörte, den Körper lähmte und das Blut schwer und dickflüssig machte. Das Fieber kam und warf ihn ins Lazarett. Und Kostja floh, desertierte nach seiner Heilung aus der Fremdenlegion, kam auf einem Frachter in Marseille im Frühjahr 1949 an, wurde verhaftet, eingesperrt und in einer Herbstnacht von der französischen Gendarmerie nach Deutschland gebracht. Zuerst in die französische Zone und dann an die amerikanische Zonengrenze, wo man ihn mit der Weisung laufen ließ, sich nie wieder in Frankreich blicken zu lassen. Er wanderte und bettelte sich durch von der französischen Zonengrenze bis nach München, ging dort zum Flüchtlingskommissar, der nichts mit ihm anzufangen wußte, und ein kleiner Beamter drückte ihm einen Zettel in die Hand, der nichts anderes war ls ein Freifahrschein in dieses Lager. Und der erfolgreiche russische Jagdflieger, einmal ein Held der Sowjetunion, liegt auf dem Bett und wartet. Seine französische Uniform ist zerrissen, seine weißen Tennisschuhe haben Löcher, und in seinem breiten, starkknochigen Gesicht sitzt die Verzweiflung. Wenn aber die Malaria ihn quält, lacht der SS-Mann aus Luxemburg, der nicht weit von ihm liegt, und der ebenfalls in Indochina fast zur gleichen Zeit gekämpft hat, und gibt ihm Ratschläge und Verhaltungsmaßregeln.
DER SS-MANN AUS LUXEMBURG
Auch er, Henry Sturm, ist ein Idealist gewesen, ein jugendlicher Idealist, begeistert für Adolf Hitler und den Nationalsozialismus. Er war Kochlehrling in Luxemburg, hatte sich nach dem Einmarsch der Deutschen freiwillig zur SS gemeldet und war auf der SS-Junkerschule in Spandau ausgebildet worden. Dann kam der Einsatz in Rußland, Tag für Tag, Angriffe, Gegenangriffe, und schließlich wurde er bei Charkow verwundet. Er wurde aus dem Hexenkessel herausgeflogen und in einem Lazarett in Krakau ausgeheilt. Nach seiner Heilung kam er nach Italien und dann 1942 nach Afrika zur SS-Bewachungsmannschaft einer Bewährungskompanie, die aus ehemaligen Konzentrationslagerhäftlingen und aus Deserteuren bestand. Und der junge SS-Mann aus Luxemburg zeigte sich von seiner straffen Seite. Es hagelte Hiebe für die Bewährungssoldaten, es wurde geschlagen und getreten, und wo die Fußtritte nicht halfen, dort half die Peitsche, die blutige Striemen über die Rücken der Häftlinge zog. Henry Sturm war kein Sadist, sondern ein Idealist, aber er war für die Ordnung, und Ordnung hieß für ihn Erziehung durch Terror. Aber eines Tages zeigte er sich von seiner menschlichen Seite. Nach einem schweren Tag bei El Alamein teilte er seine Schnapsration mit seinen Häftlingen, wurde dafür verraten und zur 99. leichten Division an die Front versetzt. Bei dem Gegenangriff bei El Alamein kam er in Gefangenschaft, wurde den Amerikanern übergeben, kam nach Amerika, arbeitete dort auf einer Farm, drei Jahre lang, und wurde nach Ende des Krieges den Franzosen übergeben. Und die Sühne begann. Zuerst Schwerarbeit in einem französischen Bergwerk, dann Abtransport in ein SS-Straflager nach Afrika. Alles wiederholte sich an ihm, er wurde geschlagen und getreten, und die Peitschen der französischen G~nr'-tr-merie zogen blutige Streifen über seinen Rücken. Eines Tages wurde er zur Bestrafung wegen Widersetzlichkeit eingegraben, bis zum Hals im Wüstensand, mit dem Kopf in der Sonne. Und er kapitulierte. Freiwillig meldete er sich zur Fremdenlegion und fuhr auf einem Truppentransporter wenige Wochen später nach Indochina. Das war 1948, wenige Tage nachdem auch der russische Jagdflieger Indochina auf einem ähnlichen Truppentransporter erreicht hatte. Beide kämpften sie Monate hindurch, fast Schulter an Schulter, gegen den gleichen Feind, der nicht ihr Feind war. Und beide waren keine Idealisten mehr. Auch der SS-Mann aus Luxemburg desertierte, floh aus der Fieberhölle des indochinesischen Sumpfes, besorgte sich Kokain und fuhr als blinder Passagier zwischen Heringsfässern und Verpflegungsballen zurück nach Frankreich. In Lyon griff ihn die französische Gendarmerie auf, sperrte ihn als Kokainschmuggler für ein paar Wochen ein und schob ihn ab nach Luxemburg. Aber Luxemburg wollte den ehemaligen SS-Mann nicht mehr. Er wurde verhaftet, vor ein Gericht gestellt, für zwanzig Jahre des Landes verwiesen und nach Deutschland abgeschoben. Eines Tages betrat auch er, nach einem vergeblichen Versuch, vom Schwarzhandel zu leben, und nach einem mißglückten Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft, das Büro des Flüchtlingskommissars in München, bekam von jenem kleinen Beamten den gleichen Schein, den auch Kostja Wagow bekommen hatte, und fuhr in das graue Lager, das auf ihn wartete. Und so liegt auch er auf dem Bett und wartet, in blauer, ehemaliger Sträflingskleidung, mit weißblonden, strähnigen Haaren, die ihm oft wirr ins Gesicht fallen, lang, hager, dünn, mit einer dicken, roten Narbe über der Stirn. Und wenn er sich ein wenig umdreht, kann er schräg gegenüber, in der anderen Ecke der Baracke, Andre Mihalovi6 auf seinem Bett liegen sehen.
DER JUGOSLAWISCHE PARTISAN
Ja, er war Partisan. Er kämpfte in den serbischen Bergen für Jugoslawien. Als Maschinengewehrschütze in einem jugoslawischen Regiment erlebte er den schnellen Zusammenbruch der jugoslawischen Armee in der Nähe der deutschen Siedlung Karlsdorf. SS-Formationen griffen sie mit überlegenen Panzerkräften an und warfen sie aus ihren Stellungen. Und Andre Mihaloviö floh in die Berge, schloß sich den Partisanen an und kämpfte unter Tito für Jugoslawien. Aber er war kein Kommunist. Er glaubte an Jugoslawien. Doch immer stärker wurde der Einfluß der Kommunisten, immer mehr Instrukteure kamen aus Rußland, und an Stelle der freien Entscheidung trat die politische Disziplin, trat die Weltanschauung und die Generallinie. Und Andre Mihalovic floh. Er floh nach einem Partisanenunternehmen, dessen Führung man ihm übertragen hatte, und das mit einer Niederlage und schweren Verlusten endete. Er floh aus Angst vor dem Partisanengericht, das ihn standrechtlich abgeurteilt hätte, floh über die Berge, schlich sich durdi die deutschen Linien und kam nach Wien. Verbarg sich in Wien monatelang und erlebte den russischen Einmarsch dort. Er trat als befreiter Slavenarbeiter auf, bekam erhöhte Lebensmittelrationen, trieb unter den Amerikanern Schwarzhandel, begann mit Brillanten zu schieben, verübte mit einer Bande einige Einbrüche und entzog sich der Verhaftung durch Flucht nach Deutschland. Von Deutschland ging er nach Frankreich, kam nach Marseille und ließ sich als Matrose auf einem Frachter anheuern, der zwischen Afrika und Frankreich verkehrte. Sie schmuggelten Gold, die Matrosen, schmuggelten es in ihren Betten, unter den Decken, in ihren Koffern. Aber Andre Mihalovic wurde entdeckt, verhaftet und saß ein Jahr in französischen Gefängnissen. Wieder entlassen, ging er erneut zur See, wiederum von Marseille aus, und schmuggelte Kokain von Indochina nach Frankreich. 1948 wurde er zum zweiten Male verhaftet in dem Augenblick, als er an Land ging. Die französische Gendarmerie ging nicht mehr sanft mit ihm um, sie wollte ihn erschießen, denn auf Kokainschmuggel stand der Tod, wenn er auf den Schiffen entdeckt wurde. Aber sie hatte ihn eist erwischt, als er sich schon in Marseille an Land befand. Sie sperrte ihn ein, ließ ihn ein halbes Jahr ohne Verfahren hinter schwedischen Gardinen sitzen und schob ihn nach Deutschland ab in die amerikanische Zone. Und Andre Mihalovic ging nach München, stahl sich ein Fahrrad unterwegs und meldete sich bei dem kleinen Beamten im Vorzimmer des Flüchtlingskommissars. „Wo kommen Sie her?“ fragte der Beamte. „Aus der Tscheche)'“, sagte Andre Mihalovic. „Politisch?“ fragte der Beamte. „Ja, politisch“, sagte Mihalovic. Und er bekam den Freifahrschein in das graue Lager. Nun liegt er auf dem Bett und wartet, liest einen Kriminalroman nach dem andern, mit hastigen, irrlichternden Augen. Sein Gesicht ist mit leichten Pusteln übersät, kleinen, roten Pusteln, und in seinen mandelförmigen Augen sitzt hinter einem verschwommenen Blick die Verschlagenheit.
DER ESTNISCHE MAJOR
Hinter der Pferdedecke, die sie von dem nächsten Bett trennt, liegt Alexander Lewoll, einmal Hauptmann in der estnischen Armee, bekannter Turnierreifer in den baltischen Staaten, einmal eine Hoffnung dieser kleinen Armee und jetzt ein Hoffnungsloser, wie sie alle. Als der Krieg begann, lag er mit seiner Nachrichtenkompanie an der russischen Grenze, aber die Russen kamen erst einen Monat später, besetzten die baltischen Stützpunkte und begannen im Einvernehmen mit ihrem deutschen Paktpartner die Russifizierung des Baltikums. Im Juni 1940 kam es zu jenem Aufstand, der den Kommunisten und damit den Russen die Macht in den baltischen Staaten endlich in die Hand gab. Die estnische Armee wurde in die russische überführt, und der estnische Hauptmann wurde ein Hauptmann in russischer Uniform. Er haßte die Russen, aber als der Krieg mit Deutschland begann, kämpfte er auf russischer Seite, machte den russischen Rückzug mit, wurde wegen Desorganisation seiner Kompanie vor ein Kriegsgericht gestellt und zum Tode verurteilt. Aber bevor seine Exekution erfolgen konnte, brachen die Deutschen an der ganzen Front durch. Alexander Lewoll lief in dem Durcheinander der Kämpfe zu den Deutschen über, kam in Gefangenschaft und wurde mit den russischen Gefangenen in ein Lager bei Königsberg gebracht. Alle Versicherungen und Beschwörungen halfen ihm nichts, er wurde als Russe behandelt, hungerte, fror, mußte schwer arbeiten und verlor seine Sympathie für die Deutschen endgültig. Erst ein Jahr später wurde er nach Estland entlassen, kam nach Tallin und meldete sich dort bei dem Polizeipräfekten, um bei der Polizei unterzukommen. Aber er wurde abgewiesen mit der Begründung, er habe auf der Seite der Russen gekämpft, und sei daher als Kommunist zu betrachten. Und der ehemalige Hauptmann wurde Fabrikarbeiter in Reval. 1943 verging, und die ersten Rückschläge kamen. Die Frei-willigendivision „Estland“ wurde aufgestellt. Alexander Lewoll wurde aufgefordert, sich als Hauptmann freiwillig zu melden, aber er lehnte es ab. Er wollte nicht wieder auf einer Seite kämpfen, die nicht die seine war. Er lehnte es ab, bis der Befehl kam, der ihn zur Freiwilligendivision „Estland“ einberief. Lewoll kämpfte wieder, als Hauptmann gegen die Russen, machte alle Rückzüge mit, wurde schließlich zum Major befördert und bei Breslau von den Russen gefangengenommen. Aber der Major floh noch in der gleichen Nacht, erreichte Monate später die Elbe und ergab sich den Amerikanern. Die Amerikaner sperrten ihn ein, zuerst in ein Internierungs-lager und schließlich in ein DP-Lager. So führte auch sein Weg eines Tages zu dem Flüchtlingskommissar in München mit falschen Angaben, er sei ein Pole, und auch er bekam den Freifahrschein in das graue Lager. Sein Gesicht ist hager und eingefallen, seine Augen sind die Augen eines Hoffnungslosen, und sie beginnen nur zu glänzen, wenn er von seinen Siegen bei den großen Turnierrennen in Riga oder Reval erzählt. Er hat immer auf der falschen Seite gekämpft, und er weiß, daß es keine Heimkehr mehr für ihn gibt.
Und so warten sie alle, einer neben dem anderen, Schicksal neben Schicksal, jeder von ihnen ein Stück Zeit und ein Stück Zeitgeschichte, Alle gleich hoffnungslos, heruntergekommen, zum Teil verwahrlost, viele schon kriminell geworden, Treibgut des Krieges von gestern und Mahnung und Warnung vor dem Krieg von morgen. Denn das graue Lager wartet, wartet auch auf uns. Es liegt da, grau und verfallen an der Schotterstraße, wie ein Polyp. Es hat sich selbständig gemacht und liegt am Rande unseres Lebens gleich einem Alpdruck, den wir noch nicht spüren. Morgen schon kann es in unser Leben treten und stärker sein als wir, denn nicht die Fahnen und Standarten der Weltanschauungen, nicht der Galgen, und nicht die Atombomben sind die wahren Symbole unserer Zeit, sondern das graue Lager, das Lager der Hoffnungslosen. Es ist das Schicksal unserer Zeit, kein heldisches und heroisches Schicksal, sondern ein schleichendes, graues, eintöniges Schicksal. Wir werden es nicht verruchten können, bevor wir es nicht in uns selbst überwunden haben.
Aus den „Frankfurter Heften“ Nr R, Jahrgang 1950.