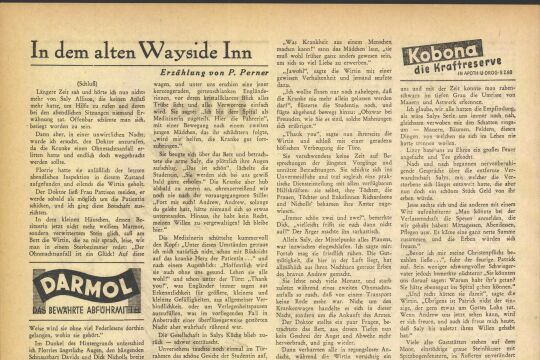Es gibt eine häufige und von den meisten als angenehm gepriesene Erscheinung, eine, die dazu ist, daß wir uns auf der Welt einfacher zurechtfinden. Sie ist auch menschlich; ich empfinde sie aber vielmehr als etwas Lebensfremdes und allzu Zeitgebundenes, als ein immer mehr belastendes Erbe historisierender Aufklärer. Verschiedene Zeitabschnitte, kleinere und größere regionale Einheiten, kulturelle, wirtschaftliche und politische Entwicklungsstadien der Geschichte werden nämlich zuweilen von ihrem umgebenden Lebenskreis abgesondert, aus ihrem Entwicklungsgang herausgerissen, mit eigenen Namen und Epithetons versehen, überstempelt und somit — für die Augen des Betrachters — zum Erstarren gebracht. Die mehr oder weniger willkürlich vorgenommenen Eingriffe schneiden zusammengehörende, sich einander widerspiegelnde Glieder auf dem pulsierenden Körper der Geschichte entzwei. Auch das i6t eine Art Vivisektion.
Dieser Vorgang beginnt schon in der Schule. In der Beurteilung des Mittelalters waren wir zum Beispiel recht kurz und bündig. Wir nannten es — auf direkte Weisung unseres alten Meister hin — „dunkel“. Die auf den Schulgängen, aufgehängten Innenansichten verschiedener mittelalterlicher Kathedralen waren nämlich wirklich sehr dunkel. Nehmen wir noch an, daß wir über gewisse finstere Geschehnisse der Sizilianischen Vesper usw. informiert waren: an eine Rettung der Reputation de9 Mittelalters war dann nicht mehr zu denken.
Und wenn man in einer Großstadt lebt, wo die Baudenkmäler früherer Jahrhunderte nur mehr sehr spärlich vorhanden sind und lange Jahre vergehen, ohne daß mit dem Mittelalter eine wirkliche Begegnung zustande kommt, glaubt man gar nicht, daß auf irgendeine Weise die Atmosphäre dieser längst entschwundenen Vergangenheit wieder auferstehen und einen gefangennehmcnl kann.
Beinahe vor zehn Jahren geschah es. Tag für Tag wanderte ich über die sonnenbestrahlten Straßen und Piazzas von Rom. Die Einwohner der Stadt hielten sich in ihren kühlen Wohnungen auf. Gerade diese Mittags- und Frühnachmittagsstunden paßten mir aber ausgezeichnet. Ich wollte nämlich von all den Kunstdenkmälern Besitz nehmen, die nur in den wenigen Tagen meines Aufenthalts zu besichtigen waren. So meinte ich, daß die frohen Bürger mit ihrem gleichgültigen Kommen und Gehen mich gewiß nur stören, Ja ärgern würden. Ich ging also zwischen den stillen und Hitze ausstrahlenden Häusern; neue und immer neuere Aspekte öffneten sich vor meinen staunenden Augen — bei jeder Straßenkreuzung, bei jedem Torbogen, wie wenn ich nur durch Räume eines Museums gewandert wäre.
Es war unweit des Forum Romanum. Die blendendweißen Steinplatten hatten mich ermattet, es ging einfach nicht mehr und ich hielt nach Schatten und Wasserquelle Ausschau. So erreichte ich die kahlen, hohen Wände eines braunroten Ziegelbaus und langte durch eine kleine Seitentür mit offenstehendem Flügel in das Innere. Dem Haus haftete ein fast zeitloses Dasein an. Es war, nach Zeugnis des Baedekers, das ehemalige Ordenshaus der Johanniterritter von Rhodos.
Ich ging durch einen schmalen Gang weiter, einer hohen Mauer entlang, ein paar Stufen hinauf und wieder hinab. So entdeckte ich schließlich einen Wasserhahn. Als ich ihn aufdrehte und das Wasser in das darunterliegende uralte Marmorbecken zu fließen anfing, wobei der Lärm des Wassers im ganzen Haus widerhallte und ich mich vorbeugte, um zu trinken und mich zu waschen, da riefen in mir der kühle Gang und der Wasserhahn Kindheitserinnerungen wach. Ich erinnerte mich an Spiele, bei denen wir in verschiedenen Rollen aus vollem Halse schreiend umherliefen, bis man uns zum Tische rief, wir mußten uns aber vorher noch waschen und das geschah immer auf dem langen, kühlen Gang am Wasserhahn. Noch vom aufregenden Spiel in halbtrunkenem Zustand, setzten wir unsere Feindseligkeiten unter Zuhilfenahme des Wassers fort, es blieb oft nichts trocken in der ganzen Umgebung. Als aber unser Vater erschien und den Wasserhahn abdrehte, wurde es mäuschenstill und man ging mit triefendem Haar auseinander.
Ich stand nun zu diesem späten Jahr wieder am Wasserhahn, wieder einmal ohne Handtuch, auf dem Gang. Ich drehte den Wasserhahn um, es wurde plötzlich still wie damals, und da wurde es mir auf einmal ganz klar, daß auch dieser Wasserhahn hier, aber auch das Bechen, die nassen Wände, das alte Ordenshaus seine Erinnerungen bewahren mögen, wie ich die meine bewahre. Wie viele Generationen konnten, von den stolzen Rittern angefangen, diese Räume und die Gegenstände, welche da drinnen 6tanden, als ihre eigenen nennen. Sie schieden dahin, die Gegenstände und die Wände zurücklassend. Wenn diese über die Szenen, die mit und unter ihnen sich abgespielt haben, berichten könnten! Als ich mich langsam trocknete, breitete sich um midi die Atmosphäre dieser entschwundenen Menschen aus. Ich dachte nach und fand, daß auch sie sich kaum anders haben waschen können, wie ich es tat, ihre Briefe schrieben, miteinander sprachen oder mit ihren Hunden herumgingen, wie auch ich es tun würde —, alles in allem routiniert und nicht an Ursprung und Bedeutung dieser Betätigungen denkend, ein angelerntes Tun und Treiben, bereits in- stinktmäßig verrichtet.
Als ich mich aufrichtete und weiterging, fühlte ich mich — es mag lächerlich klingen — als ein Mensch aus dem Mittelalter. Meine Bewegungen waren nämlich den ihren offenkundig gleich. Und es lag etwas Traumwandlerisches in meinem Vorhaben, als ich das ganze Haus durchwandern wollte, um in verborgenen Ecken mittelalterliche und doch auch uns so heimlich anmutende Hausgeräte zu suchen, wenn schon den Menschen, den tapferen, aber sicherlich freundlichen Johannitern, ihrer Dienerschaft, ihren Pferden und Hunden zu begegnen, hoffnungslos schien.
Ich stieß aber auf geschlossene Türen und auch die Gänge und Höfe waren leer. Dann klopfte ich an einer Tür und wartete, als sich aber niemand meldete, kehrte ich um und suchte fröstelnd den Ausgang. Auf die Straße gelangt, glaubte ich die Stadtbesichtigung dort fortsetzen zu können, wo ich vorhin damit aufhörte, mußte aber staunend wahrnehmen, daß sich inzwischen etwas geändert hatte.
Alle die glitzernden Fenster, die Balustraden, die weißen Säulen und Bögen, die hellen architektonischen Kunstwerke ringsherum schienen nicht mehr zu sein, als Ausdrücke eines ästhetischen Formwillens. Erst seit ein paar Minuten wußte ich aber, daß zu den alten Gebäuden einmal auch das alte Leben gehört hat, und mit den Baudenkmälern der auf das Mittelalter folgenden Jahrhunderte konnte ich einstweilen keinen Kontakt finden. Ich konnte nicht umhin, sie blieben mir fremd, zu berechnet und zur Schau gestellt. Auf der Suche nach dem einfachen, alltäglichen Menschen hätte ich sie am liebsten alle niedergerissen, bis ich bei den dumpfen Grundmauern, in den verbauten Ecken, in den schwerste Last tragenden Pfeilern die mittelalterlichen Ziegelsteine wiedergefunden hätte. Damals dachte ich sogar, vielleicht der ganze Sinn und die Rätselhaftigkeit des Menschendaseins, die ganze Substanz von Glaube und menschlichem Gefühl sind zusammen mit diesen alten, modrigen Steinblöcken verschüttet und begraben worden. Ich fand an Rom, an der Oberfläche also, bis zu meiner baldigen Abreise keine Freude mehr.
Es bedurfte nur einiger Zeit, bis mir das Erlebnis im Hause der Ritter von Rhodos wieder einfallen mußte. Im Wiener Stephansdom überraschte ich mich zum ersten Male, daß ich überall nach Zeichen suche, welche mir das Mittelalter in menschliche Nähe bringen könnten. Da wurde mir offenbar, daß jene Erfahrung in Rom mich nicht losließ. Man brauchte nur bestimmte Asymmetrien ins Auge fassen, oder entdecken, daß auf gewissen Stellen große Nägel mit für uns unbekanntem Zweck in die Wand geschlagen sind; diese Spuren, um nicht zu sagen Narben, liefern den Beweis für mich vielleicht noch unmittelbarer, als das Nebeneinander von gotischen und barocken Altären, Renaissancemonumenten, daß hier durch mehrere Jahrhunderte Menschen am Werk waren.
Dieselbe Kontinuität weist auch das organische Wachstum der historischen Stadt Wien mit den Vororten auf. Die alten Häuser werden aber immer seltener, selbst die kunsthistorisch wertvollen Bauten können nicht unverändert fortbestehen, auch sie werden immerzu renoviert. Am Ende bleiben nur die alten Straßennamen übrig, oder nicht einmal sie. Es ist unleugbar, daß die alten Steine — wie ich das schon damals in Rom vermutet habe — ihr unmerk- liches Leben meist nur noch als Grundmauern weiterführen. Unter der Erde zieht sich bekanntes und unbekanntes Gemäuer, Kanäle, Tunnels in alle Himmelsrichtungen, und gewiß sind überall auch Ornamente, Statuen, Inschriften mit eingemauert. Die heutige Generation, die unsere Stadt bevölkert, ahnt’ nichts von alldem, was unter ihren Häusern begraben liegt.
Und doch, es gibt zuweilen einen Hinweis, welcher uns ahnen läßt, daß, wenn auch die Häuser, die kirchlichen wie die weltlichen Bauten, mit der Zeit untergehen müssen, es doch menschliche Eigenschaften und geistige Werte gibt, die Demolierungen und Verwüstungen überdauern. Auf einem Kodexblatt in der Nationalbibliothek ist eine biblische Szene dargestellt: die hl. Anna und Maria spielen mit dem Kind Jesus unter einem Baum. Im Hintergrund aber stehen mittelalterliche Häuser, und der unbekannte bayrisch-österreichische Künstler aus dem frühen sechzehnten Jahrhundert hat weiße Tauben auf die Dächer gemalt. Unter einer Flur ist Brennholz aufgestapelt und auf dem Gartenweg spazieren zwei Hühner. Hühner und Brennholz sind aber nur Hintergrund, das Hauptthema ist viel mehr: ist Mutterliebe, Innigkeit, fromme Andacht. Aus den Augen der Spielenden strahlt irdische und himmlische Liebe zugleich.
Und all dies gibt es auch heute noch auf der Welt. Man beobachtet, daß infolge der furchtbaren Heimsuchungen der letzten Jahrzehnte und nicht zuletzt der profunden Enttäuschung an dem Fortschritt der Menschheit die Zeichen sich mehren, wonach eine große Verinnerlichung und Gottessuche bevorsteht. Man wird Zeuge wunderbarer Offenbarungen des religiösen Geistes, gewaltiger Prozessionen etwa, manchenorts mit Hunderttausenden von inbrünstig Teilnehmenden. Sie alle sind Erben und Hüter des Mittelalters inmitten unserer Zeit —, in welcher auch sonst nicht an Zeichen mangelt, an Symptomen und Folgen der Massensuggestion, an Zeichen der großen Wandelbarkeit der Massen, die auf Einfluß von Fanatikern oder Abenteurern ewig unbelehrbar immerfort aus einem Extrem in das andere fallen. Dann spaziert man auf der Ringstraße und begegnet einem der allbekannten Trachtenzüge. Die Leute marschieren munter, vorne die Blasmusik, welcher Frauen und Männer in schönen alten wie neueren Trachtenanzügen folgen, die Fahnen schwenkend und den Herumstehenden zurufend. Und in ihren Reihen hüpfen auch einige Buckelige, selbstvergessen, grotesk — ein fernes Abbild der Groteske in mittelalterlichen Umzügen. Wahrhaftig, wie bei Pieter Breughel dem Älteren oder bei Hieronymus Bosch …
Es scheint so, wie wenn der europäische Mensch alles umsonst unternähme, um sich von seiner Vergangenheit zu distanzieren, sich mit ihr nur in ihrer stilisierten Form zu treffen. Sie bleibt weder unter den verschütteten, alten Ziegelsteinen, noch aber schön geordnet und katalogisiert in den Bibliotheken, Archiven und Museen, begraben, vielmehr tritt sie hervor aus den Schränken und den Ruinen und begleitet mit unaufhaltbarem Schritt unsere Gegenwart. Vielleicht ahnt das der Mensch, daher die große Furcht vor ihr, oder besser gesagt, vor sich ‘selber.
Als ich das alles erkannt hatte, fühlte ich mich veranlaßt, meine Anschauung über die Beziehung vom Mensch zur geschichtlichen Zeit, insbesondere zum Mittelalter, somit zum zweitenmal zu revidieren.