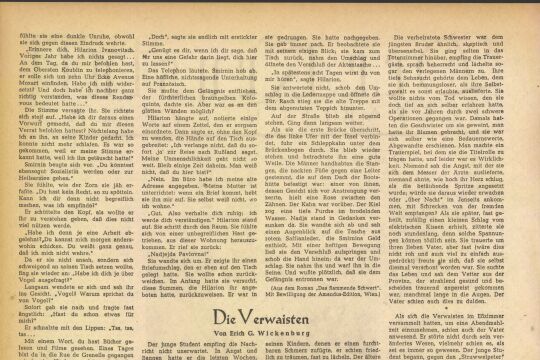„Stendhal starb am Geist, Proust an der Schönheit, Hemingway am Tod“, schrieb Wolfgang Koeppen in einem Nachruf auf Hemingway. „Im Leben kommt es auf dasselbe heraus. Ästhetisch betrachtet ist es der Unterschied zwischen einem Brennglas, einem Prisma und einem Spiegel. Man sucht die Wahrheit und findet sie in der Täuschung.“
Der Tod war das eine große Thema in Hemingways Werk. Nie ist er mit ihm fertig geworden. Sein ganzes Leben hat er seinen Tod mit sich herumgeschleppt — eine unbeantwortete
Frage. Früh hat er die Nähe des Todes aufgesucht, um „schreiben zu lernen“. Er brach aus einer friedlichen Welt aus, um den Spuren des Todes zu folgen.
Es zog ihn an die Fronten, aufs Schlachtfeld, dorthin, wo — wie er meinte — die großen Entscheidungen im Leben eines Mannes fielen, wo Tapferkeit und Rittertugend noch etwas galten. Ehe noch Amerika in den Weltkrieg eintrat, meldete er sich als Freiwilliger auf den italienischen Kriegsschauplatz. Er machte sich um ein Jahr älter, um überhaupt genommen zu werden — weshalb man noch heute in manchen Biographien das Jahr 1898 als sein Geburtsdatum angegeben findet, und nicht, wie es richtig heißen müßte, 1899. Er wurde als Rotkreuzmann eingesetzt und mehrfach verwundet. Sein Bein wurde von 247 Granatsplittern getroffen — die Zahl erschien ihm wichtig, wie er überhaupt stolz auf seine Narben war. Monatelang war er ans Krankenbett und dann an der Rollstuhl gefesselt.
Später -zog er dem Tod auf seine andere Sdhafapftätze nacht an die türkisch-griechische Front in den zwanziger Jahren, in den spanischen Bürgerkrieg, in die %tietkättipfareiiä, als Korrespondent zuerst kleinerer amerikanischer Blätter, dann der großen Zeitschriften. Sein ganzes Leben ist eine Reihe von Verwundungen und Überwindungen.
Den Tod aber überwand er nie, nicht den Tod als Faktum des menschlichen Daseins, weder den Selbstmord des Vaters, der nicht krank sein wollte, noch den Tod als Thema in seinen Büchern. Um ihn kreiste er, er war seine Bestimmung, nicht nur sein Ziel. Er kam nicht darüber hinweg, daß mit dem Tod „alles aus sein sollte“. Das schien ihm unabänderlich. Aber wenn es so war: wie ihm standhalten, wie ihm begegnen?
Vielleicht haben viele Hemingway darum so geliebt, weil er ein Leben lang vorgelebt hat, wie man dem Tod begegnet. Wie man den Tod verachtet und über ihn triumphiert. The American way of life. The American way to die.
In seinen bunten Buschhemden, in seiner Jagd- und Angelausrüstung, in den alten Leinwandjacken, in der Stierkampfarena, und selbst noch im Lazarett verkörperte er das Leben. Er barst von Vitalität. Und wenn er sich an der Schreibmaschine photographieren ließ, stehend, zog er sich vorher das Hemd aus.
Er schien den Tod nicht zu kennen. Er ignorierte ihn. Und die von den gleichen Idealen geprägt waren und in seinen Filmen spielten, in „Fiesta" und in „Wem die Stunde schlägt“, in „Haben und Nichthaben“ und in „A Farewell to Arms“, sie alle liebten das Leben und ignorierten den Tod wie er. Sie spielten seine Helden, auch in den anderen Filmen, in denen sie spielten, und darüberhinaus, immer. Man nannte sie die Könige von Hollywood: Clark Gable und Gary Cooper und Humphrey Bogart, Tyrone Power und Errol Flynn. Und sie starben alle vor ihrer Zeit, an Herzinfarkt, an Krebs, an Kreislaufschwäche. Und nun ist er mit ihnen versammelt, mit seinen alten Freunden. Zur letzten Fiesta. In einem anderen Land.
Kannten sie wirklich den Tod nicht? Wer weiß das? Cooper und Bogart wußten von ihrem Tod, und sie lächelten weiter. In einer Welt, die kein Kosmos mehr ist, weil Leben und Tod auseinandergebrochen sind und unvereinbar und unversöhnlich einander gegenüberstehen, der Tod nichts weiter als das Erlöschen des Lebens, als der Feind schlechtweg, in dieser desakralisierten Welt ist die Tapferkeit die größte Tugend.
Hollywood kennt keinen Tod. Wir wissen von Evelyn Waugh, daß es Sitte ist, den frischgeschminkten Leichnam noch einmal an die Bar zu setzen, zu einer Abschiedsparty, bei der jeder der Freunde sich an Heiterkeit überbietet Hinter diesem makabren Vordergrund versteckt sich oft viel persönlicher Mut, viel Selbstbeherrschung, viel Selbstüberwindung.
Tod? Krankheit? Man lächelt. Es ist erst einige Wochen her, da traf ich im Krankenhaus einer Schweizer Stadt einen amerikanischen Maler, einen der großen Namen der heutigen Kunst, einen Mann von etwa vierzig Jahren, auf gerichtet saß er im Bett, braun von der Höhensonnei mit breitem Schnurrbart, das grellrote Buschhemd über der Brust offen. Nichts durfte daran erinnern, daß man hier in einem Krankenzimmer war, die Krankheit wurde nicht erwähnt, und jeder der Freunde kam nur zu einer Party. Wir spielten Schach. Und er lächelte, als ihm die Schwester die übliche Injektion gab.
Das hat Hemingway den Amerikanern vorgelebt. Er ist das Urbild dieser Haltung. Der Archetypus der amerikanischen Ein stellung zum Tod, zur Krankheit. Ich kenne kein Bild von Hemingway in einem Lazarett — und er war oft im Lazarett —, auf dem er nicht lächelte. Hart und nicht unterzukriegen.
Er hatte seinen eigenen Ehrenkodex. Ein Mann kann geschlagen werden, aber nicht besiegt, postulierte er. Verwundet ja, von außen. Zehnmal. Hundertmal. Aber er kann nicht krank sein. Von innen. Kein DahinsiechenI Kein VerdämmernI Keine Dämmerung I
Er war tapfer. Aber es war die Tapferkeit eines zwölfjährigen Knaben. Eine grenzenlose Tapferkeit
So lebt sein Bild in uns, so hat er auf uns gewirkt. Wenn in amerikanischen Romanen, die von Schriftstellern handeln (und welche amerikanischen Romane handeln nicht von Schriftstellern?), seien sie nun von Saroyan oder Norman Mailer oder wem immer, unweigerlich der Name Hemingway fällt, als der Name des Mannes, dem der Held des Buches nacheifert, den er als unerreichbares Idol verehrt und den er doch zu erreichen trachtet, dann ist nicht nur der Schriftsteller Hemingway gemeint, sondern der ganze Mann, die Legende, der Mythos. Der Mann, der durch nichts als Tapferkeit groß wurde, und der — so vermeint man — durch Tapferkeit auch ein großer Schriftsteller geworden ist.
Der Tod war sein Thema. Da ist der Stierkämpfer, der an Tuberkulose litt und weiterkämpfte, und als die rechte Hand zu schwach war, den Degen zu halten, hielt er die rechte mit der linken fest und stieß zu, ganz so, als ob er die rechte Hand für ihre Schwäche strafen wollte. Und als er nicht mehr in der Arena antreten konnte, als er im Zimmer bleiben mußte, da kämpfte er weiter, und sein Gegner war nicht mehr der Stier, sondern der Tod selbst, und als er aus dem Bett stürzte, als es nun soweit war, kämpfte er unter dem Bett weiter, kämpfte er dort im Staub seinen Todeskampf.
Oder der Schriftsteller Harry im „Schnee am Kilimandscharo", der todwund daliegt von seiner letzten Safari! Sein Problem ist es, sein ganzes Denken kreist darum, daß er zuwenig Tod in seine Bücher gebracht hat, bisher. Und zuwenig Tod heißt: zuwenig Tiefe. Hier war für Hemingway das Geheimnis der Wirklichkeit, hier hat er es gesucht, bis zuletzt.
Oder der alte Offizier in Venedig, der den Tod überallhin mitschleppt, in die Bars und ins Zimmer zu seinem Mädchen! Er ist umstellt von der Urkraft des Lebens, die ihn verhöhnt. Verhöhnt von seinen Idealen. Seine Ideale werden sein Tod sein.
Ich weiß nicht, wie eine kommende Generation zu Hemingway stehen wird. Ich weiß nicht, ob sie noch so den großen Schriftsteller in ihm sehen wird, wie wir ihn in ihm gesehen haben, als wir zu schreiben begannen, ob wir nun Schriftsteller wurden oder Journalisten — Hemingway war ja nicht nur Dichter, er war auch zuvor und daneben Reporter mit Leib und Seele, einer der besten Reporter unseres Jahrhunderts. (Wann erscheint einmal ein Buch mit seinen gesammelten Reportagen? Es könnte ein Lehrbuch sein.)
Vielleicht gehörte die Aktualität wesentlich zu ihm, die sichtbare Erscheinung des massigen Mannes, dieses Grizzlybären mit der Krankenkassenbrille, dieses Mannes, der sich mit vierzig einen Bart wachsen ließ, um älter auszusehen, um der alte Mann zu sein, der sich alt machte, um dem Alter, dem Tod zu spotten durch seine Spannkraft. Vielleicht werden seine
Bücher mit den Jahren an Glanz verlieren, wenn diese Erscheinung nicht mehr da ist — wer wüßte das heute?
Er hat sich nicht entwickelt, er ist immer der Knabe geblieben, auch in der Verkleidung des alten Mannes, der Mann mit jungenhaftem Charme und jugendlichen Idealen. Er wollte der beste Großwildjäger, Boxer, Stierkämpfer, Whiskytrinker seiner Zeit werden, und vielleicht hätte er den Nobelpreis darum gegeben, eines dieser Ziele zu erreichen.
Er hat sich nicht entwickelt, und sein Werk ist nur in die Breite, kaum in die Tiefe gewachsen. Es ist nicht schlechter geworden, aber es hat bis zuletzt keine Dimension gewonnen, die es nicht von Anfang an hatte. Nur im letzten, im „Alten Mann und das Meer", war ein neuer Zug zu spüren: Zum erstenmal lebten hier die Figuren nicht aus eigener Kraft, „hatten sich nicht selbst gemacht“, wie William Faulkner sagte, sondern sie waren gemacht von jemand anderem, waren geschaffen, waren Geschöpfe.
Hemingway ist ein Mann ohne Dämmerung, ohne Zwischentöne, ohne Übergänge. Hier ist der Tag und hier ist die Nacht. Das Ja und das Nein. Der Mann und die Frau. Gegensatz und Widerspiel. Gefahr und Bewährung. Leben und Tod. Aber es ist keine Verbindung dazwischen, kein Ausgleich, keine Dämmerung. Der Mensch ist allein, auf sich gestellt, isoliert, ob er eine Frau an seiner Seite hat oder nicht. Allein muß er mit allem fertig werden, mit sich selbst, mit seiner Verzweiflung, mit seinem Tod.
Wie man fertig werden kann mit sich, mit der eigenen Schwäche, mit der eigenen Angst (nur wer Angst gehabt hat, kann wirklich tapfer sein): das hat er zuerst vorgelebt und dann erst beschrieben.
Der Tod war sein Thema, der Tod, der zufällig und sinnlos das Leben zerstört. Ihm galt es sich zu stellen, an ihm zu wachsen, an ihm Mann zu werden. Immer im Bewußtsein, daß schließlich der Tod der Siegei sein würde.
Wer die Welt so sieht — und Hemingway sah sie so, auch der Stierkampf war ihm nur ein Sinnbild dieser Unvereinbarkeit von Leben und Tod —, der steht auf verlorenem Posten. Auf verlorenem Posten im Leben wie in der Literatur. Der hat keine eigene Welt, keinen Kosmos, in dem alles an seinem Ort ist. Kunst heißt: eine eigene Welt haben, einen Kosmos haben, und alles was man sieht, einordnen können in die unsichtbare Ordnung.
Hemingway stand auf verlorenem Posten, aber er hat dennoch geschrieben. Und vielleicht ist die Meinung gar nicht so falsch, die sagt, man könne durch Tapferkeit auch ein großer Schriftsteller werden. Durch Ehrlichkeit. Durch Unbedingtheit.
„Die Tatsache, daß das Buch tragisch war“, sagte Hemingway von seinem Roman „In einem anderen Land“, „machte mich nicht unglücklich, denn ich glaubte, daß das Leben eine Tragödie ist, und wußte, daß es nur ein Ende haben kann.“
Sein eigenes Ende ist jäh gekommen. Sein Leben hat keine Dämmerung gehabt, kein langsames Erlöschen der Kraft, kein geruhsames Alter. Hemingway ist tot. Schämen wir uns nicht unserer Trauer. Er war mehr als ein großer Schriftsteller. Er war unser Kamerad.