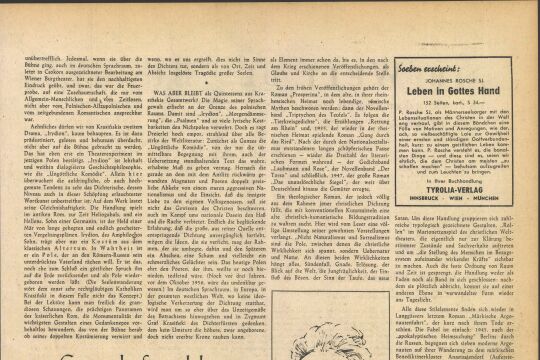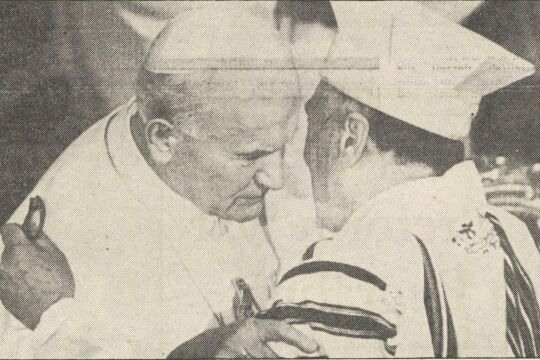Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das unmögliche Begräbnis
Es kommt kein Rabbi, denkt der Erzähler, „weil es eben jüdische und christliche Erde gibt. Die einen Krumen glauben an Jesus, die anderen nicht, und die Gräser, die auf ihnen wachsen, sind entweder getauft oder beschnitten. Ich muß darauf achten, daß die Blumen koscher sind, die ich aufs Grab pflanze.” Für einen Rezensenten ist es nicht ganz koscher, in der Besprechung einer Erzählung ausgerechnet Sätze zu zitieren, die auf dem Bucheinband stehen, aber in dem Fall hat der Lektor wirklich genau jene Stelle ausgewählt, auf die sich die Erzählung zuspitzt. Doch diese Stelle ist keine einsame Rosine im Teig, sondern durchaus repräsentativ für die Geschichte. Das ganze Buch ist ein großartiges, wichtiges, lesenswertes Stück deutscher Prosa über jüdische Befindlichkeit.
Sie ist ein Stück jener Prosa, die den Leser einerseits davon überzeugt, daß der Schreiber genau das erlebt hat, was er schildert - und ihn doch wiederum, trotz all seinem Interesse für die Bealität der Geschichte und die Person des Autors, im konkreten Fall: Lothar Schöne, durch ihre Qualität davon überzeugt, daß der Anlaß ihrer Entstehung eigentlich irrelevant ist, weil Literatur ihre eigene Wirklichkeit erzeugt. Auf der realistischen Ebene ist es übrigens eine wunderschöne Liebeserklärung an eine tote Mutter.
Geschehen oder nicht, ganz oder nur teilweise erfunden, sie ist jedenfalls möglich, die Geschichte vom Tod der Frau, die an der Seite ihres Mannes begraben werden soll, der in der Nazizeit die ihm nahegelegte Scheidung verweigerte. Die Geschichte vom unmöglichen Begräbnis, weil sie Jüdin war und es auch immer blieb und er Christ, und weil kein Rabbiner einen christlichen Friedhof betritt und daher auf einem christlichen Friedhof kein jüdisches Begräbnis möglich ist. Vom lutherischen Pfarrer, der ein ungewöhnlicher Typ ist und eine Möglichkeit findet, auf dem christlichen Friedhof ein jüdisches Begräbnis zu vollziehen.
Schöns Erzählung zählt für mich zu den wichtigen deutschen Prosatexten und nachhallenden Leseerlebnissen dieses Jahres. Zu ihren vielen starken Stellen gehört das Gespräch zwischen dem Erzähler und dem Rabbiner, der das jüdische Begräbnis in christlicher Erde verweigert, weil er es verweigern muß, denn das Judentum verfügt nicht über jene Hintertüren und
Kompromißmöglichkeiten, die es dem lutherischen Pfarrer (eine überzeugende positive Figur) möglich machen, dem Wunsch des Sohnes zu entsprechen. Die Sätze des Rabbiners sind von kristallklarer Härte, in ihnen wird das Wesen der Uberlebenskraft des Judentums spürbar: „Sehen Sie, ich kann nicht kommen. Es läßt sich theologisch nicht vereinbaren, es läßt sich mit der Geschichte nicht vereinbaren. Ihre Mutter ist tot, gelöst die Schnur, gebrochen das Band. Schalom ihrer Seele. Sehen sie nach vorn. Sehen Sie in die Zukunft. Uns bleibt nur diese Möglichkeit.”
Im übrigen ist es auch ein Buch, das viel vom Lebensgefühl jener vermittelt, die sich durchaus als Juden verstehen, aber mit der Orthodoxie auf Kriegsfuß stehen und sich von ihr nicht einengen lassen wollen. Eine tiefe Ambivalenz wird an diesen Stellen spürbar. Sozusagen sein Fazit: „Ein Jude kann nie etwas anderes sein als ein Jude. Das ödet mich an. Ich habe mich auf den Weg gemacht. Was gehen mich die Juden an? Sie sind so gut und so schlecht wie alle anderen. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, mich als Juden, als Christ oder sonstwie zu deklarieren.”
Lothar Schöne schreibt eine nur scheinbar kunstlose Prosa, sein Witz ist trocken und manchmal bitter, mit Wucht bricht die Vergangenheit in die Gegenwart ein, wenn ein Bankbeamter zu einem Kunden sagt: „Für den neuen Kreditrahmen haben wir noch keine Endlösung gefunden”
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!