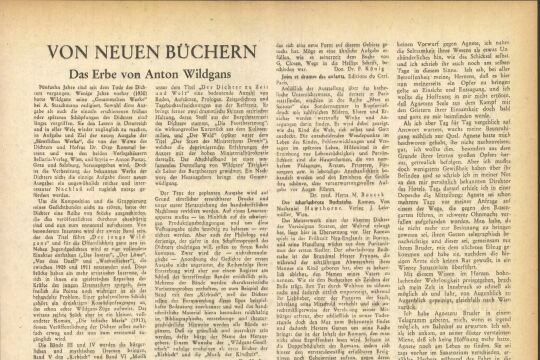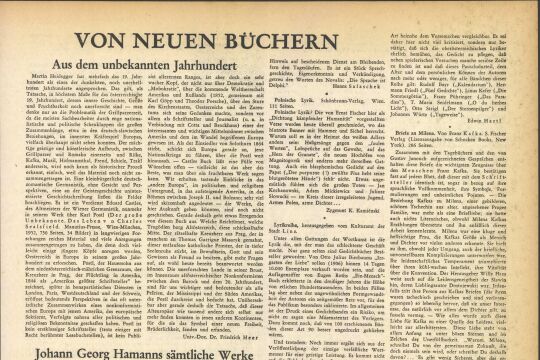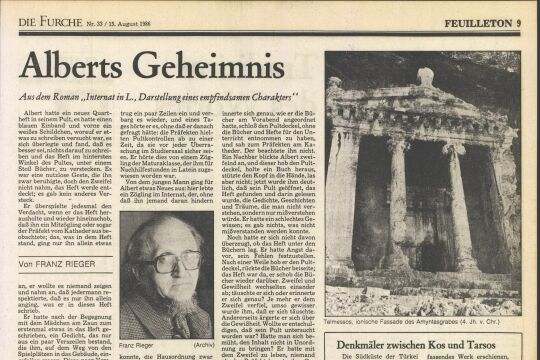Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Unmögliche wollen
BRIEFE AN FELICE. Von Franz Kafka. Herausgegeben von Erich Heller und Jürgen Born. Mit einer Einleitung von Erich Heller. S.-Fischer-Verlag, Frankfurt. 7 4 Seiten.
BRIEFE AN FELICE. Von Franz Kafka. Herausgegeben von Erich Heller und Jürgen Born. Mit einer Einleitung von Erich Heller. S.-Fischer-Verlag, Frankfurt. 7 4 Seiten.
Kafka war 29, als er im August 1912 bei seinem Freund Max Brod in Prag die drei Jahre jüngere Felice Bauer kennenlernte. Tochter eines gebürtigen Wieners, lebte sie mit der Familie in Berlin, wo sie im Büro eines großen Unternehmens arbeitete. Kafka notierte in sein Tagebuch über die erste Begegnung unter anderem: „Knochiges, leeres Gesicht, das seine Leere offen trug. Fast zerbrochene Nase. Blondes, etwas steifes, reizloses Haar. Starkes Kinn.“ Dieser überscharfe Blick für die Details ließ zunächst nicht gerade auf plötzliche Entflammtheit schließen. Fünf Wochen später aber (am 20. September 1912) schrieb Kafka bereits den ersten Brief an F. B. (Zwei Tage darauf brachte er in achtstündiger Nachtarbeit als Auftakt einer Art literarischen Rauschzustandes die Geschichte „Das Urteil“ mit der Widmung an F. B. hervor.) Nach einem zögernden Beginn setzte ein Briefwechsel ein, der durch Kafkas Schreibwut alsbald kaum vorstellbare Ausmaße annahm. Also war das äußerlich „leere Gesicht“ in Berlin gleich einem leeren Blatt, auf dem sich Kafkas Einbildungskraft ausbreiten konnte. Anfangs schrieb er Tag für Tag oder Nacht für Nacht; zwischen 1912 und 1917 waren es weit über 500 (darunter bis zu 40 Seiten lange) Briefe und Karten. „Du gehörst zu mir“, heißt es dann in einem, als längst die Anrede von Sie auf das ekstatische Du übergewechselt war, ,.... ich kann nicht glauben, daß in irgendeinem Märchen um irgendeine Frau mehr und verzweifelter gekämpft worden ist als um Dich in mir, seit dem Anfang und immer von neuem und vielleicht für immer.“ Zweimal ließ er es mit F. B. bis zur Verlobung kommen, veröffentlichte Anzeigen in Berliner und Prager Blättern, machte ernstlich Hochzeitsvorberei- tungen in zwei Städten und absolvierte gemeinsam mit der „Braut“ konventionelle Antrittsbesuche bei Verwandten und Bekannten. Über einen formellen Besuch bei Max Brod (9. Juli 1917) berichtete dieser: „ ... der Anblick der beiden ziemlich verlegenen Menschen, vor allem Franzens in ungewohnt hohem Stehkragen, hatte etwas Rührendes und zugleich Schauerliches.“ Zweimal kam es zur Entlobung, das zweitemal bedingt durch Kafkas schwere Krankheit, die sich mit einem Blutsturz angekündigt hatte und von der er sich nicht mehr erholen sollte. Ende Dezember 1917 trennten sich die beiden Verlobten endgültig in Prag. Kafka war nachher zu Brod ins Büro gekommen. „Sein Gesicht war blaß, hart und streng. Aber plötzlich begann er zu weinen. Es war das einzige Mal, daß ich ihn weinen sah. Ich werde diese Szene nie vergessen, sie gehört zu dem Schrecklichsten, was ich erlebt habe, ... ich habe ihn nie außer diesem einen Mal fassungslos, ohne Haltung gesehen.“
Der vorliegende Band enthält alle Briefe Kafkas an Felice Bauer und an deren Freundin Grete Bloch (die eine nicht ganz durchsichtige Rolle in der Beziehung der beiden gespiell hat) sowie die aus Kafkas Familien- und Freundeskreis stammenden, die Verlobung betreffenden Briefe. Seltsamere „Liebesbriefe“ als die ar Felice sind kaum je geschrieber worden. Wollte er sie denn wirklich heiraten? War es überhaupt sie, di er mit seinen Briefen meinte? Vor Anfang an warnte er sie — dieser „lebensbejahenden, wenig komplizierten Menschen“, dieses „lustige gesunde, selbstsichere Wesen“ — voi einer Ehe mit ihm. Er häufte di scharfsinnigsten Argumente für da: Unmögliche in seinen leidenschaftlich bohrenden, analysierenden Episteln, urgierte ungeduldig die Antworten der Verwirrten unc Erschreckten, nur um immer wiedei Anlaß für seine Repliken zu haben („Meine Gegenbeweise sind nicht zi Ende, denn ihre Reihe ist unendlich.“) In dieser Korrespondenz mi der Verlobten ging es weit wenige: um die Liebe als vielmehr um dii Literatur. Es waren Schriftsteller briefe, nicht private Minnebriefe.
Neun Monate nach dem erstei Brief rügte er an Felice, wie wenii sie überlege, daß Schreiben „seil eigentliches gutes Wesen“ sei. „Wem etwas an mir gut ist, so ist es die ses.“ Nur wenn sie sein Schreibe: „mit oder wider Willen“ liebe, hätt sie etwas, woran sie Halt fände. Abe „Könntest Du denn das ertragen Vom Mann nichts zu wissen, als da! er in seinem Zimmer sitzt um schreibt? Und auf diese Weise de: Herbst und den Winter verbringen Und gegen das Frühjahr zu de Halbtoten an der Tür des Schreib zimmers empfangen und im Früh iahr und Sommer zusehen, wie e sich für den Herbst zu erholen sucht? Ist das ein mögliches Leben?“ Immer weiteres Wüten: „Die Lust, für das Schreiben auf das größte menschliche Glück zu verzichten, durchschneidet mir unaufhaltsam alle Muskeln.“ Im selben Brief der Hinweis: „... von den vier Menschen, die ich... als meine eigentlichen Blutsverwandten fühle, von Grillparzer, Dostojewskij, Kleist und Flaubert, hat nur Dostojewskij geheiratet ...“ Und so fort in oft unerträglich langen Briefen, selbstquälerischen Monologen voll von Selbstbezichtigungen und Selbsterniedrigungen. „Du kennst mich nicht, in meinem Schlechtsein kennst Du mich nicht, und auch mein Schlechtsein geht auf jenen Kern zurück, den Du Literatur nennen kannst oder wie Du willst.“ Neun Monate später notierte er ganz sachlich im Tagebuch: „Ich konnte damals nicht heiraten, alles in mir hat dagegen revoltiert, sosehr ich F. immer liebte. Es war hauptsächlich die Rücksicht auf meine schriftstellerische Arbeit, die mich abhielt, denn ich glaubte diese Arbeit durch die Ehe gefährdet.“
Erich Heller ging in seinem Vorwort zu dem Briefband (es umfaßt
25 Seiten) ausführlich und aufschlußreich auf den unversöhnlichen Gegensatz von Kunst und Leben, Askese und Ehe bei Kafka ein. Dem Anschein nach war für Kafka die Sicherung der inneren Existenz nur möglich im Rückzug aus dem Leben. („Das Schreiben erhält mich“, denn nur das Schreiben gebe dem Dasein „das Schwergewicht der Tiefe“.) Und doch hieße es ungebührlich vereinfachen, wollte man behaupten, Kafkas „wahres“ Leben wurzle nur im Schreiben. Zweifellos erschienen ihm Literatur und Realität immer wieder von neuem als unvereinbar; aber fraglich blieb, ob „die Wahrheit bei den Worten“ war oder „bei der Welt, die ihm beim Wortemachen abhanden“ gekommen war. So ging die jahrelange Pein und Plage des Kampfes nicht um die Frau (die er zu jeder beliebigen Stunde hätte „heimführen“ können), „wenn er wahrhaft ein Heim wollte in der Welt“, sondern es ging um die „Wirklichkeit“ von Welt, Ehe und Heim, das „bißchen Realität“, dessen er durch die Briefe an Felice habhaft werden wollte. Als Spuren eines exemplarischen Lebens außerhalb des Lebens vermögen sie „vielleicht dem besseren Verständnis des nicht leicht zu verstehenden Wesens dienen, welches diese Briefe schrieb“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!