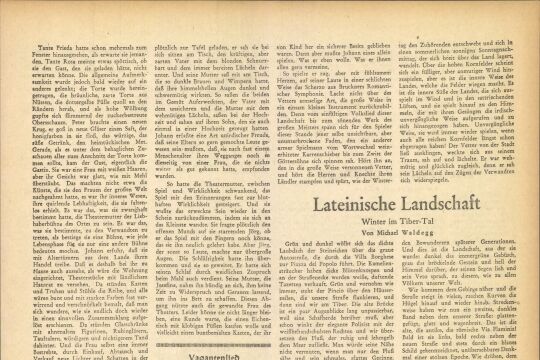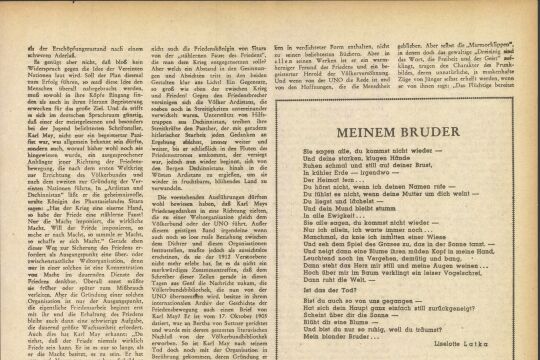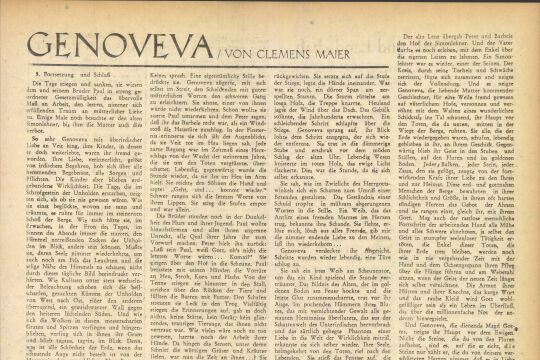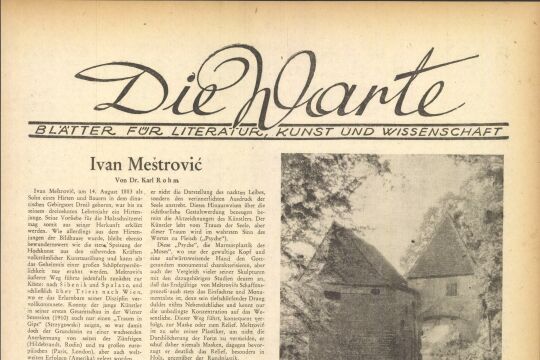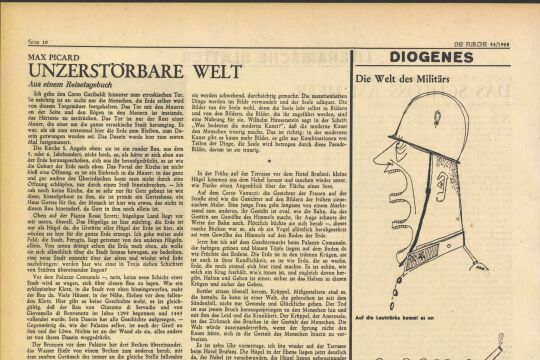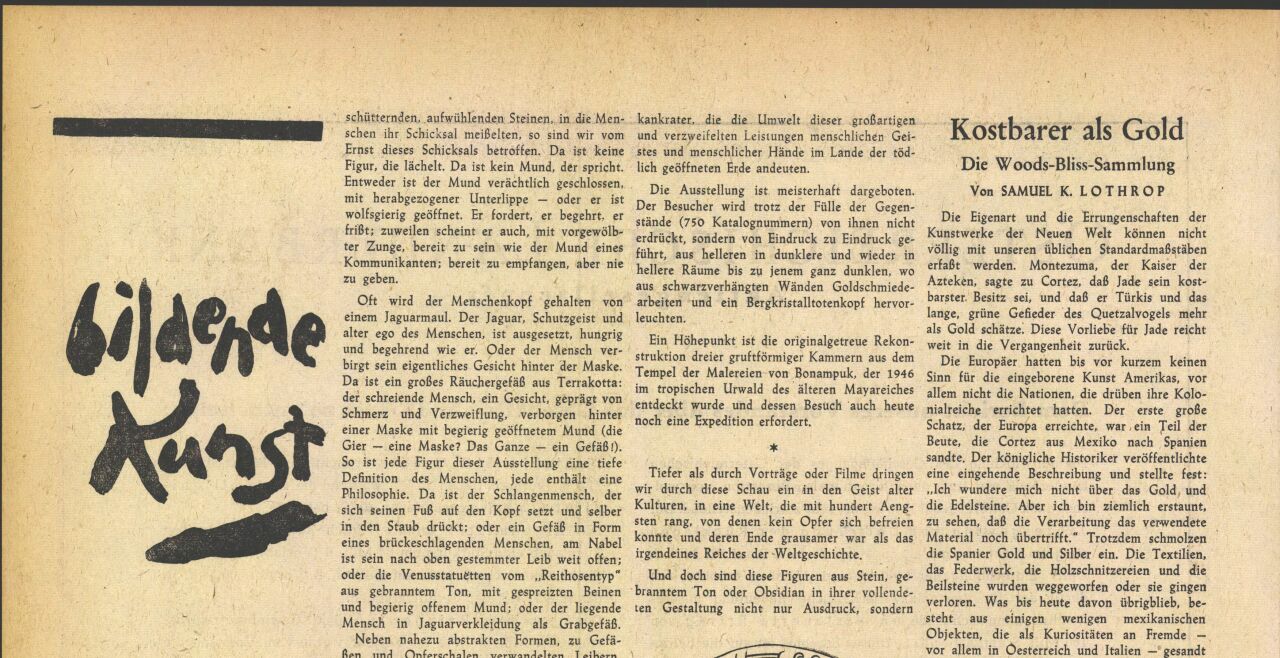
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Volk der Bildhauer
Als die Spanier Guatemoc, den letzten Herrscher der Azteken, folterten, um von ihm die vermeintlich großen Goldverstecke herauszubekommen, rief er ihnen zu: „Was suchet ihr Gold, wo es so viele schöne Blumen gibt in unserem Landl“
An diese Worte wird man erinnert, wenn man in der Ausstellung „Kunst der Mexikaner“ im Zürcher Kunsthaus vor einer Statuette Xochipil- lis, des Blumenprinzen, steht. Xochipilli ist auch der Schutzherr der Tänze, und zu ihm kommt die Herrin der fruchtbaren Liebe. Xochi-
quetzal,., ScJbffiW ederblum§„ ,4jfi JA i§' . wi
Mondgöttin, ln einem kultischen mexikanischen Lidti singt Schmuckfederblume, begleitet von der Zungentrommel:
„Aus Nebel und Regen —
Ich, Schmuckfederblume,
' kam kreisend herab vom Land der Herabkunft.“
Aber sie darf nicht bleiben. Der Blumenprinz, der sie sucht, schluchzt — so erzählt das Lied —, denn er weiß von ihrer Vergänglichkeit, die auch die seine ist. Auch Götter müssen sich selbst zum Opfet bringen, damit die Sonne weiter ihren lebenspendenden Gang gehen kann nach den Gesetzen des Mythos. Schmuckfederblume, die Maisgöttin, muß sterben, um als junge Pflanze aufzuerstehen. Sie singt:
„Hin muß ich gehen, ins Land des Verwesens — oay!“'
Vom Standpunkt des Blumenprinzen und der Schmuckfederblume, ja, recht besehen vom Standpunkt aller Blumen ist der Tod immer ein Sinnbild des Lebens. So sahen es auch die Mexikaner. Leben und Tod gehörten in ihrem Weltbild innig zusammen, wie Opfer und Auferstehung, Tag und Nacht, Erde und Himmel. Im Gründungssymbol ihrer Hauptstadt — der gefiederten Schlange — kommt das zum Ausdruck: sie vereint das Gegensätzliche, ist zugleich Tier der Luft und Tier der Erde.
Und doch behält der Tod für das einzelne, zur Individualität erwachte Wesen immer etwas Furchtbares. Wer diese Statuette Xochipillis ansieht, wird davon berührt. Der Blumenprinz, der in die Sonne blickt, ist blind — seine Augen sind von der Sonne ausgebrannt. Das leben tötet. Erst der Tod bringt wieder Leben hervor.
Gehen wir durch die Säle der großen Ausstellung im Zürcher Kunsthaus , die drei Jahrtausende altamerikanischer Kunst umfaßt (von der archaischen Kultur im Zentralgebiet, 1500 bis 100 v. Chr., und der olmekischen Kultur an der Golfküste, 500 bis 100 v. Chr., reicht sie bis zur aztekischen Kultur 1324 bis 1521 n. Chr. und der Mayakultur im neuen Reich 948 bis 1697 n. Chr.). gehen wir durch die Säle, die erfüllt sind von bestürzenden, er-
Die Ausstellung „Kunst der Mexikaner" wird voraussichtlich im Spätherbst 1959 im Wiener Künstlerhaus gezeigt werden.
schütternden, aufwühlenden Steinen, in die Menschen ihr Schicksal meißelten, so sind wir vom Ernst dieses Schicksals betroffen. Da ist keine Figur, die lächelt. Da ist kein Mund, der spricht. Entweder ist der Mund verächtlich geschlossen, mit herabgezogener Unterlippe — oder er ist wolfsgierig geöffnet. Er fordert, er begehrt, er frißt; zuweilen scheint er auch, mit vorgewölbter Zunge, bereit zu sein wie der Mund eines Kommunikanten; bereit zu empfangen, aber nie zu geben. /
Oft wird der Menschenkopf gehalten von einem Jaguarmaul. Der Jaguar, Schutzgeist und alter ego des Menschen, ist ausgesetzt, hungrig und begehrend wie er. Oder der Mensch verbirgt sein eigentliches Gesicht hinter der Maske. Da ist ein großes Räuchergefäß aus Terrakotta: der schreiende Mensch, ein Gesicht, geprägt von Schmerz und Verzweiflung, verborgen hinter einer Maske mit begierig geöffnetem Mund (die Gier — eine Maske? Das Ganze — ein Gefäß')- So ist jede Figur dieser Ausstellung eine tiefe Definition des Menschen, jede enthält eine Philosophie. Da ist der Schlangenmensch, der sich seinen Fuß auf den Kopf setzt und selber in den Staub drückt; oder ein Gefäß in Form eines brückeschlagenden Menschen, am Nabel ist sein nach oben gestemmter Leib weit offen; oder die Venusstatuetten vom „Reithosentyp“ aus gebranntem Ton, mit gespreizten Beinen und begierig offenem Mund; oder der liegende Mensch in Jaguarverkleidung als Grabgefäß.
Neben nahezu abstrakten Formen, zu Gefäßen und Opferschalen verwandelten Leibern, neben der Fläche des Jaguarreibsteins, stehen expressionistisch-realistische Figuren: Unterschenkel und Fuß als Gefäß, der sich kratzende Hund (auch er ein Krug), ein sitzender Buckliger, Musikanten mit Standpauke und Spondy- lus-Muschel, Ballspieler, Tänzer, ein Jaguar auf Rädern (ein Sonnensymbol?), Eule, Papagei, Schildkröte, Klapperschlange, eine Menagerie intensivsten Lebens. Nicht weit vom Guacamayo- Papageienkopf, einer geschlossenen, Azyklischen“, „allsichtigen" Skulptur mit mehreren Durchblicken, die Henry Moore vorwegnimmt, und der in sich selbst zurückkehrenden, getürmten Schlang —: der stehende Coyote aus rohen blockartigen Steinen, von barbarischer Kraft, den ein Wotruba vor 1000 Jahren schuf.
Die Mexikaner waren ein Volk der Bildhauer und Architekten. Wählte mail a“us allen Skulpturen unseres Jahrhunderts die stärksten aus und r trüge sie ln einem Museum zusammen — fctr‘ weiß nicht, ob sie an das heranreichten, was im alten Mexiko geschaffen wurde. Diese Schau ist eine Hochschule der Plastik.
Damit wir die Architektur nicht verge’ssen, finden wir an den Wänden einige großflächige Photos altamerikanischer Pyramiden und Tempelstädte; daneben Aufnahmen rauchender Vul kankrater, die die Umwelt dieser großartigen und verzweifelten Leistungen menschlichen Geistes und menschlicher Hände im Lande der tödlich geöffneten Erde andeuten.
Die Ausstellung ist meisterhaft dargeboten. Der Besucher wird trotz der Fülle der Gegenstände (750 Katalognummern) von ihnen nicht erdrückt, sondern von Eindruck zu Eindruck geführt, aus helleren in dunklere und wieder in hellere Räume bis zu jenem ganz dunklen, wo aus schwarzverhängten Wänden Goldschmiedearbeiten und ein Bergkristalltotenkopf hervorleuchten.
Ein Höhepunkt ist die originalgetreue Rekonstruktion dreier gruftförmiger Kammern aus dem Tempel der Malereien von Bonampuk, der 1946 im tropischen Urwald des älteren Mayareiches entdeckt wurde und dessen Besuch auch heute noch eine Expedition erfordert.
Tiefer als durch Vorträge oder Filme dringen wir durch diese Schau ein in den Geist alter Kulturen, in eine Welt, die mit hundert Aeng- sten rang, von denen kein Opfer sich befreien konnte und deren Ende grausamer war als das irgendeines Reiches der Weltgeschichte.
Und doch sind diese Figuren aus Stein, gebranntem Ton oder Obsidian in ihrer vollendeten Gestaltung nicht nur Ausdruck, sondern
Zeichnung auf der Rückseite eines Schiefer-Spiegels schon Ueberwindung aller Aengste und Verzweiflungen, so daß wir die Worte Albrecht .Dürers, .er i ; ię -,Jįie erIandi-
schen Reise 1520 21 schrien, als er die Plastiken sah, die Kaiser Montezuma Karl V. hatte schicken lassen: „Ich aber habe all mein Lebtag nichts gesehen, das mein Herz so erfreut hätte, wie diese Dinge. Denn ich sah darunter wunderbare, kunstvolle Sachen und verwunderte mich über die subtilen Ingenia der Menschen in fremden Landen.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!