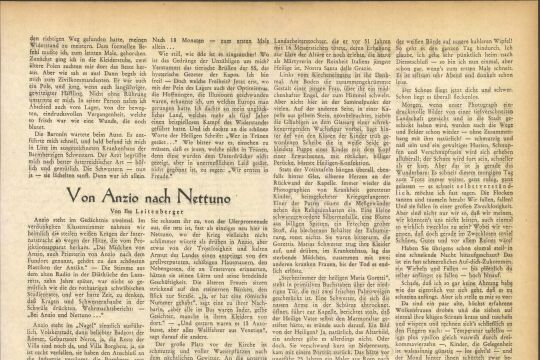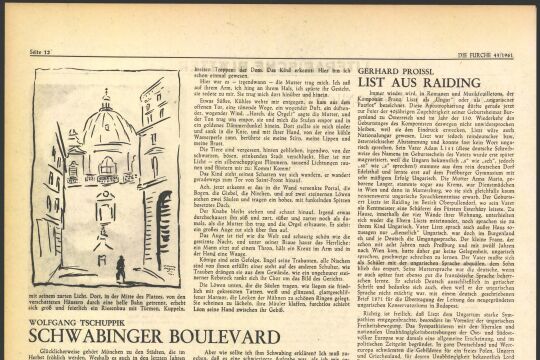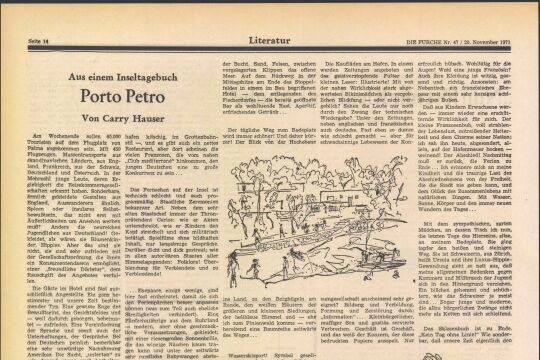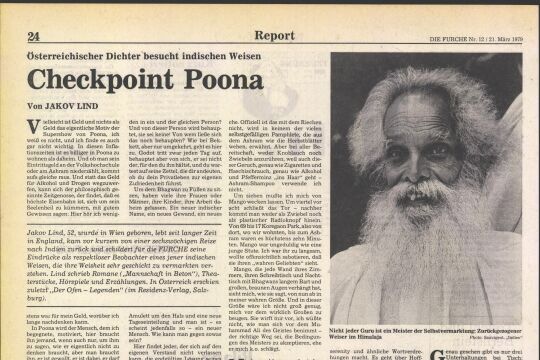Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Den Winter hinter sich lassen
Die Österreicher haben bis jetzt die Bahamas, die 1492 von Kolumbus entdeckt wurden, noch wenig bereist.
Die Österreicher haben bis jetzt die Bahamas, die 1492 von Kolumbus entdeckt wurden, noch wenig bereist.
Unser erster Tag in Nas sau. Die Hauptstadt zieht vorbei. Rosa Häuser, weiße Amtsge-bäude. Jede Menge Touristen in knitterfreien weißen T-Shirts, die großzügig über die Shorts fallen. Bunte Palmenmotive und neonfarbene Schriftzüge auf Bauch und Brust geloben: „It’s better in the Bahamas“. Wir sitzen in einem Surrey, einer knallig lackierten Pferdekutsche, und werdet! Wih Viele ändere Touristen durch Nassaus Straßen bugsiert. Überall Gehupe, Stimmengewirr. Protzige Limousinen, Lieferwagen und flinke Mopeds verstopfen die Kreuzungen. Die Hauptstadt der Bahamas macht einen hektischen Eindruck.
Unser einheimischer Kutscher beschreibt einige Sehenswürdigkeiten der Stadt im breiten Bahamisch, einem sehr naęhlassig gesprochenen Englisch mit starkem Dialekt. Da wäre das altehrwürdige British Colonial Hotel in dezentem Rosa. Daneben der Straw Market. Taschen, Hüte, Dosen, Schuhe, Teppiche - alles aus Stroh. Eine der Marktfrauen ruft einer Touristin hinterher: „Nur zehn Dollar, das ist wirklich billig!“ Doch die Touristin ist schon beim nächsten Stand, und verärgert wendet sich die Marktfrau ab. Sie hat heute noch nichts verkauft.
Auf der zwei Kilometer langen Bay Street zwängt sich unsere Kutsche durch die parkenden Taxilimousinen in zweiter Spur und die mit Touristen vollgestopften Busse, die überall anzutreffen sind. In unserer überdachten Kutsche ist es vor Hitze nicht auszuhalten. Plötzlich muß ich lachen. In Wien hat man mich niemals in einen Fiaker gebracht. Unter den breiten Baumdächern der Wiener Ringstraße habe ich immer die Touristen bedauert. Was ist schön daran, in der brütenden Großstadthitze Abgase einzuatmen und dreispurig im Stau stecken? Und hier gönnen wir uns gleich am ersten Tag einen Blick von oben herab auf Nassau und seine Einwohner.
Bahamas’ Einkaufsstraße zeigt Luxus und Eleganz. Gleißende Juwelen in den Auslagen, Parfümerien, deren Angebot dem von Pariser Geschäften um nichts nachsteht. Boutiquen mit Designerware wie Calvin Klein, Lacoste und Fendi. Touristen eilen auf der Suche nach dem billigsten Angebot hin und her. Die Bahamas sind mehrwertsteuerfrei. Hat man Glück, kostet die Rolex hier nur die Hälfte.
Nun, da haben wir es: Benommen vom gleichmäßigen Tak-Tak der Pferdehufe und an Gold und Glanz vorbeichauffiert, plane ich schon Urlaubssouvenirs. Wir bitten den Kutscher uns aussteigen zu lassen. Er lächelt verschmitzt, glaubt, die Lady habe für ihr Dekollete schon etwas Passendes in der Auslage entdeckt. Irrtum. Wir lassen die Bay Street • weit hinter uns und schlendern an kleinen pastellfarbenen Wohnhäuschen mit winzigen Vorgärten vorbei. Eine ältere Frau schüttelt ihre Bettdecken auf dem Fensterbrett auf. Sie nickt uns freundlich zu. Sie wird sich einen Einkauf in der Bay Street wohl kaum leisten können. Ihre gelbe Baumwollbluse hebt sich von der dunklen Haut ab.
Die meisten der 135.000 Bewohner der Hauptstadt sind dunkelhäutig. Ebenso die Bahamen, die auf Paradise Island, Grand Bahama und den Family Islands leben. Es sind die Nachkommen im 18. Jahrhundert eingeschleppter Sklaven. Die wenigen weißen Bahamen haben englische Siedler und britische Royalisten als Vorfahren. Alles zusammen leben auf den 29 bewohnten der 690 Ba-hamas-Inseln 259.000 Menschen.
DER WATER TOWER
Die höchste Erhebung der Stadt ist der Water Tower. Ein altersschwacher Lift, dessen Gitter man eigenhändig vorziehen muß, befördert uns auf 66 Meter über dem Meeresspiegel. Oben geht ein leichter Wind. Keine Touristen. Nur ein Vater mit seinem höchstens sechs Jahre alten Töchterchen. Er spricht nicht viel, sondern genießt den Anblick der unter ihm liegenden Stadt - seiner Stadt, wie das kleine Mädchen mit den gekringelten Haarzöpfchen verrät. Wieder und wieder fragt sie ihn: „And where’s my school? And where’s home? And where’s mother’s work?“
Wir sehen zur Bay Street hinüber. Ein paar Meter dahinter liegt ein drei Deck hohes Kreuzfahrtschiff im Nassauer Tiefseehafen. Gleich einem Koloß, der an der Inselstadt nagt. Wie winzige Krabbeltiere kommen die Touristen aus dem Bauch des Schiffes und schwärmen in alle Richtungen. Im letzten Jahr besuchten über drei Millionen Menschen die Bahamas - das Vierzehnfache der Einwohnerzahl. Hierher kommen hauptsächlich Amerikanėr, liegt der Inselstaat doch direkt vor Florida. Österreicher haben seine weißen Strände noch nicht entdeckt. 1993 kamen nur 2.410 in die konstitutionelle Monarchie im Commonwealth. Die Angleichung an Ge-wohnheiten und Geschmack der US- Amerikaner ist für Außenstehende stark spürbar, und dafür müssen die Bahamen mehr als Rum und Krustentiere aufbieten, obwohl bereits für den Eigenbedarf Obst und Gemüse importiert werden muß. Eine ebenso geringe Industrie und hohe Arbeitslosigkeit weist den seit 1973 unabhängigen Staat als Entwicklungsland aus — schwer vorstellbar, denkt man an die Bahamas als „Glücksspiel-Paradies“ und internationalem Finanzplatz. Die ergiebigste Einnahmequelle sind jedoch die Touristen, die zum Einkäufen, Relaxen, Golfen und Tauchen auf die Bahamas kommen. Wenn das 70 Prozent des Bruttosozialproduktes ausmacht, ist das Wort Abhängigkeit nur eine gelinde Umschreibung.
Die nächsten Urlaubstage verbringen wir tauchend unter Wasser und lassen uns im Schatten der Palmen wieder aufwärmen. Und wir bekommen auch eine Ahnung von der Sensibilität, mit der im Tourismusbereich agiert wird, als ein Streik der Angestellten unser Hotel lahmlegt. Doch wenn acht von zehn Bahamen landesweit im Dienstleistungssektor arbeiten, hat auch die Gewerkschaft eine starke Position inne.
PEOPLE-TO-PEOPLE
Ob im Freizeitpark Coral World mit den farbenprächtigsten Aquarien, die wir jemals gesehen haben, oder in der Lyford Gallery — wir nutzen jede Minute, um Bahamen über ihr Leben, Familie und Arbeit auszufragen. Auch das Tourismusbüro hilft: Uber das 1975 eingeführte People- To-People-Programm kann jeder Tourist problemlos die Bekanntschaft mit einer bahamischen Familie mit ähnlichen Interessen und Berufen machen.
Ob Krankenschwester, Manager oder Lehrer, bereits 40.000 Touristen ließen sich an eine Gastgeberfamilie für einen Tag „vermitteln“ und wurden nach Hause oder an den Arbeitsplatz eingeladen. Einzige Voraussetzungen für die Bahamen, um in die Kartei aufgenommen zu werden: Kenntnisse über das Land und — ein Auto, um mit den Touristen mobil zu sein.
Wir lernen die Friseurin Janet Morley kennen. Die sympathische Bahamin arbeitet in einem Salon in Nassaus Frederick Street. Die Kunden sind neugierig. Selten verirrt sich ein Tourist, schon gar kein Eu ropäer hierher. Geht es an die Haare, lassen sich meistens nur Touristinnen verschönern, und am Strand für einen Dollar pro Zopf goldene Perlen in die Haare flechten. Frau Morley hat neben der flinken Bewegung ihrer Hände Zeit für ein Gespräch. Die Mutter dreier Kinder arbeitet von neun Uhr morgens bis sieben Uhr am Abend. Großer Reichtum ist nicht angesagt. So kostet ein guter Kindergartenplatz über 16.000 Schilling pro Quartal. Deshalb nimmt die Friseurin manchmal die jüngste, ein vierjähriges Mädchen, mit, die sich dann mit den unzähligen Lockenwicklern beschäftigt. Frau Morley macht alles, was so ansteht: Haareschneiden für Männer, Färben der schwarzen Haare in rotblond für Damen.
Eine andere Seite des starken Wirtschaftszweiges Tourismus wird uns da aufgetan: Der Lebensstandard der Bahamen ist höher als in der übrigen Karibik. Jeder, der im Tourismusbereich arbeitet, benötigt eine spezielle Ausbildung, die jährlich aufgefrischt werden muß. Und die Bahamen schätzen die gute Infrastruktur. Worüber sie sich zu Recht aufregen, sind die hohen Lebenshaltungskosten. Der Durchschnittsverdienst liegt bei 12.000 Schilling pro Monat, die Miete mit etwa 6.000 Schilling und die Sozialversicherung verringern aber das Einkommen erheblich.
Um Nassau nicht mehr von oben herab aus der Pferdekutsche zu begegnen, reisen wir in öffentlichen Kleinbussen. Mit manchem Umweg über die Vororte beginnt an jedem Urlaubstag eine neue Reise in diesem wunderschönen Land. Und dabei habe ich hin und wieder die hohe Stimme des kleinen Mädchens im Ohr, die ihren Daddy auf dem Wasserturm ausfragte: „Where’s my home? Where’s mothers work?“
Die Autorin ist
Redakteurin im „Südwind“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!