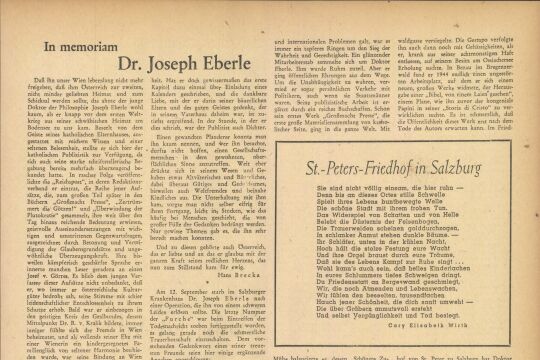„Ferdinand Ebner ist eine Erscheinung, von der man glauben möchte, sie sei heutzutage nicht mehr möglich: ein epochemachender Denker, von dem die Welt sogar noch nach seinem Tode nichts weiß.“ So schrieb der protestantische Theologe Emil Brunner 1935, vier Jahre nach Ebners Tod. Und heute, da Ebner schon dreißig Jahre im Grabe liegt, kann man außerhalb engerer Fachkreise, wenn die Rede auf ihn kommt, noch Feststellungen hören wie: „Ebner? Das war doch ein Volksschullehrer, irgendwo in einem Dorf, der hat doch so ein komisches Buch geschrieben!" Oder: „Ebner? Aber ich bitte Sie, das war doch ein Autodidakt!" Oder: „Ebner? Oh, Sie kennen die Ebner? Die ist doch einfach fabelhaft, die Jeannie, nicht wahr? Was? Ferdinand? Kenne ich nicht!“ (Jeannie Ebner ist Ferdinand Ebners Nichte.) Oder gar mit amtlicher Prägnanz: „Ein Philosoph namens Ferdinand Ebner ist hieramts unbekannt.“
Wer ist dieser „epochemachende Denker", der einen „Umbruch des Denkens“ (Steinbüchel) eingeleitet hat, mit dem eine „kopernikanische Revolution des Denkens“ (Brunner) beginnt und über den doch bis auf den heutigen Tag selbst von Leuten, die in ihrem Fach recht tüchtig sind, Urteile wie die oben angeführten gefällt werden können? Zur Ehrenrettung aller, die sich vielleicht betroffen fühlen könnten, sei betont, daß es heute schwierig geworden ist, überhaupt eine Original- zeile von ihm unter die Augen zu bekommen. Denn nur ein geringer Teil seines schriftstellerischen Schaffens ist überhaupt veröffentlicht worden, und was erschienen ist, ist meist seit vielen Jahren vergriffen. Den Versuchen, eine Gesamtausgabe zu veranstalten, war bisher kein Erfolg beschieden, und so ist es weder eine Schande noch eine Bildungslücke, wenn man Ebner nicht kennt; wohl aber ein Nachteil, ein — mit Verlaub gesagt — existentieller Mangel, dem nur der nicht unterworfen ist, der ein Christentum lebt, das wie Ebners Glaube seine Kraft aus der persönlichen Begegnung mit Jesus Christus schöpft.
Ferdinand Ebner ist am 31. Jänner 1882 in einer bürgerlichbäuerlichen Familie zu Wiener Neustadt geboren. Schon als Kind mit einem Hang begabt, den Dingen auf den Grund zu gehen und das Leben nicht leicht zu nehmen, wurde er Schüler des Wiener Neustädter Lehrerseminars. Da er mit der schmalen Anstaltskost nicht zufrieden war, begab er sich bald auf geistige Entdeckungsfahrten. Er hängt seinen katholischen Kinderglauben in den Schrank, wird Materialist, Atheist, versucht sich als Dramatiker und Lyriker, wird Goethe-Schwärmer, Pantheist, Deutschtümler, Antisemit — absolviert aber alle diese Anwandlungen wie Feuchtblattern und Masejn bis zum Beginn seines dritten’Lebėnsjahrzehntš und’ist daifit für sein ganzes Leben gegen Anfälle die ‘ttf’ Art immunisiert Er wird Volksschullehrer in Waldegg an der Hohen Wand, stifdiert, exzerpiert und glossiere unwahrscheinliche Mengen poetischer und philosophischer Originalliteratur. Er beginnt selber Aphorismen zu schreiben und verfaßt - seit 1912 Lehrer in Gablitz im Wienerwald — im Gefolge Hertri Bergsons und Hermann Swobodas ein umfang reiches philosophisches Werk, eine „Metaphysik der individuellen Existenz“. Hamann, Pascal und Kierkegaard weisen ihn dann auf das Christentum, das er in seinem 35. Lebensjahr wie ein ganz unbekanntes Land betritt.
ki Jahre 1919 wuchs aus seinen umfangreichen Notizen und Tagebucheintragungen ein Buch, „Das Wort und die geistigen Realitäten“, das durch Vermittlung Theodor Haeckers in Ludwig Fickers Brenner-Verlag veröffentlicht wurde. Der Brenner-Kreis blieb von da an Ebners geistige Heimat. Die „geistigen Realitäten“ sind für Ebner das konkrete Ich und das konkrete Du und das, wodurch Ich und Du verbunden sind: das subjektive „Vehikel“ der Liebe und das objektive des Wortes. Von drei
Seiten, nämlich von der Erkenntnis der existentiellen Bedeutung des Wortes für den Menschen, von der Etymologie und von der Deutung des Johannesprologs kommt Ebner zu seiner „pneumatologischen“ Auffassung des Wortes, in dem er das iinnertrinita- riische Wort des Vaters, das Schöpferwort Gottes als Urgrund der Welt, die „Anrede“ Gottes an den Menschen als Ursache der Menschwerdung und schließlich als Wort, das Fleisch geworden ist, die Selbstoffenbarung Gottes und die Erlösung des Menschen sieht. Lange, bevor Existenzphilosophie Mode wurde, war Ebner auf die Notwendigkeit existentiellen Denkens aufmerksam geworden, bevor die Etymologie zum legitimen Rüstzeug des Sprachphilosophen erklärt wurde, bahnte Ebner sich einen Weg in ihren Dschungel — damals wahrlich eine „bahnbrechende“ Tat. Daß er sich diesen Weg mit dem Buschmesser und nicht, wie es heute üblich sein mag, mit dem Bulldozer bahnte, macht sein Unternehmen erst recht zu einer Pioniertat ersten Ranges und darf ihm nicht, wie es geschieht, als Mangel ausgelegt werden. Auch seine ins Theologische reichenden Gedanken über das Wort sind heute weithin in das Denken der Zukunft eingegaijgen, wenn auch, wie Pfliegler sagt, anfangs manche den „Geist, der eine neue Tür aufstieß, mit einem Gespenst verwechseln“ mochten.
Ebner war aber nicht, wofür ihn manche halten, nur ein einsamer Schreibtischgrübler. Wohl war ihm der Schreibtisch der Ort der Besinnung, der Sammlung, des geistigen Ringens. Die kaum übersehbare Fülle seiner Schriften, Tagebücher, Notizen, Entwürfe und Briefe allein beweist schon, wie sehr er ihn geschätzt hat, Aber vor allem in seinen jüngeren Jahren, bevor ihn sein Siechtum mehr und mehr ans Zimmer fesselte, war ihm daneben das Kaffeehaus der Ort der Begegnung: der Begegnung mit Zeit und Welt in den Zeitungen, in die er sich oft halbe Tage lang vergrub, und der Begegnung mit den Menschen, mit Freunden und „Freunden“. Da wurden, wie zum Beispiel mit dem Komponisten J. M. Hauer, im Cafe Lehne in Wiener Neustadt musiktheoretische Pläne ausgeheckt, da konnte er im Cafe Akademie in Wien mit Josef Rauscher stundenlang „philosophieren“ — eine Tätigkeit, die er im Grunde verabscheute und doch nicht lassen konnte —, da traf er zum Beispiel im Cafe Imperial Adolf Loos, der ihn als Lehrer für einen neuen Schultyp gewinnen wollte. Der dritte Ort, an dem Ebner sich mit Vorliebe aufhielt, war — nicht das Schulzimmer; dagegen hatte er eine geradezu konstitutionell bedingte Abneigung, sondern — die Natur, der Wienerwald, die Hohe Wand, der Pailerstein, der Troppberg. Dorthin zog er sich zurück, wenn der Druck des Lebens, des Dunklen, das über ihm lastete, übermächtig wurde. So war Ebner wohj ein Mensch, in dem wohl zu jeder Zeit das Geistige den Vorrang hatte, der aber doch nicht abseits Von der Zeit lebte, und der Gegenwart und Zukunft mit wachen Augen zu sehen und zu deuten wußte.
Darin, in der Deutung der Zeit, war Ebner, das kann man ruhig sagen, ein Schüler des Karl Kraus. Schon im ersten Dezennium der „Fackel" war er ihr Leser geworden. Er las sie anfangs mit einigem Unbehagen, hatte er doch erst die Folgen des antisemitischen FiebeTS zu überwinden, das damals in diesen Kreisen endemisch war, bald aber mit wachsender Faszination. Er lernte von Kraus das Wort als Indizium des Geistes oder Ungeistes seines Sprechers durchschauen, er schärfte bei diesem unerbittlichen Zuchtmeister sein Sprachgewissen und gewann in seiner Schule den sicheren Blick für die Hohlheit von Phrasen und Gesten, der auch von sogenannten „geheiligten“ Werten sich nicht blenden ließ Freilich, es hätte keinen Sinn, Ebner mit Kraus zu vergleichen. Denn während dieser schon mehr als zwei Jahrzehnte von seinem Kampf mit der Öffentlichkeit geistig gelebt hatte, war Ebner öffentlichkeitsscheu und verschloß fast bis zu seinem vierzigsten Lebensjahr alles, was er geschrieben hatte, in seinem Schreibtisch. Nur ganz selten konnten Freunde ihn dazu bewegen, sie überhaupt nur einen Blick hinein tun zu lassen.
War Ebner bei Ausbruch des ersten Weltkrieges zuerst noch von einer patriotischen Gefühlswelle überspült worden, so stellte sich bald eine starke Ernüchterung ein. Er durchschaute die Hohlheit des pseudopatriotischen Pathos, hinter dem sich nur oft Kollektiveitelkeit, Geschäftsgeist oder Schlimmeres verbarg. Sein Mißtrauen gegenüber dem „Ethos“ der Dynastie wurde allmählich zur Ablehnung. Vollends aber hinter dem Überschwang des Deutschnationalismus sah er schon im Weltkrieg die apokalyptische Larve des künftigen Nationalsozialismus grinsen. Sein „Kriegstagebuch“ und viele spätere Notizen und Aphorismen, in denen er die wichtigsten Ereignisse der Zeit kommentierte, zeigen ihn als Seher, der gewiß über die Hitler- Zeit, vielleicht aber auch noch über unsere Zeit vorausgesehen hat. Dabei hat Ebner schon in jenen Jahren österreichisches Selbstbewußtsein besessen, das in vielen anderen erst durch das Erlebnis der Auferstehung nach dem zweiten Weltkrieg erweckt wurde.
Aus Ebners unbestechlichem Gerechtigkeitssinn, der den Deckmantel einer Tradition, einer bürgerlichen, einer nationalen oder einer christlichen, nirgends gelten ließ, ist seine Sympathie für die Sozialdemokratie zu verstehen, die sie sich freilich durch ihren oberflächlichen Fortschrittsoptimismus, durch ihre flache Wissenschaftsgläubigkeit und ihre Allianz oder Personalunion mit der Freidenkerbewegung allmählich wieder verscherzte. Jedenfalls schlug sein Herz in verschiedenen Krisenzeiten der ersten Republik, etwa beim Schattendorfer Prozeß, beim Justizpalast- bTand oder beim Pfriemer-Putsch. eindeutig links.
Die Ereignisse in Wissenschaft und Philosophie, Dichtung, Kunst und Musik seiner Zeit verfolgte Ebner mit wachem Blick. Er studierte die Psychoanalyse und entdeckte, lange bevor Kathederpsychologen sie überhaupt ernstgenommen hatten, ihre starken und schwachen Stellen. Ihr und der Wissenschaft überhaupt wirft er von der sicheren Position seiner Pneumatologie aus die Todsünde der Atomisierung der Seele, der Entpersönlichung des Menschen vor, der Kunst und der Philosophie aber das Versinken im „Traum vom Geist“, das Verfehlen der geistigen Realitäten. Ebners Kritik ist nicht Kulturpessimismus, etwa die Befürchtung, die europäische Kultur sei wegen organischer Altersschwäche zum Sterben verurteilt. Ebner sieht tiefer: Es ist ihr „pneumatologischer“ Defekt, was sie, wenn sie nicht zur Besinnung kommt, ins Verderben stürzen muß, der Verlust der Ich-Du-Relation; letztlich aber der Verlust des Wortes, das Nichtverstehen des Wortcharakters aller Kunst und Kultur.
Ein sehr eigenartiges, fast möchte, man sagen , zwiespältiges Verhältnis hat Ebner zur Musik. Schon von Kindheit an musizierte er. Als Junglehrer spielte er fast täglich ein paar Stunden Klavier, arbeitete sich in die Werke Beethovens, Haydns, Schuberts ein und fand schließlich in Mozart sein musikalisches Ziel. Dabei war er fast zwanzig Jahre lang treuer Weggefährte des eigenwilligen Zwölftöners Josef M. Hauer, mit dem ihn eine etwas labile Freundschaft verband. Sehr weit ging er mit ihm, suchte sich in die neue Musik einzuhören, half Hauer bei der Abfassung musiktheoretischer Abhandlungen, lieferte ihm die Texte für Hölderlin-Lieder und Sophokles-Chöre, unterstützte die Vorstöße der „Atonalen“ in die „Provinz“, anläßlich von Konzerten Hauers in St. Pölten und Wiener Neustadt, interpretierte in einem umfangreichen Aufsatz Hauers „Apokalyptische Phantasie", aber schließlich scheiterte ihre Freundschaft — abgesehen von persönlichen Schwierigkeiten — daran, daß Ebner das „Wort“ für das Kriterium des Menschseins hielt, Hauer aber das „Melos“, und daß sie zwischen diesen Auffassungen keinen Kompromiß fanden. Von dieser Freundschaftskatastrophe an fand Ebner kein tieferes Verhältnis mehr zu dieser neuen Musik.
Besonders widerspruchsvoll aber scheint Ebners Verhältnis zur katholischen Kirche. Seit seiner „Wende" im Jahre 1916 ein glühend gläubiger Christ, bedachte er die Kirche, der er immer angehört hat, wegen ihrer äußeren Repräsentation, aber auch wegen der Art ihrer Lehrverkündigung und Akzentsetzung darin mit scharfer, manchmal sogar ätzender Kritik. Aber trotz aller Schärfe, ja Schiefheit, und manchmal auch Ungerechtigkeit seiner Kritik erweist sich diese als eine Kritik von innen, aus einem im Grund katholischen Denken. Trotz seines Protestierens gegen den politischen Brauch oder Mißbrauch der Kirche, trotz seiner starken Betonung des Evangeliums, ist Ebner kein „Protestant“ und erst recht kein Sektierer. Er hat in seiner ungebärdigen, aufbegehrenden Art, die im Grunde doch unglückliche Liebe zur Kirche ist, manche Ähnlichkeit mit Erscheinungen wie Leon Bloy oder Charles Peguy. Daß er an seinem Lebensende auch noch in die sakramentale Gemeinschaft der Kirche zurückgefunden hat, läßt erkennen, daß er in Wahrheit wohl niemals ganz draußen stand.
Ebner hat es zu jeder Zeit allen, die sich mit ihm abgeben wollten, schwer gemacht — niemandem freilich so schwer wie sich selbst. Er erscheint den Philosophen ein dilettierender „Mystiker", den Theologen ein halber Häretiker, den Psychologen ein Psychopath, den friedlichen Bürgern ein schrulliger Sonderling, den „Roten“ ein „katholischer Philosoph“, den „Schwarzen“ ein rotläufiger „Antiklerikaler", kurz, ein unbequemer, weil unbedingter Mensch. Wer noch näher zusieht, erkennt, daß er ein tief Leidender und ein wahrhaft Liebender ist, der auch dort liebt, wo seine Worte um seiner Liebe willen verletzen und der um jedes verletzenden Wortes willen erneut leidet. Ein Denker, dem Wahrheit und Wahrhaftigkeit Element des geistigen Lebens ist und der unserer Zeit gerade deshalb ein mahnendes Gewissen sein kann. Wenn im nächsten Jahr der erster Band einer repräsentativen Ausgabe seiner Werke (im Kösel-Verlag in München) erschienen ist, werden alle, die wachen Geistes sind, Gelegenheit haben, sdch von diesem Mahner ins Gewissen reden zu lassen. Denn auch von ihm gilt, was er ähnlich von Kierkegaard sagt: Wer ihn gelesen und verstanden hat, der muß sein Leben ändern.