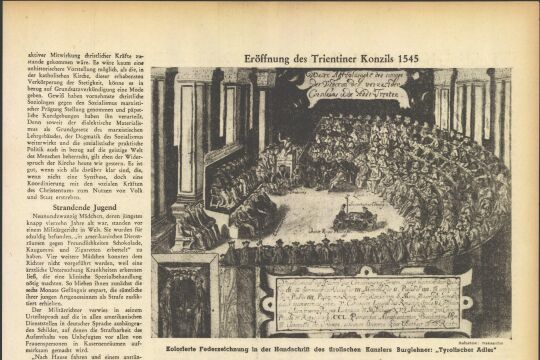Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der bestohlene Dieb
Herr, im Evangelium steht geschrieben, du werdest kommen wie ein Dieb. Der Dieb kommt des Nachts, und erst am Morgen bemerkt man die verschobene Eisenstange, das erbrochene Türschloß, das offene Fenster — oder jenen verdächtigen Fleck auf dem Gesicht und jenen sonderbaren Schmerz in der Seite. Zuweilen kommt es vor, daß man wohl etwas gehört hat, doch war es unseren Träumen oder allen vertrauten Geräuschen des Hauses oder dem Gespräch mit unseren Freunden beigemengt. Ich erinnere mich jetzt, daß ich mehrere Nächte hintereinander das Telephon läuten hörte, daß aber, als ich den Hörer abhob, sich niemand meldete. Wir brauchen nur mehr die Schäden, so gut wir können, zu reparieren; welch komische Wahl hat dieser brutale Einbrecher zwisdien unseren armseligen Schätzen getroffen! Aber schließlich, der Dieb ist hier gewesen — wären wir wenigstens gewiß, daß er wieder weggegangen ist!
Aber es gibt andere, weniger einfache Verfahren des Diebstahls als den Einbruch. Es gibt Spitzbuben und Gauner. Es gibt den Bankier, der pleite macht. Den Sekretär, der durchbrennt. Es gibt lange Prozesse, aus denen man so nackt hervorgeht, wie ein kleiner Sankt Johannes. Es gibt die Differenzen im Spiel und an der Börse. Fs gibt den Geschäftsmann, der das Mittel findet, aus einem nicht nur sein Opfer, sondc-^ auch seinen Komplicen zu machen. Spi st du auch auf diese Art von Diebstählen in deinem Gleichnis an, o Herr? Warum nicht? Habe ich nicht gerade von jenem Unglücklichen, der, um seine Brieftasche erleichtert, sich mit drolliger Entrüstung die Rippen betastet, gesdirieben, er „finde sich w i e d e r“? Und ist nicht oft der erste Schrei eines lächerlichen Adams gegen seinen Schöpfer jene klägliche und triumphierende Feststellung eines Mundes ge-gewesen, der gegen seinen Willen nichts anderes hervorbringt als die Wahrheit: „I c h bin wieder zurechtgemacht!“
Ein Dieb ist, wer sich dessen bemächtigt, was nicht ihm gehört. Hier hält meine Feder inne und fragt: Es gibt also Dinge, Herr, die nicht dir gehören? Ich weiß, daß du es bist, der sie aus dem Nichts gezogen hat und daß sie ohne die Stütze deines erhaltenden Wortes, das nicht in der Zeit, sondern in der Ewigkeit ertönte, ins Nich zurückkehren würden. Da du sie uns aber gegeben hast, gehören sie dir nun nicht mehr als ein Gemälde dem Maler, der es verkauft hat, gemäß dem Rechtsgrundsatz: geschenkt ist geschenkt. Hierauf antwortet mir jemand an eurer Stelle, et gäbe „Besitz de facto“ und nicht „Besitz de j u r e“, und d'eser Besitz — da durch keinen Titel gerechtfertigt — bleibe vom Absoluten durch die aufsdiiebende Bedingung getrennt, wie er durch seine aufhebende Bedingung zur Verjährung gebracht wird. Nur der besitzt, der der legitime Herr ist, den vorübergehend Eingifcdenen ist nur der Genuß eingerlumt.
Unser Recht auf die Dinge ist veränderlich und prekär, denn schließlich gehören sie uns nicht wesentlich, und wir sind nur das Werkzeug, das beauftragt ist, sie ihrem Zwecke zuzuführen. Wie soll man sich also wundern, wenn Primus von Zeit zu Zeit durch Verfahren, die wir als Gewalttätigkeit oder Betrug bezeichnen, diese Güter zurückfordert, die wir entwendet haben und die seine Stimme mehr beachten, als sie unsere Türsddüssel respektieren? Indessen hast du, Herr, sie uns lange genug gelassen, daß wir sie durch unser Gepräge bezeichnen konnten. Sollen wir glauben, du, der du der Schöpfer bist, seist begierig, unser Vorgehen zu sehen, du seist wie ein stiller Gesellschafter an unseren Geschäften interessiert, und du erlaubest dir als gelehrter Experimentator, als Beobachter unserer Reaktionen oder, wie die heiligen Bücher sagen, als Versucher, von Zeit zu Zeit Proben von uns selbst oder von unseren persönlichen Fabrikaten einzu-heben?
Denn was sonst könntest du damit machen? Ich begreife, daß die Sonne und die Sterne dir gehören. Aber diese gläserne Statue Garibaldis und dieses Grammophon — wie stellst du es an, sie dir anzueignen? Ich verstehe, daß die alten Magier dir Opfer an Butter und Blut gebracht haben. Aber mein Mobiliar im unednen Louis-XV.-Stil, mein Diktionär Larousse und die illustrierte Gesamtausgabe Victor Hugos, die durch die Feuersbrunst in Rauch und Flammen aufgegangen sind — konnte ihr Geruch deiner Nase wirklich wohlgefällig sein? Was konnte dir mein Paket Aktien der Goldminen Uruguays bedeuten? Und warum nimmst du mir plötzlich diesen Arm oder dieses Bein oder dieses kleine Räderwerk meines Ohrs, die dir nichts nützen, mir aber dazu dienten, das Brot für meine Kinder zu erwerben? Du nimmst auf den Werken deiner Hände eine seltsame Bildhauerarbeit vor, alle Arten von Einkerbungen und Verstümmelungen. Es steht in der Tat geschrieben, es sei besser, mit einem Bein oder einer Hand oder zum Eunuchen und Einäugigen gemacht, ins Himmelreich einzugehen, als mit seinen vier Gliedern ins Barathrium gestürzt zu werden. Und zweifellos endigt, was als Statue begonnen hat, unter der Wirkung der Zeit als Schlüssel, dieser Schlüssel, der ohne Schloß unerklärlich wäre. Wir sind wie jener dumme Chinese, von dem das chinesische Märchen erzählt, er sei, da er mit einer quer über seine Schultern liegenden Stange als Wasserträger nicht durch die schmale Tür seines Hauses gehen konnte, auf den Einfall gekommen, diese Stange entzweizusägen. Da es uns nicht einfällt, uns selbst im Profil zu stellen, muß unser Schöpfer sich wohl seufzend darein ergeben, uns mitten auseinanderzuschneiden.
Herr, es steht geschrieben: „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Magd, noch seinen Ochsen oder seinen Esel.“ Und doch bist du es, der die Dinge, ohne daß es dich danach gelüstet, in der Art des Gerichtsvollziehers und des Steuereinnehmers nimmt, und nun habe ich gerade meinerseits wie die Kameraden mein kleines Stempelpapier erhalten. Ich gebe dir also gern meinen Ochsen, jetzt, da .er die schmale Furche rings um den Acker gezogen hat, auf dem au meinem Bedauern so wenig Ähren gekeimt haben. Und ich übergebe dir auch ohne Tränen die Halfter jenes anderen Aufsehen erregenden Tieres, das mich genügend lächerlich gemacht hat. Aber ich bitte dich demütig, du mögest mir nicht meine Seele nehmen. Ich bin alt, bin an sie gewöhnt, und ich frage mich, was du mit der durch die Nacht entstellten A n i m a anfangen könntest! Ach, ich glaubte sie gut versteckt zu haben, konnte sie aber nicht ganz vor dem Spion verbergen, der gleich dem Vollmond durch alle Löcher der Mauer lugt! Ich hätte nie geglaubt, du würdest sie unter der Maske erkennen, mit der ich sie nach Art der Tibetaner durch eine Mischung von Fett und Ruß bedeckte; vergeblich habe ich ihr den Kopf rasiert, wie man es den jüdischen Frauen an ihrem Hochzeitstage macht. Während der langen Jahre, die ich sehr ruhig mit ihr zusammen lebte, kann ich ihr kein größeres Lob aussprechen, als daß es wahrhaftig so war, als existierte sie nicht. Das Haus war warm, das Mittagmahl zu rechter Zeit bereit, sie sagte „ja“ zu allem, was ich vorschlug, und ich zolle der bescheidenen Art, mit der sie beiseite trat, wenn ich ihrer nicht bedurfte, volles Lob. Hatte sie zuweilen etwas zu sagen, so dauerte es nie lange, nnd die erzürnten Falten meiner Stirne -genügten, sie zum Schweigen zu bringen. Es ist erstaunlich, wieviel ich Schriftstellern konnte, ohne daß es ihr eingefallen wäre, mir über die Schulter zu gucken! Ich gestehe daher, daß es mir einen Schlag versetzte, als ich darauf kam, es gäbe in der Tat kein Mittel, diese heimliche Korrespondenz unbemerkbar zu machen. Während ich schlief oder artig die Perlen meines Rosenkranzes durch die Finger laufen ließ, ist jemand wie ein Dieb zu mir gekommen. Anima ist nicht mehr dieselbe. Dieses strahlende Antlitz ist nicht mehr mir zugewandt, auch diese Augen nicht, die nicht mehr von dieser Erde sind, und diese grausamen Lippen, die schon z\j einem Geständnis erbeben, das ich bald nicht mehr zurückzuhalten imstande sein werde! Herr, ich bitte dich demütig, du mögest mir diese Anima, die zu deinen
Füßen Regt, zurückgeben; unter dem Verwände, sie habe den besseren Teil erwählt, will sie nicht mehr mit mir zurückkommen. Ich frage mich, was sie ohne mich, der ich soviel mehr weiß als sie und der ihr doch recht wohl einige Ratschläge erteilen könnte, anfangen wird? Aber schließlich ist das ihre Sache, und die meinige ist das herannahende Alter. Was wird aus mir ohne Anima werden, die meinen Haushalt in Ordnung hielt und die — wenn es auch wahr ist, daß sie nicht viel sagte — nichtsdestoweniger da war? Es bleibt mir nichts mehr übrig, als, wie es die Alten in meinem Dorfe machen, einen Korb zwischen den Beinen, Bohnen auszuschoten und mich dabei der vergangenen Tage zu erinnern.
(Aus dem im Programm der Amandus-Edition vorgesehenen Bande. Paul Claudel, Figuren und Parabeln. — Autorisierte Übertragung von Josef Ziwutschka.)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!