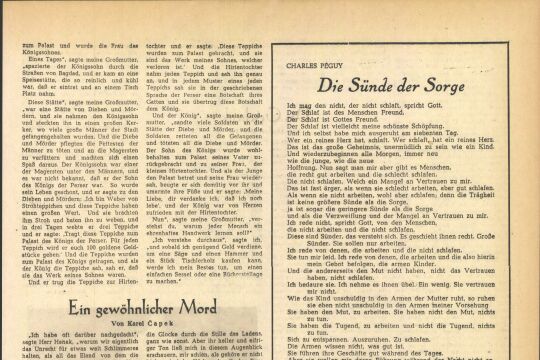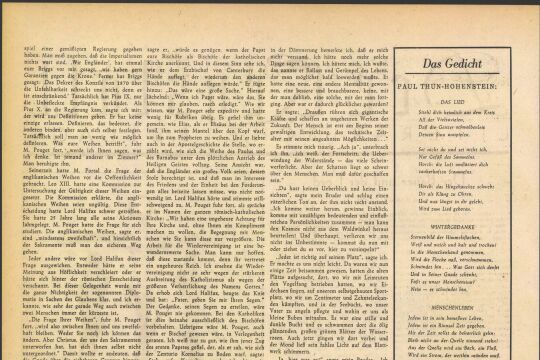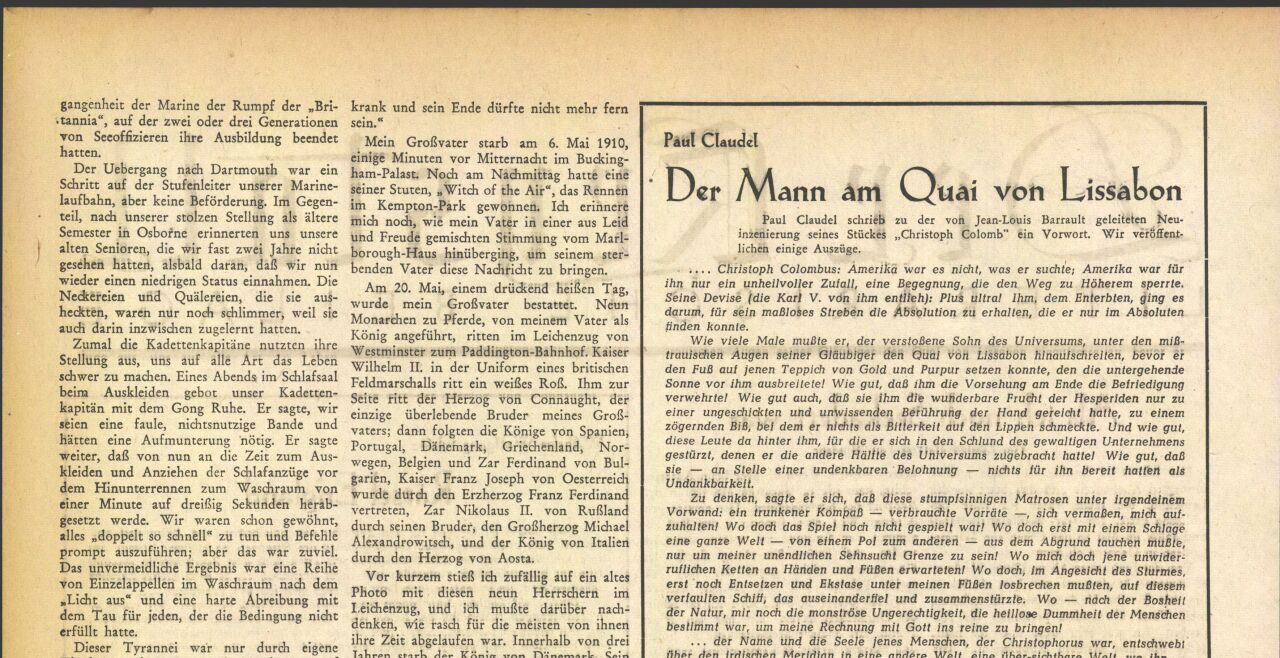
Der junge Dichter war zwar arm, aber dabei zufrieden und glücklich. Er besaß wenig, verdiente fast nichts, dies alles aber störte ihn nicht, da er ja eben ein Dichter war.
Wäre der junge Dichter noch ärmer, sozusagen vpllig besitzlos gewesen, so wäre dies für ihn wahrscheinlich ein noch größeres Glück gewesen, denn dann hätte er völlig ungestört von Besitz und den Sorgen, die dieser bereitet, in den Wäldern wandern und dichten können. So aber besaß er eine Wiese, eine kahle, grüne, harmlose Wiese, in deren Mitte sein etwas baufälliges Holzhaus stand, in dem er lebte. Da er ja schließlich ein Dach über sich haben mußte, war gegen das Holzhaus nichts einzuwenden, aber die Wiese wurde ihm zum Verhängnis.
Eines Tages besuchte den armen jungen Dichter ein Freund, der eine praktische und erfolgreiche Persönlichkeit war, die im tätigen Leben stand. Er hatte es zu einem schönen Auto, einer hohen Stellung und einem Bankkonto, wohlweislich im sicheren Ausland, gebracht.
„Höre!“ sagte der gute Freund und blickte sich unbehaglich und mißbilligend in des jungen Dichters ramponiertem Heim um, „wie lebst du nur! Es ist erbärmlich!“ Der Dichter wurde verlegen und stopfte rasch verstohlen ein altes Tuch in eine Fuge in der Balkenwand, durch die der Wind hereinzog. „Erbärmlich?“ fragte er, „ich fühle mich aber ganz wohl hier.“
„Ich sehe da draußen eine größere, nicht üble Rasenfläche“, sagte der Freund, „gehört sie am Ende dir?“ „Ja“, erwiderte der arme Dichter, „sie gehört wirklich mir, die Wiese. Ich habe sie geerbt.“
„Hör zu!“ sagte stirnrunzelnd der wohlhabende Freund, „ich habe den Wunsch, etwas für dich zu tun, um dich deiner üblen Lage und Weltfremdheit zu entreißen. Sicher kannst du doch außer deinem Dichten noch nebenher etwas anderes tun, oder nicht?“ „Ach ja, zur Not!“ sagte der junge Dichter, „wenn es nicht gerade in einem Bergwerk oder Büro getan werden muß!“
„Unsinn!“ sagte der weltläufige Freund, „du sollst nur auf dieser prächtigen Rasenfläche eine Hühnerfarm beginnen, um eine anständige Existenz zu begründen. Ich werde dir etwas Geld vorschießen“, fuhr der Freund fort, und er war sehr bewegt bei dem Gedanken, etwas für die Freundschaft und die Kunst zu tun, „damit wird man einen Stall bauen, ein Gehege ziehen, ein paar hundert Eintagskücken anschaffen und eine Farm beginnen.“ Der junge Dichter fand dies sehr gütig, wandte jedoch ein, daß er kein Hühnerfachmann sei. „Unsinn!“ rief der gute Freund, „das sind doch keine Gegenargumente! Man liest ein paar Broschüren, tritt einem Verein bei, und alles weitere entwickelt sich von selbst.“
Der junge Dichter fügte sich seinem wohlmeinenden Freunde. Die Stallungen wurden gebaut, die Kücken langten an. Es waren reizende, winzige, goldgelbe Dinger. Alle zwei Stunden mußte der Dichter sie füttern, tränken, eine bestimmte Temperatur im Stall erhalten, heizen, lüften, ausmisten und bei Tag und Nacht tätig sein. Er konnte nicht mehr in den Wäldern wandern und dichten! Dennoch starben die kleinen Dinger, in Mengen und rasch, bald war die erste Hälfte dahin.
„Ach, da haben wir eine seltene und höchst interessante Geflügelseuche!“ sagte der herbeigerufene Tierarzt, „da können wir leider gar nichts tun, als eine sehr instruktive Sterblichkeitsstatistik anzufertigen!“ und dies tat er. Indessen starben die restlichen Kücken. „Ein erstaunliches Resultat“, äußerte der Tierarzt begeistert, „hundert Prozent letaler Ausgang. Aeußerst informativ!“ Und er meldete es dem Veterinärforschungsamt in der Hauptstadt.
Als dann der wohlmeinende Freund in seinem herrlichen Automobil vorgefahren kam, sagte er zu dem armen Dichter: „Das war nicht vorherzusehen, es tut mir leid!“ „Ja, mir noch mehr“, sagte der Dichter, „alle die reizenden kleinen Kücken sind tot. Welch ein Jammer! Und zu all dem hast du nun auch noch bedeutenden finanziellen Schaden!“ „Keineswegs!“ sagte der Freund, „wir werden das regeln. Wir nehmen eine Hypothek auf dein Grundstück, und dadurch wirst du mich schadlos halten können. Denn ich möchte wirklich nicht, daß das Gefühl, mir etwas schuldig zu sein, dich am schöpferischen Wirken hindert, weißt du?“ „Ach so!“ sagte der junge Dichter und verstand, „das ist aber schön von dir!“ Und so geschah es.
Nun gehörte dadurch dem jungen Dichter die Wiese eigentlich nur mehr zur Hälfte. Und eine Hühnerfarm besaß er auch nicht, wenn er auch dem Veterinärforschungsamt zu erheblichen Einsichten verholfen hatte. Dennoch atmete er auf und konnte nun wieder ungestört in den Wäldern wandern und dichten.
Da aber kam nach einiger Zeit wieder sein geschäftstüchtiger Freund zu ihm und sagte: „Ich sehe, daß die Rasenfläche noch immer brachliegt. Ich kann unausgenützte Werte nicht daliegen sehen. Ich kann dich auch nicht deinem trostlosen Geschick überlassen und weiter so dahinvegetieren lassen. Wir müssen dir doch eine wirtschaftliche G.-undlage verschaffen!“ Der junge Dichter sah seinen Freund argwöhnisch an.
„Diesmal habe ich etwas im Sinn, das dir leichtcrfallen wird“, fuhr dieser fort, „ich denke da an eine Rassehundezucht. Die Rasenfläche schreit ja förmlich darnach!“
„Hm“, sagte der Dichter bedenklich, „weißt du, nach unserem Fehlschlag mit den Hühnern...! Und ich verstehe doch auch nichts von Hunden, von Rassehundezucht schon gar nichts.“ „Unsinn!“ rief der geschäftstüchtige Freund, „das sind doch keine Gegenargumente! Man liest ein paar Broschüren, tritt einem Verein bei, das übrige entwickelt sich von selbst! Das nötige Geld am Anfang schieße ich vor!“ Und wirklich erschien der Freund nach einigen Tagen mit zwei wunderschönen, preisgekrönten, gefährlich anmutenden riesigen Hunden, einem kostbaren Zuchtpaar.
Der arme junge Dichter hatte dann viel Plage mit den Tieren, obgleich er sie liebte. Denn sie waren gefräßig und aggressiv. Er mußte Schulden machen, um sie ernähren zu können. Schließlich warf die Hündin fünf reizende, kleine Hündlein, an denen der Dichter eine rechte Freude hatte. Sie erfüllten sein Haus mit ihren Spielen und ihren Verunreinigungen, was ihn jedoch nicht störte, da er ja ein echter Dichter war.
Nach längerer Zeit fuhr sein wirtschaftlicher Freund in seinem Wagen vor. Schon während er seinem herrlichen Automobil entstieg, wunderte er sich im stillen, nicht mit lautem Gebell aus dem Zwinger begrüßt zu werden. „Was ist denn“, rief er dem jungen Dichter zu, „wo sind denn die Hunde, es müßten doch ihrer schon sehr viele sein?“
„Ja, weißt du“, sagte der junge Dichter betreten, „sie sind nicht mehr da! Ich konnte sie nicht erhalten. Es war überhaupt keine Nachfrage nach dieser Rasse, und sie kosteten viel Geld, sie fraßen gewaltig und waren un-anbringlich, auch hatte ich ihretwegen mehrere Prozesse mit der Nachbarschaft wegen Ruhestörung, und dem Briefträger mußte ich zweimal neue Hosen kaufen, weil sie ihn angegriffen hatten, lauter Spesen! Da habe ich sie dann hergeben müssen!“
„Hergeben?“ rief der Freund entsetzt, „du hast die wertvollen Tiere hergegeben? Zu welchem Preis und wem?“ „Nun“, erwiderte der Dichter, „ich war am Ende froh, sie überhaupt loszuwerden, und gab sie jemand, der mir dafür ein wenig Brennholz, alte Kleider und einige Naturalien gab.“ Der Freund ließ sich überwältigt in einen Sessel fallen. Er raffte sich aber sogleich wieder erbittert hoch und sagte: „Dir ist nicht zu helfen. Die Exemplare waren Tausende wert, du aber verhandelst sie gegen Brennholz und Naturalien! Und die Jungen, waren denn keine Jungen gekommen, wo sind diese?“
„Aber doch!“ rief der Dichter, „das waren reizende Tierchen! Auch sie, indessen, mußte ich hergeben. Erst starben zwei an der Staupe, eines mußte ich meinem Verleger schenken, der mich bevorschußt hatte, und mit je einem mußte ich den Steuerbeamten und den Mann, der die Hypothekarzinsen eintreiben wollte, beschwichtigen.“
Der wohlmeinende und geschäftstüchtige Freund sah den jungen Dichter lange an und
Der Mann am Quai von Lissaton Paul Claudel schrieb zu der von Jean-Louis Barrault geleiteten Neu-inzenierung seines Stückes „Christoph Colomb“ ein Vorwort. Wir veröffentlichen einige Auszüge.
_Christoph Colombus: Amerika war es nicht, was er suchte; Amerika war für ihn nur ein unheilvoller Zufall, eine Begegnung, die den Weg zu Höherem sperrte. Seine Devise (die Karl V. von ihm entlieh): Plus ultra! Ihm, dem Enterbten, ging es darum, für sein maßloses Streben die Absolution zu erhalten, die er nur im Absoluten finden konnte.
Wie viele Male mußte er, der verstoßene Sohn des Universums, unter den mißtrauischen Augen seiner Gläubiger den Quai von Lissabon hinaulschreiten, bevor er den fuß auf jenen Teppich von Gold und Purpur setzen konnte, den die untergehende Sonne vor ihm ausbreitete! Wie gut, daß ihm die Vorsehung am Ende die Befriedigung verwehrte! Wie gut auch, daß sie ihm die wunderbare Frucht der Hesperiden nur zu einer ungeschickten und unwissenden Berührung der Hand gereicht halte, zu einem zögernden Biß, bei dem er nichts als Bitterkeit auf den Lippen schmeckte. Und wie gut, diese Leute da hinter ihm, für die er sich in den Schlund des gewaltigen Unternehmens gestürzt, denen er die andere Hälfte des Universums zugebracht hatte! Wie gut, daß sie — an Stelle einer undenkbaren Belohnung — nichts für ihn bereit hatten als Undankbarkeit.
Zu denken, sagte er sich, daß diese stumpfsinnigen Matrosen unter irgendeinem Vorwand: ein trunkener Kompaß — verbrauchte Vorräte —, sich vermaßen, mich aufzuhalten! Wo doch das Spiel noch nicht gespielt war! Wo doch erst mit einem Schlage eine ganze Welt — von einem Pol zum anderen — aus dem Abgrund tauchen mußte, nur um meiner unendlichen Sehnsucht Grenze zu sein! Wo mich doch jene unwiderruflichen Ketten an Händen und Füßen erwarteten! Wo doch, im Angesicht des Sturmes, erst noch Entsetzen und Ekstase unter meinen Füßen losbrechen mußten, auf diesem verfaulten Schiff, das auseinanderfiel und zusammenstürzte. Wo — nach der Bosheit der Natur, mir noch die monströse Ungerechtigkeit, die heillose Dummheit der Menschen bestimmt war, um meine Rechnung mit Gott ins reine zu bringen!
... der Name und die Seele jenes Menschen, der Christophorus war, entschwebt über den Irdischen Meridian in eine andere Welt, eine über-sichtbare Welt, wo ihn — inmitten eines Getümmels glänzender Gestalten — Isabelle erwartet! Plus ultra!ichwieg. Dann ergriff er wortlos seinen Hut, verließ das Holzhaus und schritt auf seinen Wagen zu, öffnete den Schlag und setzte sich hinein. „Leb wohl“, sagte er zu dem Dichter, der ihm gefolgt war, „ich bedaure. Ich kann dir leider nicht helfen.“ Er ließ den Motor anspringen. „Höre“, sagte er noch, „wir müssen jetzt diese Rasenfläche verkaufen, ich brauche mein Geld, vor allem aber sollst du nicht das Gefühl haben, mir verpflichtet zu sein...“ „Nein, nein!“ rief der junge Dichter, „dies wäre mir unerträglich, nach all deiner Hilfsbereitschaft und Güte...“
„Eben!“ sagte der Freund, „wir verstehen uns!“ Er nickte dem armen Dichter zu und fuhr davon. Dieser sah dem Mann mit dem schönen Wagen, dem Bankkonto im Ausland und der hohen Stellung nach und stellte fest, daß infolge der Hilfsbereitschaft dieses Freundes und seiner trefflichen Ratschläge ihm nun nicht einmal mehr diese Wiese gehören würde, zu schweigen davon, daß er weder eine Hühnerfarm noch eine Rassehundezucht besaß.
Im Grunde seines Herzens aber war der junge Dichter sehr froh, denn da ihm nun bald die Wiese nicht mehr gehören würde, konnte sein geschäftstüchtiger und wohlmeinender Freund unmöglich mit einem dritten, womöglich noch quälenderen Projekt erscheinen, um den Dichter seiner „Erbärmlichkeit“ zu entreißen. Und er konnte also wieder frei und ledig aller Sorgen, die der Besitz bringt, in den Wäldern wandern und dichten und das Streben der Menschen nach irdischen und materiellen Gütern verachten, die in seinen Augen nur Ballast waren, geeignet, vom Wesentlichen im Leben abzulenken. Und so war er eigentlich ganz glücklich.