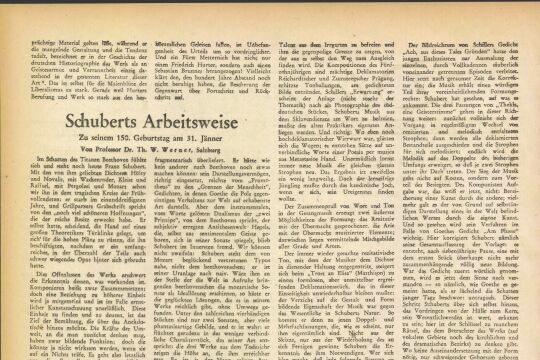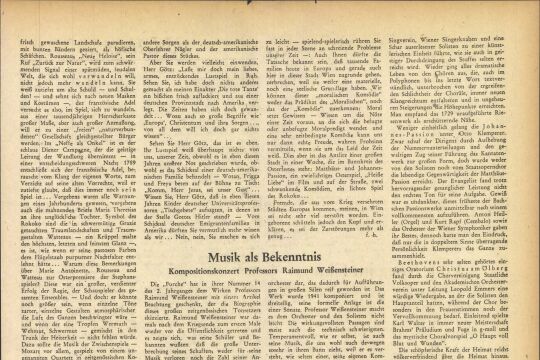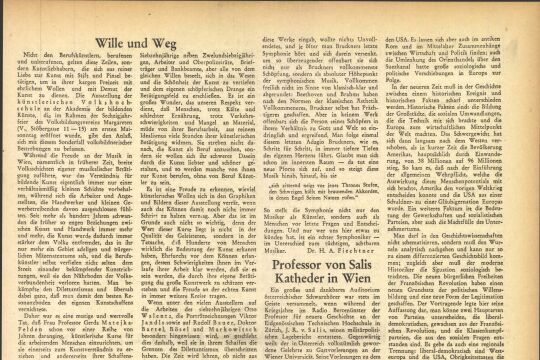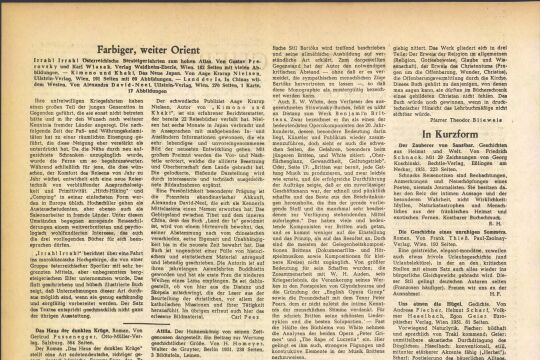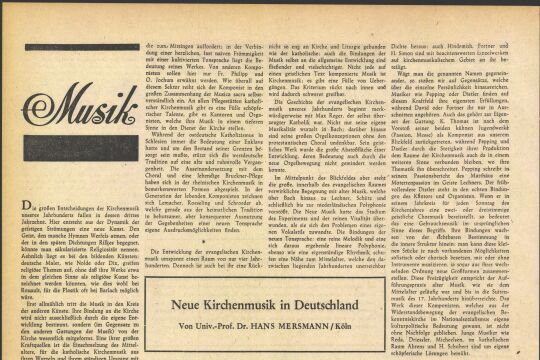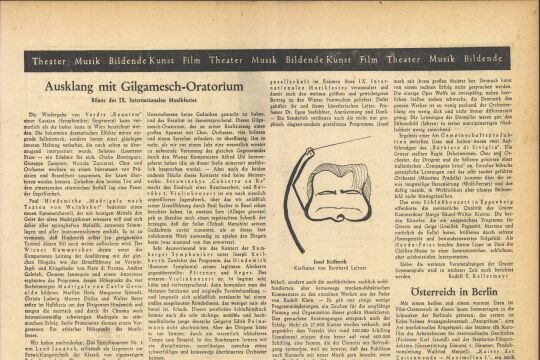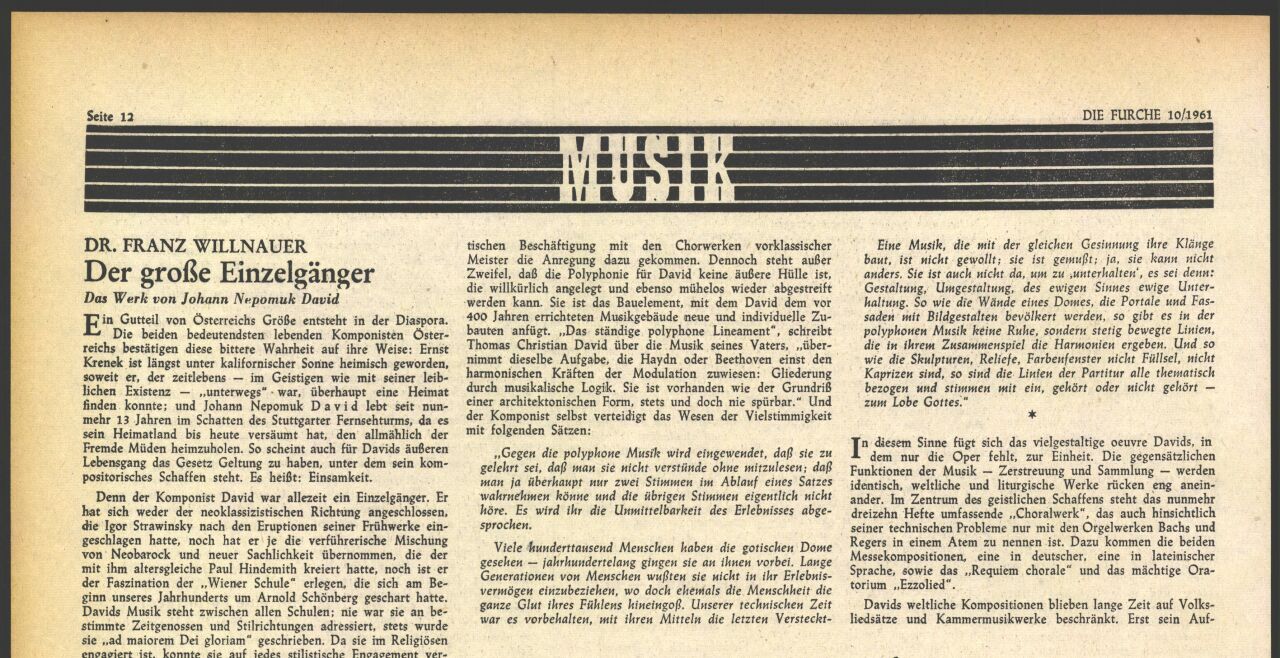
“Ein Gutteil von Österreichs Größe entsteht in der Diaspora. Die beiden bedeutendsten lebenden Komponisten Österreichs bestätigen diese bittere Wahrheit auf ihre Weise: Ernst Krenek ist längst unter kalifornischer Sonne heimisch geworden, soweit er, der zeitlebens — im Geistigen wie mit seiner leiblichen Existenz — „unterwegs” • war, überhaupt eine Heimat finden konnte: und Johann Nepomuk David lebt seit nunmehr 13 Jahren im Schatten des Stuttgarter Fernsehturms, da es sein Heimatland bis heute versäumt hat, den allmählich der Fremde Müden heimzuholen. So scheint auch für Davids äußeren Lebensgang das Gesetz Geltung zu haben, unter dem sein kompositorisches Schaffen steht. Es heißt: Einsamkeit.
Denn der Komponist David war allezeit ein Einzelgänger. Er hat sich weder der neoklassizistischen Richtung angeschlossen, die Igor Strawinsky nach den Eruptionen seiner Frühwerke eingeschlagen hatte, noch hat er je die verführerische Mischung von Neobarock und neuer Sachlichkeit übernommen, die der mit ihm altersgleiche Paul Hindemith kreiert hatte, noch ist er der Faszination der „Wiener Schule” erlegen, die sich am Beginn unseres Jahrhunderts um Arnold Schönberg geschart hatte. Davids Musik steht zwischen allen Schulen; nie war sie an bestimmte Zeitgenossen und Stilrichtungen adressiert, stets wurde sie „ad maiorem Dei gloriam” geschrieben. Da sie im Religiösen engagiert ist, konnte sie auf jedes stilistische Engagement verzichten.
Das mag einer der Gründe dafür sein, daß Davids Name in den Monographien und Anthologien der Musik des 20. Jahrhunderts oft fehlt. Die eingesponnen-distanzierte Lebensart des Komponisten hat ein übriges dazu getan, daß David von der breiten Öffentlichkeit noch nicht als „konstante Größe” innerhalb der Neuen Musik anerkannt worden ist. Erst sein 65. Geburtstag, den David am 30. November 1960 in seinem Heimatland beging, hat sein Schaffen in den Brennpunkt des allgemeinen Interesses gerückt. Wien bekundete diese Anteilnahme mit drei Festkonzerten, über die in der „Furche” (vgl. Nr. 49 vom 3. Dezember 1960 und Nr. 50 vom 10. Dezember 1960) berichtet worden ist; von den weiteren musikalischen Feiern (unter anderem in Dresden und Stuttgart) verdient das Geburtstagskonzert in Linz besondere Beachtung, weil David dem dortigen trefflichen Chorregens, Helmut Eder, seine „Sinfonia per archi” zur Uraufführung und das „Ezzolied” zur österreichischen Erstaufführung überlassen hatte.
Wie Anton Bruckner seine Neunte Symphonie, so hat Johann Nepomuk David sein ganzes Schaffen „dem lieben Gott” gewidmet. Schon damit steht er aber nicht nur in der geistigen Nähe des Florianer Meisters, sondern auch in der tiefbewußten Nachfolge Johann Sebastian Bachs. Noch enger verbindet ihn mit den beiden Vorbildern das polyphone Denken, das allen seinen Kompositionen zugrunde liegt; und selbst im Biographischen lassen sich Beziehungen zu Bach und Bruckner nachweisen, die keineswegs zufällig sind.
Im oberösterreichischen Eferding geboren, stammt David damit aus jenem süddeutschen Kulturraum, der seinen Künstlern seit jeher ein „barockes” Empfinden als letzte stilistische Gemeinsamkeit eingepflanzt hat. Es ist ein dialektisches Weltgefühl, gemischt aus sinnennaher Diesseitigkeit und jenseitiger Entrücktheit, aus lebendiger Unmittelbarkeit und hintersinniger Formenstrenge. Die Orgel, deren Klang noch im raumsprengenden Pleno in den Bereich des Ungreifbaren verweist, ist das ideale Instrument solchen Musikempfindens; und nichts beweist über die Epochen hinweg diese Gemeinsamkeit besser, als daß sowohl Bach wie Bruckner wie David ihre wesentlichsten Gedanken der Orgel anvertraut haben.
Musik umgibt den Knaben David schon im elterlichen Haus; der Zehnjährige wird Sängerknabe im Stift St. Florian, wo die Bruckner-Tradition noch unmittelbar lebendig ist. Nach der Beendigung des Studiums in Kremsmünster und Linz ergreift David den Lehrerberuf, den eT jedoch bald aufgibt, um der eigentlichen, der musikalischen Berufung zu folgen. Von 1920 bis 1923 studiert er in Wien Komposition, Orgel und Musikwissenschaft. Hier wird der Joseph-Marx-Schüler vom Strudel der atonalen Revolte erfaßt; unter dem Einfluß Arnold Schönbergs schreibt David eine Reihe von wild dissonanten Werken (darunter die Symphonie „Media vita”), die der selbstkritische Jüngling jedoch wieder vernichtet. Um den Kräften, denen er nicht standhalten kann, zu entfliehen, widmet sich David wieder seinem Lehrerberuf und zugleich dem Aufbau einer leistungsfähigen Chorvereinigung. David geht nach Wels und macht in kurzer Zeit den von ihm gegründeten Bach-Chor zu einem erstklassigen Ensemble für alte wie für zeitgenössische Chormusik. Diese Flucht in die provinzielle Abgeschiedenheit und in die Sicherheit einer klar umgrenzten Aufgabe bringt zugleich den schöpferischen Durchbruch: in den zehn Welser Jahren von 1924 bis 1934 entstehen die zahlreichen Chorkompositionen und der erste Teil des gewaltigen Orgelwerkes, mit dem David zuerst internationale Beachtung findet. Ein kräftiger Beweis für diese Anerkennung ist die Berufung Johann Nepomuk Davids zum Kompositionslehrer an das Konservatorium der Bach-Stadt Leipzig, dem er von 1942 bis zum Kriegsende als Direktor vorsteht. Der Pädagoge konkurriert auch späterhin mit dem Komponisten: von 1945 bis 1948 fungiert David als Direktor des Salzburger Mozarteums, seither wirkt er an der Stuttgarter Musikhochschule.
Musik ist für Johann Nepomuk David nicht der Ausdruck unkontrollierter Gefühle, sondern ein Werk des ordnenden Geistes. Diese Ordnung wjrd gestiftet durch die strengen Regeln des Kontrapunkts, denen David sein ganzes Schaffen unterworfen hat Gewiß bedeutete die Hinwendung zum linearen Denken für den liingling David den Ausweg aus der krisenhaften Unsicherheit des Schaffensbeginns, und ebenso gewiß ist von der praktischen Beschäftigung mit den Chorwerken vorklassischer Meister die Anregung dazu gekommen. Dennoch steht außer Zweifel, daß die Polyphonie für David keine äußere Hülle ist, die willkürlich angelegt und ebenso mühelos wieder abgestreift werden kann. Sie ist das Bauelement, mit dem David dem vor 400 Jahren errichteten Musikgebäude neue und individuelle Zubauten anfügt. „Das ständige polyphone Lineament”, schreibt Thomas Christian David über die Musik seines Vaters, „übernimmt dieselbe Aufgabe, die Haydn oder Beethoven einst den harmonischen Kräften der Modulation zuwiesen: Gliederung durch musikalische Logik. Sie ist vorhanden wie der Grundriß einer architektonischen Form, stets und doch nie spürbar.” Und der Komponist selbst verteidigt das Wesen der Vielstimmigkeit mit folgenden Sätzen:
„Gegen die polyphone Musik wird eingewendet, daß sie zu gelehrt sei, daß man sie nicht verstünde ohne mitzulesen; daß man ja überhaupt nur zwei Stimmen im Ablauf eines Satzes wahrnehmen könne und die übrigen Stimmen eigentlich nicht höre. Es wird ihr die Unmittelbarkeit des Erlebnisses abgesprochen.
Viele hunderttausend Menschen haben die gotischen Dome gesehen — jahrhundertelang gingen sie an ihnen vorbei. Lange Generationen von Menschen wußten sie nicht in ihr Erlebnisvermögen einzubeziehen, wo doch ehemals die Menschheit die ganze Glut ihres Eühlens hineingoß. Unserer technischen Zeit war es Vorbehalten, mit ihren Mitteln die letzten Versteckt heiten dieses Stils zu enthüllen. Wir können heute in unzähligen Büchern die geheimen Schönheiten der Skulpturen bewundern, die doch durch Jahrhunderte von den luftigsten Höhen der Fassaden ins Land sahen, ohne je überhaupt gewußt, geschweige gesehen worden zu sein.
Kann man da nicht auch sagen: Was haben all diese verschwendeten Innigkeiten für einen Zweck? Wenn wir durchs Portal gehen, gehen wir durch eine Versammlung von Aposteln und Propheten; wenn wir die Stirnfront der Chöre ansehen, erblicken wir eine Phalanx von Heiligen; wenn wir durchs Fenster sehen, leuchten uns Bilder entgegen. Es ist keinem gewissenhaften Kenner möglich, ein gotisches Bauwerk innerhalb kurzer Zeit in seinen Äußerungen auch nur erkenntnis- mäßig auszuschöpfen. Kommt noch dazu, den Grundriß und die Proportionen des ,Ablaufs zu erfassen — dann wissen wir, daß das Bauwerk eben kaum ausschöpfbar ist. Da fragen wir aber auch nicht mehr nach dem Zweck dieses Bauverfahrens, sondern geben endlich zu: hier strömt alles ein und stimmt alles ein zum Lobe der höchsten Ordnung. Und geschieht mit so viel Begierde zur Vergeistigung des Schönen, mit so viel Enthusiasmus, daß wir es mit einer steingewordenen Symphonie von Bögen, Jochen, Pfeilern, Portalen, Skulpturen und Farben zu tun haben.
Eine Musik, die mit der gleichen Gesinnung ihre Klänge baut, ist nicht gewollt; sie ist gemußt; ja, sie kann nicht anders. Sie ist auch nicht da, um zu .unterhalten , es sei denn: Gestaltung, Umgestaltung, des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung. So wie die Wände eines Domes, die Portale und Fassaden mit Bildgestalten bevölkert werden, so gibt es in der polyphonen Musik keine Ruhe, sondern stetig bewegte Linien, die in ihrem Zusammenspiel die Harmonien ergeben. Und so wie die Skulpturen, Reliefe, Farbenfenster nicht Füllsel, nicht Kaprizen sind, so sind die Linien der Partitur alle thematisch bezogen und stimmen mit ein, gehört oder nicht gehört — zum Lobe Gottes.”
In diesem Sinne fügt sich das vielgestaltige oeuvre Davids, in dem nur die Oper fehlt, zur Einheit. Die gegensätzlichen Funktionen der Musik — Zerstreuung und Sammlung — werden identisch, weltliche und liturgische Werke rücken eng aneinander. Im Zentrum des geistlichen Schaffens steht das nunmehr dreizehn Hefte umfassende „Choralwerk”, das auch hinsichtlich seiner technischen Probleme nur mit den Orgelwerken Bachs und Regers in einem Atem zu nennen ist. Dazu kommen die beiden Messekompositionen, eine in deutscher, eine in lateinischer Sprache, sowie das „Requiem chorale” und das mächtige Oratorium „Ezzolied”.
Davids weltliche Kompositionen blieben lange Zeit auf Volksliedsätze und Kammermusikwerke beschränkt. Erst sein Auf enthalt in Leipzig schuf da eine Wandlung. Denn die Stadt des Thomaskantors ist auch die des Gewandhausorchesters, und, von diesem hervorragenden Klangkörper angeregt, wandte sich David erstmals auch der großen Instrumentalmusik zu. Seither sind zehn Symphonien entstanden (neben den sieben großen eine „Sinfonia breve”, eine „Sinfonia preclassica” und die schon genannte „Sinfonia per archi”), weiter mehrere Variationenwerke, zwei Partiten, zwei Streicherkonzerte und vier Solistenkonzerte.
Dem ersten Blick bietet sich somit das Schaffen Davids in ungebrochener Geradlinigkeit dar. Aus ganz wenigen Quellen — dem Gregorianischen Choral, dem Volkslied, dem Choral der Kirchengemeinde — strömen ihm greifbare Anregungen zu; stets wird dieses Material den Regeln des. strengen Satzes unterworfen. So spricht eine ungeheure Konzentration aus den Werken, die oftmals aus einem einzigen thematischen Kern entwickelt sind oder einem einheitlichen formalen Prinzip folgen.
Eigengesetzlichkeit ist der Lohn. Einsamkeit das Schicksal solcher Haltung. EJennoch erweist sich gerade am Werk Davids, daß noch die autonomste schöpferische Erscheinung in einem tiefinneren Zusammenhang mit dem Gang der Geschichte und ihrer Kunst steht. Denn seit etwa 1950 gehen in Davids Werken technische und stilistische Veränderungen vor sich, die den historischen Werdegang der Neuen Musik rekapitulieren. Vom Ersten Violinkonzert und der Sechsten Symphonie an verwendete David melodische Bildungen, die alle zwölf Töne des chromatischen Totals umfassen. Hand in Hand damit ging ein deutlicher Wandel im Klangbild, der die grellen Farben und die jähen Kontraste des Expressionismus wieder beschwor. Damit kehrte Davids Musik in jenes Spannungsfeld zurück, aus dem sie rund 30 Jahre zuvor ausgebrochen war. Nun bestand Johann Nepomuk David die Auseinandersetzung mit der fundamentalen Neuerung Arnold Schönbergs, indem er dessen melodisches Prinzip mit der polyphonen Tradition eigenständig verschmolz. Ganz ähnlich wie Igor Strawinsky, wenn auch von einer völlig anderen Ausgangsposition aus, hat David damit ein schöpferisches Bekenntnis zur historischen Leistung Schönbergs und, noch mehr, zu der Anton Weberns abgelegt. Denn die jüngste Werkreihe, die mit den „Magischen Quadraten” beginnt und vorläufig bei dem Orchesterwalzer „Spiegelkabinett” und einem noch nicht näher bezeichneten Kammeroratorium endet, offenbart Davids Hinwendung zur abstrakten Zahlenkombinatorik. Nicht mehr zwölf- tönige Gebilde werden dem linearen Verfahren unterworfen, sondern tonreihen, die aus abstrakten, nicht auf die Zahl Zwölf bezogenen Schemata (zum Beispiel den in Intervalle umgedeuteten Zahlenbeziehungen innerhalb der „magischen Quadrate”) gewonnen wurden. An diesem Punkt ist das Mönchische, Einsiedlerische in Davids Wesen endgültig durchgebrochen; von den mitmenschlichen Bezügen hat sich sein Schaffen hier am weitesten entfernt. Zugleich ist es damit aber in eine Frontlinie mit den Unternehmungen der seriellen Komponisten gerückt, die auf ihre Weise um die Musik unserer Zeit kämpfen. Also doch Konformismus und modische Anfälligkeit? Wer bedenkt, daß David dieser „Ultima maniera” zuliebe alle Sicherheiten seines meisterlich gehandhabten Stils aufgegeben und dafür klangliche Unerfahrenheit, ökonomische Unsicherheiten und technische Krücken eingetauscht hat, der wird den Verdacht eines billigen Stellungswechsels weit von sich weisen. Vielmehr bestätigt dieser Mut zum Neubeginn den 65jährigen Komponisten wiederum als Einzelgänger. Gerade von dieser Vitalität Davids dürfen wir noch große und gültige Werke erwarten.