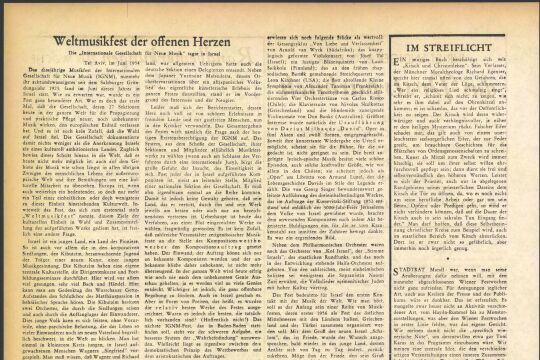Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
DER MAESTRO AM TOTEN MEER
Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze. Ebensowenig dem nichtschöpferischen, nur nachschaffenden Künstler. Auch die bedeutendsten Vermittler der Musik sind, sofern sie sich nicht selbst kompositorisch betätigt haben, für die Nachwelt verschwunden, vielleicht bis auf einige anekdotische Erinnerungen an besonders profilierte Persönlichkeiten. Liszt und Paganini sind für die musikalische Nachwelt lebendig geblieben; auch Ferruccio Busoni; jedoch nicht als unvergleichliche Vermittler der Musik anderer, sondern als Schöpfer ihrer eigenen. Hunderte von hervorragenden nachschaffenden Musikern, Dirigenten und Pianisten, Geigern und Sängern sind vergessen, bis auf die Erwähnung von Namen, Lebens- und Todesdaten in den Spalten der Musiklexika. Aber Arturo Toscanini wird für alle Zeiten eine Ausnahme bleiben. Soweit bekannt, hat er nie im Leben eine einzige eigene Note geschrieben, aber die Noten anderer hat er der Nachwelt in einer Weise vermittelt, wie es kaum vorher oder nachher einer Gestalt der Musikwelt gelungen ist.
Und nun wird die hundertste Wiederkehr seines Geburtsdatums überall gefeiert, -r- Auch wer Toscanini niemals persönlich begegnete, weiß um seine Figur, sein Naturell, seine Tatkraft im Dienste anderer, über die Art und Weise, wie er lebte, arbeitete, den Menschen begegnete, für die und mit denen er Musik machte. Unaufhörlich und unaufhaltsam, ein langes, fünfundachtzigjähriges Leben lang. Bei dieser Gelegenheit wird viel über diese merkwürdig suggestive Gestalt geschrieben werden. Über seine sonderbaren Manieren, seine Art, Menschen und Musiker zu behandeln, mit der unvergleichlichen Fähigkeit, aus jedem, mit dem er arbeitete, das Beste herauszuholen, und sei es auch um den Preis von Härten und Zwietracht und abruptem, verletzendem Benehmen.
Nur eine kurze Periode des Lebens, wie es der große, alte Musiker so eigenwillig und kompromißlos für sich zu gestalten wußte, soll hier beleuchtet werden, eine Periode, die zu beobachten und aus der Nähe aufzunehmen nur wenigen vergönnt war, die durch Zufall oder inneren Drang nach Palästina in jenes damals noch recht ferne erscheinende Land verschlagen wurden, in welchem sich diese Toscanini-Episode abspielte.
Im Jahre 1930 gründete Bronislaw Hubermann das „Palästina“, jetzige „Israel Philharmonische Orchester“, aus einer Gemeinschaft von Menschen, die in Hitlers Deutschland unbarmherziger Verfolgung ausgesetzt gewesen waren. Wohlhabende, ihm gleich gesinnte Freunde mühten sich, die materielle Grundlage des kostspieligen Unternehmens sicherzustellen. Und als es soweit war, daß man beginnen konnte, suchte Hubermann in New York Toscanini auf und bat ihn, ein Konzert zugunsten seiner neuen Gründung zu dirigieren. Aber das Ersuchen erhielt brummigen Bescheid: „Ich glaube nicht, daß die Sache viel Wert hätte. Es wird besser sein, ich komme selbst hin und sehe zu, daß alles richtig gemacht wird.“
Und so unternahm der damals Siebzigjährige die 1930 noch gar nicht so einfache und unbeschwerliche winterliche Reise, um sie im nächsten Jahr zu wiederholen. Natürlich, ohne je die geringste Entschädigung anzunehmen. Auf eigene Kosten bewohnte er am Meeresstrand von Tel Aviv ein behagliches und auf Gastfreundlichkeit eingerichtetes Haus. Daß ich selbst in seine nächste Umgebung geriet, verdankte ich dem Umstand, an Ort und Stelle der einzige Mensch zu sein, der fließend italienisch sprach. Der Maestro war kein Sprachgenie und schätzte es, sich in seinem heimischen Idiom unterhalten zu können.
Es waren unvergeßliche Monate seines Wirkens in dem ihm so fremden Land, welches bis dahin von Christen nur bei gelegentlichen Wallfahrten besucht worden war und sonst nur jüdische Flüchtlinge beherbergte, die Dank der Erlaubnis des britischen Mandates dort Zuflucht vor Verfolgung gefunden hatten. Der Toscanini-Enthusiasmus, der in jenen Monaten Palästina regierte, war unbeschreiblich. Nach dem ersten Konzert brach der im Saal anwesende Präsident der Hebräischen Universität in Tränen aus und erklärte: „Das ist der größte Tag in der neueren Geschichte Palästinas!“ Man wurde auf der Straße angehalten mit der schüchternen Frage: „Könnten Sie mir nicht irgendeinen Platz zum nächsten Konzert verschaffen?“. In den öffentlichen Verkehrsmitteln und den Cafes hörte man immerzu Diskussionen über diese oder jene Brahms-Tempi des Maestro. Die Maurer, die in der Nähe des damals noch sehr primitiven Konzertsaales arbeiteten, legten Hammer und Kelle beiseite, um den Proben zu lauschen.
Jedes Konzert wurde, wie solches seither stets üblich geblieben, in Haifa und Jerusalem wiederholt. Um stets drohenden arabischen Überfällen vorzubeugen, fuhr der Maestro in gepanzerten Wagen und Militärbedeckung, die ihm der Präsident von Israel zur Verfügung gestellt hatte, über Land, um es genau kennenzulernen. Aber eines Tages war er in den Vormittagsstunden plötzlich verschwunden; man suchte ihn vergebens, mit steigender Besorgnis, überall, doch umsonst. Am späten Nachmittag erschien er, vergnügt und enthusiastisch, wieder: er hatte einen Ausflug auf eigene Faust zum Toten Meer unternommen, ganz allein, um in seinen Meditationen nicht gestört zu werden.
Allmählich wurde sein Name zur Legende: in Tel Aviv gebar eine Frau zur Zeit seiner Konzerte weibliche Zwillinge, die die Namen „Tosca“ und „Nim“ erhielten. Das Intensive Interesse, welches Toscanini den religiösen Gebräuchen des Volkes entgegenbrachte, wurde besonders eindringlich erwiesen durch seine Teilnahme an einer Feier des „Seder-Aben-des“, zu dem er ohne weiteres und freudig die Einladung einer befreundeten Familie angenommen hatte. Diese Feier ist bekanntlich der Erinnerung an die von Moses glücklich geleitete Flucht aus Ägypten gewidmet. Der Maestro saß mit rituell bedecktem Haupt an dem festlich gedeckten Tisch und ließ sich die Frage des jüngsten Gastes: „Worin ist dieser Abend verschieden von allen anderen?“, wie auch die als Antwort folgende Erzählung jener Flucht Wort für Wort übersetzen. Nachher stellte er fest, dieser sei der glücklichste Abend seines Lebens gewesen. „Ich habe für meine Musik drei Länder verloren“, äußerte er, „Italien, Deutschland und Rußland — dort wollte man von mir Stellungnahme für eine Partei, für Politik und Prinzipien haben —, aber ich bin nur Musiker und will meine vollkommene Freiheit behalten, will denken, reden und schreiben, wie ich es will. Hier, in Palästina, habe ich ein Land gefunden, in dem ich ein Mensch sein kann, so wie ich das verstehe...“
Noch fester wurde Toscanini an dieses Land gefesselt, als man ihm ein Stück dieses geheiligten Bodens, den „Pardess“-Orangengarten Ramath Hashavim zu endgültigem Besitz überwies — der einzige Fall, daß einem NichtJuden solche Ehre erwiesen worden ist. Noch viele Jahre hindurch gingen Geschenksendungen der auf eigenem Grund und Boden geernteten Orangen als Geburtstagsgabe zum Besitzer, auch über den Ozean, bis der Krieg solchen Aufmerksamkeiten ein Ende setzte.
Leider verging die glückliche Zeit jenes Besuches im Laufe ' von zwei Monaten viel zu rasch — und als es zum Abschied in dem großen Jerusalemer Hotel „King David“ kam, wollte das Orchester jene einzigartige Periode mit einem Fest feiern. Da ich die Heimatsprache des Gefeierten beherrschte, wurde ich damit betraut, ihm den Dank des ganzen Landes für seine so uneigennützige, begeisternde Tätigkeit auszusprechen. Ich entledigte mich des ehrenvollen Auftrages so gut ich konnte, und wir erhielten auf die kurze Rede die noch kürzere Antwort: „Ich weiß nicht, wofür Ihr euch bedankt. Ich bin ein Christ, und man hat mich gelehrt, daß alle Menschen Brüder seien oder doch sein sollten, und daß man sich gegenseitig helfen soll wo nur möglich.“
Und es kam die Zeit des Krieges, da Toscanini seine Orangen nicht mehr zugeschickt bekommen konnte; Krieg und Weltgeschehen hielten ihn in Amerika fest, er gelangte nicht mehr hinüber in das geliebte Land, das ihn bis heute, nach 30 Jahren, noch immer in liebevoller Erinnerung behält. Sein Abschied 1938 war wehmütig, er ahnte wohl, daß er nicht mehr wiederkommen würde. Begleitet von den Abschiedsworten des Orchesters und unzähliger Freunde, die sich in Haifa zu seinem Abflug eingefunden hatten, entschwand ihm Palästinas Küste endgültig.
Mir selbst hatte ein glücklicher Zufall erlaubt, zusammen mit ihm nach Italien aufzubrechen; wir verbrachten als Reiseintermezzo zwei Tage in Rodi, wo mich sein lebhaftes Interesse an allen sehenswerten Reizen jener schönen Insel wieder tief beeindruckte. Die Wehmut, von ihm scheiden zu müssen, war durch einige fast humoristische Abschiedsworte gemildert — die letzten, die er zum „Addio“ von gemeinsamer Arbeit und Tätigkeit an mich richtete und die ich nie vergessen konnte, lauteten: „Ich habe es sehr geschätzt, daß Sie niemals eine Photographie mit handschriftlicher Widmung von mir verlangt haben!“
Es steht also kein von ihm signiertes Bild in der Reihe jener vielen anderen, die mich in meinem Heim an abgeschiedene Musikerfreunde erinnern...
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!