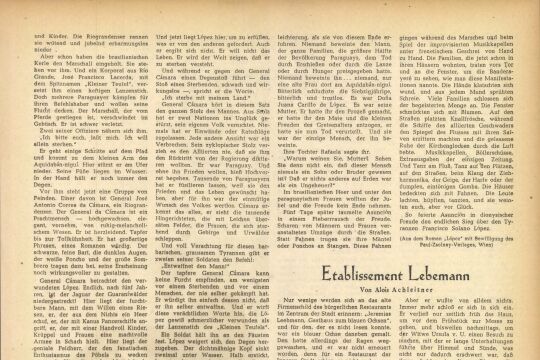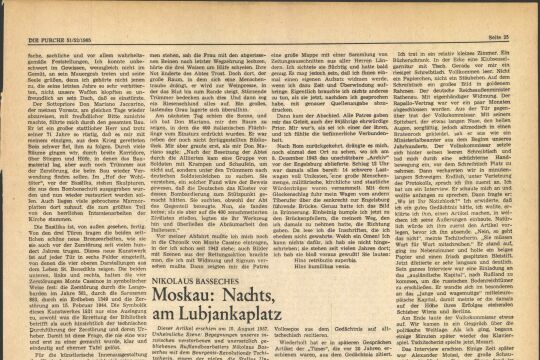Zu Beginn der zwanziger Jahre schlug die „ungekrönte Königin der Wiener Literatur“, Gina K., im Café Herrenhof, aus dem Franz Werfel, Hermann Broch und viele andere ihre dichterische Laufbahn antraten, an zwei Marmortischen die Redaktion und Administration ihrer Zeitschrift für junge Literatur auf. Die Kellner versahen zugleich die Boten- und Telephondienste des Redaktionsbetriebes, und der Zählkellner Jean kassierte die Abonnementsgebühren ein und beglich die Beitragshonorare, die meist gegen den Konsum von Kaffee, belegten Brötchen ¡und Likör aufgerechnet wurden.
Eines Tages erhielt ich einen Anruf aus I dieser Kaffeehaus-Redaktion, ich mogé mich sogleich am Bürotisch der Chefredakteurin einfinden. Gina teilte mir mit, sie habe soeben die sensationelle Nachricht erhalten, daß man in Sowjetrußland ein „intimes Notizbuch" Dostojewskis aufgefunden habe, in welchem er seine epileptischen Anfälle und die dichterischen Einfälle, die von ihnen ausgelöst wurden, einzutragen pflegte. Das sei doch geradezu wie für mich bestellt, meinte Gina, und sie fragte mich, ob ich nicht Lust habe, nach Rußland zu reisen, um dort selber Einblick in dieses Dokument zu gewinnen. Ich war wie berauscht von der Idee, ins Land der „Dämonen" zu fahren und Dostojewskis Notizbücher zu studieren. Aber nachdem ich ein paar Schnäpse getrunken hatte, war ich soweit ernüchtert, daß mich, das Problem der Finanzierung meiner Reise zu beschäftigen begann. Das Sonderhonorar, das mir die Chefredakteurin für einen Artikel über Dostojewskis Notizbuch anbot, reichte höchstens für fünfzig schwarze Kaffees, zehn Kognaks und einen Stapel belegte Brötchen aus, keineswegs aber für eine Expedition nach Sowjetrußland.
Wenn man aber lange genug bei einem Traum beharrt, so erfüllt er sich. Einige Tage später war ich im Salon der Frau Adele, der Witwe von Johann Strauß, zu einem literarisch-politischen Vortrag eingeladen. Hofrat L., der Chefredakteur einer großen bürgerlichen Tageszeitung, sprach über die Auswirkungen der NEP, der „neuen ökonomischen Politik" in Sowjetrußland, auf die kapitalistischen Länder. Er schloß seine Ausführungen mit den Worten, daß man vor allen Dingen die wirklichen Verhältnisse in Sowjetrußland studieren müsse, um ein klares Bild zu gpwinnen. Sofort bot ich mich an, als Sonderkorrespondent nach Sowjetrußland zu reisen. Er mißtraute zwar meiner wirtschaftspolitischen Begabung, aber meine Zivilcourage beeindruckte ihn, und so ging er auf eine Probezeit bei standesgemäß bescheidenem Gehalt ein.
Zwei Wochen später befand ich midi im Lande der „Brüder Karamasow“. Es erging mir dort ähnlich wie dem Mann, der auszog, einen Esel zu suchen und der dabei ein Königreich fand. Ich war gekommen, um ein kleines Notizbuch zu finden und entdeckte ganze Stöße von völlig unbekannten Nachlaßschriften Dostojewskis — Material für mehr als zehn Bände.
Der Nachlaß des Dichters hatte sich seit der Revolution aus mehreren Quellen vermehrt. Anläßlich der Nationalisierung der Banken durch die Sowjets hatte man in einem Safe der Witwe Dostojewskis eine versiegelte Blechbüchse mit wertvollen unbekannten Dostojewski-Manuskripten gefunden. Die Tscheka-Dienststelle von Sewastopol hatte während der Revolution die im Besitz von Dostojewskis Sohn Fedja befindlichen Nachlaßschriften des Dichters konfisziert und auf Lu,na- tscharskis Betreiben hin gerade wieder freigegeben. Endlich hatte ein Dieb, der
Dostojewskis Villa im Kaukasus geplündert und dort einen wichtigen Teil des Nachlasses gestohlen hatte, einen Brief an den stellvertretenden Volkskommissar Prokowski geschrieben, in welchem er sich bereit erklärte, gegen Zahlung von zwölf Millionen Tscherwonzen und bei Zusicherung völliger Straffreiheit dem Volkskommissar die gestohlenen Schriften Dostojewskis zu überlassen. Das Kommissariat lehnte es ab, sich „wegen Dostojewski-Manuskripten mit einem Dieb einzulassen", und befahl, den anonymen Briefschreiber ausfindig zu machen und zu verhaften. Bevor die Tscheka sich aber des Diebes bemächtigen konnte, war dieser mitsamt den Dostojewski-Manuskripten nach Grusinien entkommen.
Dostojewskis Nachlaß enthielt völlig unbekannte Fragmente und Varianten von so berühmten Romanen wie „Die Brüder Karamasow“, „Der Jüngling", „Der Idiot", „Die Dämonen“ und „Schuld und Sühne". Außerdem waren Entwürfe zu wunderbaren unvollendet gebliebenen Erzählungen und breit angelegten Romanen vorhanden, intime Notizbücher des Dichters mit aufschlußreichen literarischen und politischen Eintragungen und außerdem Dostojewkskis Konfessionen in brieflicher Form.
Die offizielle Einstellung der Kommunistischen Partei zu Dostojewski war damals noch nicht eindeutig festgelegt. In den zwanziger Jahren standen die Regenten Sowjetrußlands manchen russischen Klassikern — und insbesondere Dostojewski — gewissermaßen schizophren gegenüber. Einerseits waren diese Klassiker der Stolz der russischen Kultur, andererseits brachten sie die neuen Herrscher Rußlands recht häufig in Verlegenheit. So war die offizielle Staatsausgabe einiger ihrer Werke ein recht problematisches Unternehmen. Mit Tolstoi konnte man noch einigermaßen fertig werden, man brauchte nur seine ethisch-politischen Schriften als „senile Produkte" abzutun. Auch bei Gogol konnte man seine „reaktionäre Religiosität“ durch die geistige Verwirrung entschuldigen, an der er in den letzten Jahren seines Lebens litt. Dostojewski aber war ein schwieriger Fall. Der schöngeistige Volkskommissar Luna-, tscharski hatte anfangs versucht, Dostojewski als den Propheten der bolschewistischen Revolution zu feiern. Nachdem aber Lenin und Gorki ihr Verdammungsurteil über Dostojewski gefällt hatten, war dessen Stellung gefährdet. Der einzig mögliche Ausweg bestand darin, ihn in ein historisches Museumsstück zu verwandeln. Man legte seine Manuskripte unter Glas, neben seinen Federhalter und seine Tabakdose. Die anrüchigeren Texte wurden in Geheimarchiven verstaut.
Diese ambivalente Haltung gab mir die Möglichkeit, meinen Plan zu verwirklichen. Ich beschloß, dem Staatsverlag vorzuschlagen, mir die Auslandsrechte des unveröffentlichten Dostojewski-Nachlasses gegen Dollars zu verkaufen. Wie ich mir das Geld dafür beschaffen würde, darüber machte ich mir keine Sorgen, denn ich konnte mir keinen Geldmann vorstellen, der mir nicht für die Gelegenheit dankbar wäre, die Finanzierung meines Projekts zu übernehmen.
•
Mein Hauptproblem war vorerst, in dieser völlig fremden Welt die notwendigen Verbindungen zu den maßgebenden Sowjetstellen anzuknüpfen, um das Welt-Copyright für die Veröffentlichung des Dostojewski-Nachlasses zu erwerben. Der Mann, der mir dazu verhelfen sollte, trat mir unverhofft in dem größten Moskauer Lebensmittelgeschäft entgegen, wo er gerade pfundweise Ka-viar und Käse einkaufte. Es war Konstantin Oumansky, der spätere Sowjetbotschafter in Amerika und Mexiko. Ich kannte Kostja aus den Wiener Literaten- Cafes, wo er als genialischer Dichterknabe, als eine Art Miniaturausgabe Arthur Rimbauds, aufgetaucht war und die ganze Kaffehausliteratur mit seinen Gedichten gründlich aufgewühlt hatte. Trotz seiner Jugend bekleidete er damals bereits einen wichtigen politischen Posten; er war der Leiter des internationalen Pressedienstes.
In Kostjas vorrevolutionären Jahren hatten wir gar manche Kaffeehausnacht in lebhaften Gesprächen über Dostojewski verbracht. Daran erinnerte ich ihn nun, trug ihm meinen Plan vor und bat ihn um seine Hilfe. Nach einer kleinen Atempause erklärte er sich bereit, mir unserer alten Freundschaft zuliebe behilflich zu Sein.
Einige Tage darauf brachte er mich mit Lunatscharski zusammen. In der erst leicht mechanisierten Seele des Volkskommissars für Kultur und Bildungswesen spukte noch immer der Kulturmensch der vergangenen Epoche fort. Sein Versuch, Dostojewski, den Lieblingsschriftsteller seiner schöngeistigen Jugend, zum Vorläufer der sowjetischen Revolution zu deklarieren, war zwar an dem Widerstand radikalerer Kulturbolschewiken gescheitert, aber ich erkannte sofort, daß ich in Lunatscharski einen geheimen Komplicen gefunden hatte, dem die Verwirklichung meines Planes am Herzen lag. Und wirklich bevollmächtigte er alsbald seine Untergebenen im Staatsverlag Gossisdat, mir die Weltrechte des für Sowjetrußland wertlosen Dostojewski-Nachlasses gegen eine entsprechende Dollarzahlung abzutreten. Die Summe, welche die Geschäftsführer des Verlages forderten, war freilich keine Kleinigkeit.
Ich war jedoch überzeugt, daß ich das Geld für einen solchen Schatz ohne weiteres auftreiben könnte. Ich plante, dem schwedischen Zündhölzerkönig Kreuger, dem Konzerninhaber Stinnes und dem berühmten Wiener Finanzmann Castiglioni zu schreiben, und zweifelte nicht daran, daß einer von ihnen mir die notwendige Summe zur Verfügung stellen würde. Kopfschmerzen verursachte mir nur die Anzahlung, die ich schon in einigen Tagen auf den Tisch legen mußte.
Mein Plan, mir das erforderliche Geld zu beschaffen, war recht phantastisch. Ich war mit einer reichen Garderobe nach Rußland gekommen; Anzüge für jede Jahreszeit, von dem besten Wiener Schneider fiach Maß gemacht; dazu Hemden, Schuhe und Dutzende von Krawatten. Ich hätte auch einige Kisten mit deutschen und französischen Büchern mitgebracht. Mein erster Gedanke war, mich in die sogenannte „Bürgerreihe“ an den berühmten Smolensiki-Rynok zu stellen, wo Herren Und Damen der zaristischen Gesellschaft ihre letzten Habseligkeiten feilboten. Diese eingeschüchterten und herabgekommenen Aristokraten hatten aber die Marktpreise derartig verdorben, daß ich dort keine guten Angebote erhoffen konnte. Da erinnerte ich mich an die abgetragenen Russenblusen der Stammgäste in dem kleinen Restaurant, das ich jeden Abend zu besuchen pflegte. Dort hatten alle stets meine Anzüge bewundert und betastet. Ich machte meinen Kostgeber, einem ehemaligen Diamantenhändler, den Vorschlag, in seiner Wohnung nach dem Abendessen, das nach Moskauer Gepflogenheit stets gegen Mitternacht stattfand, meine reichhaltige Garderobe und Bücher zu verauktionieren. Er lud seine Bekannten ein, und im Handumdrehen war ich meine gesamte Garderobe los, bis auf einen Frack, zwei Frackhemden, eine weiße Frackkrawatte und ein Paar Lackschuhe — Kleidungsstücke, für die es in einer proletarischen Gesellschaftsordnung eben wenig Verwendung gab. Ein Blick auf den Frack und die Lackschuhe ließ mich plötzlich rufen: „Der Anzug und die Schuhe, die ich am Leibe trage, sind gleichfalls zu haben!" Es war ein sehr schöner brauner Anzug; man riß ihn mir fast vom Leibe. Ich legte den Frack, das Frackhemd und meine Lackschuhe an und begann, die Bücher zu versteigern. Befrackt und mit einer Menge Geld in der Tasche verließ ich die Stätte meines ersten Erfolges als Altkleiderhändler.
„Kleider machen Leute" — dieses Sprichwort sollte sich während meines Aufenthaltes in Moskau wirklich bewahr heiten. Mein© Persönlichkeit, ja selbst mein Name gingen völlig in dem Frack unter, den ich nun zu jeder Stunde trug. Zuerst sprach man über mich nur als „der Frack", und später redeten mich die Menschen mit „graschdanm Frack" an.
Aber jedenfalls konnte ich meine Anzahlung leisten; der Vertrag mit Gossisdat war also gesichert, falls ich rechtzeitig die Gesamtsumme aufbringen würde. Stinnes schien jedoch zu sehr mit seinen Vertikalkonzernen, KreugeT mit seinen Zündhölzern und Castiglioni mit der Finanzierung Max Reinhardts beschäftigt zu sein, denn von keinem von ihnen traf die erwartete telegraphische Antwort auf meine Anfrage ein. Es war seither schon mehr als eine Woche vergangen, und wie ein leichtes Magendrücken begann ich bereits die Zeichen der Verzweiflung zu spüren.
Da erfuhr ich von einem Sekretär im österreichischen Konsulat, daß der Großkaufmann B. aus Wien erwartet werde. Er kam, um Zucker und Getreide einzukaufen. Dieser rührige und unternehmungslustige Geschäftsmann war genau der richtige Mann für mich. Ich fand mich am Tage meines Eintreffens im Vorzimmer seiner Suite im Hotel Savoy ein und stieß auf eine wild gestikulierende, lärmende Horde von Spekulanten, Wechslern, Dolmetschern und Agenten.
Meine Visitenkarte als Korrespondent einer großen Wiener Tageszeitung verschaffte mir Vortritt. B. saß an seinem Schreibtisch gleichzeitig telephonierend, einem Stab von Sekretären Verträge diktierend und Marktberichte entgegennehmend. Ohne seine vielseitigen Beschäftigungen zu unterbrechen, schüttelte er mir freundlich die Hand. Im Hinblick auf die Wichtigkeit, die meine günstigen Berichte an das Wiener Tagesblatt für sein russisches Unternehmen haben konnten, schenkte er meinem Projekt aufmerksames Gehör. Das Wort „Dostojewski" klang ihm chinesisch. Da sein Geist den ganzen lieben Tag nur mit Gewichten und Preisen beschäftigt war, fragte er zuerst: „Wieviel Pud wiegt denn dieses Zeug?“
„Ich habe es zwar noch nicht gewogen, und an Zucker und Weizen gemessen, wiegt es vermutlich nicht allzuviel", sagte ich. „Aber es handelt sich hier um eine besondere Qualitätsware, und ich kenne den europäischen Markt dafür.“ Ich könne ihm die Verdopplung, wenn nicht die Verdreifachung seiner Investierung garantieren, erklärte ich und machte mich erbötig, sofort nach Europa zu reisen, um den Verkauf dort selber abzuwickeln.
„Der Preis?“ fragte er.
„Sechzehntausend Dollar. Mit Reisespesen sechzehntausenifünfhundert."
„Stellen Sie den Scheck aus", sagte er mit der Geste des großzügigen Finanziers zu seinem Sekretär. Als er die Feder an- setzte, um den Scheck zu unterzeichnen, blickte er fragend auf: „A propos, was ist denn das eigentlich: Dostojewski?"
„Weltberühmte Romane", sagte ich.
„Romane, Romane", wiederholte er beim Unterschreiben und dachte eine Sekunde lang angestrengt nach. „Doch nicht von dem, wie heißt er nur, dieser alte Graf, der kein Fleisch ißt und seine Schuhe selber flickt?“
Meine Antwort hörte er gar nicht mehr,
denn er sprach bereits durchs Telephon mit einem Zuckerfabrikanten, der ihn aus Kiew anrief.
Handel und Scheckverkehr mit Rußland waren damals kaum weniger kompliziert als heute. Ich mußte nach Wien reisen, um dort den Scheck einlösen und mit baren Dollars zurückkehren zu können. Die Ausreiseformalitäten nahmen Wochen in Anspruch. Als ich endlich in Wien eintraf, begann eine neue Phase meiner Abenteuer. Vom Bahnhof fuhr ich direkt, es War noch früh, zur Bänk des B., um meinen Scheck einzulösen. Sie war noch geschlossen. Ich stand eine Weile wartend davor, dann klopfte und trommelte ich mit den Fäusten gegen die Tür. Einige Passanten blieben stehen uhd blickten belustigt auf meinen Frack.
„Ach", sagte einer, „der Herr scheint im Orpheum .gedraht’ zu haben und seinen Affen noch nicht losgeworden zu sein. Dabei tut er so, als wüßte er nicht, daß der Bank ein .kleines Malheur’ passiert ist. Der B. hat sich halt mit russischem Zucker und Getreide übernommen, und die Bank mußte die Zahlungen einstellen."
„Gehen Sie nach Hause und schlafen Sie Ihren Rausch aus", rief man mir zu.
Was nun? In Rußland wartete der Nachlaß beim Staatsverlag, und ich hatte all meine Papiere als Pfand zurücklassen müssen. Ich war zwar ratlos, aber keineswegs verzweifelt. Es gab ja schließlich in Wien einen Mann, was sage ich, einen Mann? — eine Institution, der für alle Ratlosen Rat wußte, einen alten Weisen, nein, die Weisheit selber. Er hieß Friedrich Eckstein und war eine legendäre Figur. Mark Twain, der ihn kannte, liebte und verehrte, hat seine Gestalt unter dem J’Jamen „Mac Eck" verewigt.
In Wien, wo Literatur, Kunst, Musik, Philosophie und Geschäft in Kaffeehäusern ihr Heim hatten, war es nur natürlich, daß auch Mac Eck, die Weisheit in persona, an einem Cafétisch thronte. In einer Ecke des Café Imperial saß er von Morgen bis Mitternacht. Mac Eck kannte sich auf allen Gebieten aus. Wollte jemand die Namen der Haupt- oder Nebenflüsse in Paraguay wissen, das erste romantische Gedicht oder die früheste Erwähnung der Zahnbürste, so wandte er 6ich an Mac Eck.
Mac Eck, der sich in allen geisten Dingen auskannte, wußte natürlich auch über alle praktischen Fragen Bescheid. Er konnte Kunsthändlern sagen, welcher Liebhaber sich für ein ganz bestimmtes Bild aus der Frührenaissance interessieren würde, und wußte, wer in Europa was finanzieren würde.
Ich ging also ins Imperial. Mac Eck wußte natürlich, ohne daß ich viel zu erklären hatte, was in Dostojewskis Nachlaß enthalten war — vermutlich hatte es ihm Dostojewski selber erzählt. Aber er kannte nicht nur den Wert, den dieses oder jenes Stück des Nachlasses für die Literatur besaß, sondern er wußte auch, wer der Mann sei, der die Finanzierung meines Unternehmens in Gang bringen konnte. Er riet mir, mich mit Dr. Eduard Kaufmann, dem Rechtsberater des Bankhauses U., in Verbindung zu setzen, da dieser als Dostojewski-Liebhaber für meinen Plan Verständnis haben und ein Finanzkonsortium in Verbindung mit dem Verlag Manz organisieren würde. Und es kam alles genau, Wie er es gesagt hatte. Dr. Kaufmann schickte öiich mich dem notwendigen Betrag und einem Zuschuß von weiteren tausend Dollar für evehtuelle Mehrerwerbuhgen nach Rußland zurück.
Die Nachricht von der Rückkehr des „Narren im Frack", der für verstaubte Manuskripte mit guten Dollars bezahlte, drang bis in die entferntesten Gebiete der Sowjetunion und lockte unzählige Briefe, Tagebücher, Memoiren hervor, die Nichten und Großneffen, Verwandte und Freunde Dostojewskis in alten Schatullen verwahrt hatten. Ich mußte ein regelrechtes Dostojewski-Büro mit Sekretären und Kartotheken einrichten, um all die Angebote und Einladungen zu sichten und zu beantworten. Ein ganzes Jahr verging mit der Sichtung des sich kistenweise anhäufenden Dostojewski-Materials.
Nun hieß es, meine Schätze über die Grenze zu schaffen.
Jeder, der über viele Grenzen gereist ist, weiß aus Erfahrung, daß auch die bestdurchdachten Vorkehrungen, um unerlaubtes Gut über die Grenze zu schmuggeln, nur allzuleicht schiefzugehen pflegen. Das Gelingen ist gewöhnlich Glücksache, und das Glück ist nichts weiter als die Eingebung des Augenblicks. Die Untersuchung meines umfangreichen Reisegepäcks — ich hatte außer den Koffern mit Dostojewski-Material noch einige Kisten mit Ikonen und Kunstgegenständen mitgenommen — hielt den Zug ungebührlich lange an der finnischen Grenze auf. Den . Tschekisten beim Zoll imponierte meine offizielle Ausfuhrerlaubnis nicht sonderlich. Sie wollten Stichproben machen. Alles, was die Sowjetgrenze passierte, war grundsätzlich verdächtig.
Einem plötzlichen Einfall gehorchend, öffnete ich bereitwillig und mit scheinbarer Unbekümmertheit zuerst den Koffer, in dem die geheim erstandenen und ohne Erlaubnis ausgeführten Papiere verstaut waren, die mir Schwierigkeiten verursachen konnten. Ich legte sie zuoberst auf den Tisch des Untersuchungschefs und schob sie aufdringlich geradezu unter seine Nase. Dieses Manöver lenkte sein Mißtrauen sofort auf einen anderen Koffer, vor dem ich mich verdächtig auffällig hinpflanzte.
„Was verbergen Sie dort?“ fragte er streng. „Geht, schaut nach“, wies er seine Untergebenen an.
„Ich verberge gar nichts.“
„Dann öffnen Sie also den Koffer sofort."
Natürlich fand ich jetzt den Schlüssel nicht.
„Aha", rief er, auf die gefährlichen Papiere weisend, „für dieses Zeug hier haben Sie den Schlüssel gleich zur Hand gehabt. Für diesen Koffer aber können Sie den Schlüssel nicht finden. Wir sind nun aber gerade an der Öffnung dieses Koffers interessiert.“
Ich beteuerte, daß der Koffer wirklich nur ganz harmlose Briefe enthalte, für die ich im Besitz einer Ausfuhrerlaubnis sei.
„Wir kennen das, harmlose Briefe’ und .Ausfuhrerlaubnis’, das hat auch der Kerl gesagt, den wir gestern gefaßt haben. Was Ihr Koffer enthält, das werden wir selber feststellen." Und er gab Weisung, den Koffer aufzubrechen. „Wir wollen uns diese harmlosen Briefe einmal gründlich anseben“, sagte er drohend.
Seine Leute brachen den verdächtigen Kaffer auf. Er enthielt Dostojewskis Spielerbriefe an seine Frau. Der Untersuchungschef las jeden Brief mit pedantischer Aufmerksamkeit. Einige Stellen, in denen Dostojewski auf seinen Plan zum „Leben eines großen Sünders" anspielte, überreichte er zur doppelten Kontrolle seinem Gehilfen. Dieser schien selber ein Spieler zu sein, denn er vertiefte sich so angelegentlich in die verdächtigen Schriftstücke, daß ihn sein Chef schließlich ungeduldig fragen mußte, ob er etwas entdeckt habe. Zuletzt wurde der ganze Koffer in Stücke zerlegt, das Stoffutter herausgetrennt und das Leder sorgfältig untersucht, ob nicht etwas eingeklebt oder eingenäht sei. Inzwischen hatten die anderen Zollbeamten mein übriges Gepäck mit gleichem Mißtrauen durchsucht, die Ikonen aus dem Rahmen genommen und auch mich selber einer Leibesvisitation unterzogen. Nur die Papiere, die ich zuerst auf den Tisch gelegt hatte und deren Durchsicht mein Ünheü hätte sein können, blieben unbeachtet. Als schließlich der Moment der Abfahrt gekommen war, wurden sie samt dem übrigen ausgekramten Zeug hastig zusammengerafft und in mein Abteil geworfen. Der Züg setzte Sich in Bewegung, und wenige Minuten später befand ich mich auf finnischem Boden.
Ein Jahr später erschienen die ersten Bände des unbekannten Dostojewski- Nachlasses deutsch bei Peinhard Piper in München.
Aus der Zeitschrift „Der Monat“, Berlin, Nr. 46