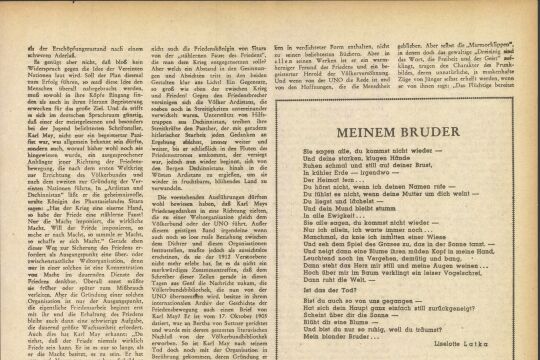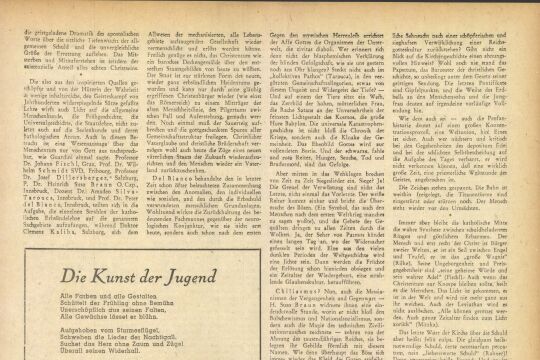Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Turm der Welt
Die entscheidenden Bücher der letzten beiden Jahrzehnte handeln im Grunde von einer Endzeit. Romano Guardini hat sie als „Ende der Neuzeit“ treffend beschrieben. Wieder kündet sich den Menschen der Zeitwende das Heraufkommen eines neuen Äons an, und in der Nacht unserer Gegenwart vernahmen und vernehmen wir den Hufschlag der apokalyptischen Rosse. Der absolute Fortschrittsglaube ist endgültig zusammengebrochen, und wir begreifen, daß sich die wirklich aussagende Dichtung der letzten Dezennien als eine solche der „Gerichtssituation“ (Urs v. Balthasar) enthüllt, deren Visionen beschwören, was kommt und droht. Der russische Kulturphilosoph und Denker Nicolai Berdjajew spricht daher auch von einer „Marschrichtung der Kultur, die heute auf die Utopie zuläuft“. Nietzsche und die russischen Neugnosti-ker von Dostojewskij über Fjodorow bis zu Wassilij Rosanow, dessen „Apokalypse unserer Zeit“ im Jahre 1930 erschienen ist, entwerfen das neue Bild des künftigen Menschen. Immer häufiger taucht sein Antlitz auf, oft nur verschwommen, nur im Vorüberhuschen. Dann scheint das Pendel sich fortzubewegen bis zum äußersten Ausschlag.
Es ist nur zu verständlich, daß im Zeitalter der vollendeten technischen Rationalisierung, in jenem Crescendo der technischen Revolution, dessen Partituren Geister wie Ortega y Gasset, Ernst und Friedrich Georg Jünger, Oswald Spengler, Karl Jaspers, Georges Bernanos nachgezeichnet und durchleuchtet haben, die Existenzangst den Menschen befiel. Jene Angst, die das Hauptthema der modernen Existenzphilosophie ist, die im Grunde nur um die Wiedergewinnung der Freiheit des Menschen ringt, jenes Menschen, der im mathematisch-technischen Funktionensystem der Gegenwart zu einer bloßen Sache, zu einem Maschinenbestandteil geworden ist. In das Fortis-simo. der technischen Symphonie, die unsere Großväter so begeistert gehört haben, die aber unseren Ohren wie eine höllische Kakophonie klingt, tönt die neue utopische Melodie, die Utopie der Gegenwart. Sie ist nach einer treffenden Feststellung Raymond Ruyers eine „Anti-utopie“.
Als einer der ersten hat Aldous Hux-ley diese Zukunft von übermorgen gezeichnet. Er schlägt das Thema der end-' phasenhaft abgeschlossenen Welt ohne Ausweg an und spielt es in seinem jüngsten Werk „Affe und Wesen“ als grauenhafte Farce zu Ende. George Orwells Roman „1984“ bietet im Grunde nur eine Variation dieser endphasenhaften Welt, wie sie von Ernst Jünger 1932 im „Arbeiter“ erschaut wurde. Um die gleiche Zeit wie Jüngers Werk erschienen Karl Jaspers „Geistige Situation der Zeit“ und Ortegas „Aufstand der Massen“. Die Aspekte des Themas haben gegenüber Huxley nun freilich eine völlige Veränderung erlebt. Die Angstträume der dreißiger Jahre sind zum großen Teil Wach-und Wahrträume geworden. James Bamhams berühmtes Buch „Revolution der Manager“ hat schon viel davon erkenntnismäßig ausgesagt. Nun blieb lediglich übrig, die Folgerung aus zwei Geschehnissen zu ziehen: einmal Nietzsches Verkündigung vom „Willen zur Macht“ und Lenins „Neue Strategie zur Eroberung der Macht“ in die Praxis umzusetzen, und zweitens eine Theorie zu schaffen, diese Macht, wie sie in den verschiedenen totalitären Staaten herausgebildet wurde, zu behaupten. Wesentlich für diesen Vorgang ist nun nicht nur allein die p h y s i-s c h e Veränderung des Menschen, von der noch in Dostojewskijs „Dämonen“ die Rede war, sondern die psychische. In Orwells Höllenvisionen klingt die furchtbare Stimme des Nichts, die den Untergang des letzten Menschen verkündet, jenes Menschen, der nach einem tiefen Wort Romano Guardinis am Ende der Neuzeit zu einem „unmenschlichen Menschen“ in einer „unnatürlichen Natur* geworden ist. Denn dies sind die Schlußergebnisse des zu Ende gehenden Äons der sogenannten Neuzeit. Dieser Mensch ist den dämonischen „Es“-Mächten verfallen, weil er seine Personalität, die vom göttlichen Du her konstituiert wird, verloren hat, weil er im Zuge der allgemeinen Säkularisation verlernt hat, an die Uberwelt Gottes zu glauben, verfiel er der Unterwelt der Dämonen.
Diese Unterwelt der Dämonen wird auch heute von christlichen Schriftstellern, wie Hermann Gohde und Erik Kühnelt-Leddihn, gesehen. Der Dichter Rudolf H e n z hat sie in seinem jüngsten Epos „Der Turm der Welt“ in dantesken Visionen erschaut. Der Dichter begann sein strenges Terzinengedicht im Jahre 1943, mitten im Geschehen des zweiten Weltkrieges, in der die „Arbeiterwelt“ Ernst Jüngers ihre dämonische Verwirklichung erfuhr. Auch er empfand diese Zeit nur als die blutige Konsequenz aller hybriden menschlichen Versuche, im Aufruhr gegen Gott den babylonischen Turm der Welt zu errichten, ein Ursymbol aller menschlichen diesseitigen und endzeitlichen Paradiese. Der Mensch, symbolisiert in der Gestalt des Steinmetzen, der berufen ist, am Dom seines gott-eben-bildlichen Seins zu bauen und zu meißeln, wird dieser seiner ihm von Gott aufgetragenen Aufgabe untreu und läuft in die Welt, weil er nicht mehr an die geoffenbarten Wahrheiten glauben kann. Drei neue Versuche der Selbsterlösung bieten sich dem Weltläufer an, symbolisiert in drei Reichen, in drei irdischen Paradiesen, die miteinander im Kriege liegen und einander in der Herrschaft ablösen. Es wiederholt sich hier auf mythischer Ebene, was auch Kühnelt-Leddihn und Oiwell bereits dargestellt haben.
Zunächst kommt der Steinmetz in das Reich der Blinden, in dem die Menschen auf das eigene Schauen verzichten, sich des Augenlichts berauben lassen, um sich vom unsichtbaren Herrn des Reiches, dem „Allesseher“, durch eine Lenkungsscheibe „fernsteuern“ zu lassen — ein Abbild aller kollektiven Termitenstaaten, der „insektifizierten“ Arbeiterwelt Jüngers. Der Steinmetz, der das Licht der eigenen Vernunft doch nicht preisgeben will, der nicht niederfällt vor dem Götzen Levia-than und ihn preisend anbetet, wird aus dem „seligmachenden“ Reich der Blinden verstoßen und gelangt nun in das Reich der Tauben, das Reich des schrankenlosen
Individualismus, in dem jeder nur sein eigenes Ich kennt und für jegliches Du ertaubt ist. Willkür in nie gekanntem Maß, jede Schandtat ist hier erlaubt, wo trotz aller Esoterik der individualistischen Lehre ein Krieg aller gegen alle tobt. Diese Welt trägt Züge des Ordens der „Mauretanier“ und auch solche der Unterwelt des Oberförsters aus Jüngers „Marmorklippen“. Der Steinmetz flieht auch aus diesem Reich und gerät in das dritte, das Land der Stummen. Hier sehen und hören die Menschen wohl, sie verzichten aber auf die Gewalt der Stimme, das heißt der echten Rede, denn was sie hier künden können, wäre das gleiche Grauen der Vergewaltigung und Verfolgung. Stumm gehorchen sie hier
— gleich der Orwellschen Proles — den Treibern und Einpeitschern und preisen und gestehen, was man von ihnen will.
Aus dieser visionär geschauten, von Dämonen regierten Unterwelt flieht der Steinmetz wieder zu seiner Arbeitsstätte zurück in die Welt. Zu seinem Entsetzen muß er erkennen, daß die ganze Welt von den Vertretern dieser drei Reiche
— 6ie werden durch ihre charakteristischen Abzeichen kenntlich — durchsetzt ist. (Henz nimmt hier in dichterischer Form einen tiefen Gedanken Picards auf.) Er steht gegen die Blindenwelt auf, doch keiner will ihn hören und verstehen, am Ende wird er für wahnsinnig erklärt und eingesperrt. In seiner einsamen Zelle beschwört er die Gestalt des heiligen Thomas von Aquin und fleht ihn an, in dieses blinde Chaos wieder rechtes Maß zu bringen. Die Herrschaft der Blinden vergeht — der Steinmetz wird befreit —, aber die Tauben kommen zur Macht. Wieder sind des Steinmetzen Warnungen umsonst. Sein Gebet richtet sich nun an den heiligen Franz von Assisi, der das Reich der brüderlichen Liebe verkörpert, daß er die Armen — und alle, ob hoch oder nieder, sind unendlich arm geworden durch den „Verlust der Mitte“ ihres eigenen Selbst — zurückbringe in die wahre Liebesordnung. Aber vergeblich. Die Stummen treten ihre Herrschaft an und türmen ihr Reich. Nun gilt die dritte und größte aller Anrufungen dem Apostel Paulus, dem Symbol des brennenden Liebesgeistes.
In einer apokalyptischen Gerichtsvision sieht der Steinmetz vom Turm der Kathedrale, wie die Lemuren der Blinden, Tauben, Stummen den Turm der Welt immer höher emportreiben, wie sie sich rüsten zum letzten Endkampf der Hölle gegen Gott. Und da kommt ihm die erlösende Weisheit: nur wer wie Paulus selbst, vor Damaskus, blind, taub und stumm geworden ist, kann durch die Gnade des barmherzigen Gottes den Weg der Erlösung finden, kann die Mauern des eigenen Selbst zersprengen, dem Turm der Welt widerstehen und in die Arme der liebenden Gottheit zurückfinden. Nur wer das Kreuz bejaht, kann gerettet werden. Dies ist der Sinn dieser echten, transzendenten Eschatologie des Dichters Henz, die das irdische Eschaton aufhebt in das überirdische der göttlichen Verheißung, die keine Utopie mehr ist. Denn im Vorspruch des zweiten Buches wird dem Menschen die Wahrheit verkündet: Gott ist der herrliche, der ewig junge Herr dieser Welt. Uns wird er neu geschenkt Wie jedem We6en und zu allen Zeiten. Er nimmt uns an. Denn kein Dämon verdrängt Ihn wirklich, durch der Bosheit Schläge gleiten Die Hüllen von ihm ab. Er ist die Frucht Audi unserer bösen Überheblichkeiten. Mit dem Werk des Dichters Rudolf Henz haben wir die Bereiche des ausweglosen Pessismismus bereits verlassen und die Möglichkeit des Transzendierens, die uns erst in den „Grenzsituationen“ der bisher geschilderten Welten wieder faßbar geworden sind, erreicht. Wir bleiben natürlich weiter in einer pessimistischen Sphäre, aber es ist dies, um Romano Guardini abermals zu zitieren, kein „falscher Pessimismus“ mehr, sondern ein „richtiger“i „denn es gibt auch einen richtigen, ohne ihn wird nichts Großes. Er ist die bittere Kraft, die das tapfere Herz und den schaffensfähigen Geist zum dauernden Werk befähigen“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!