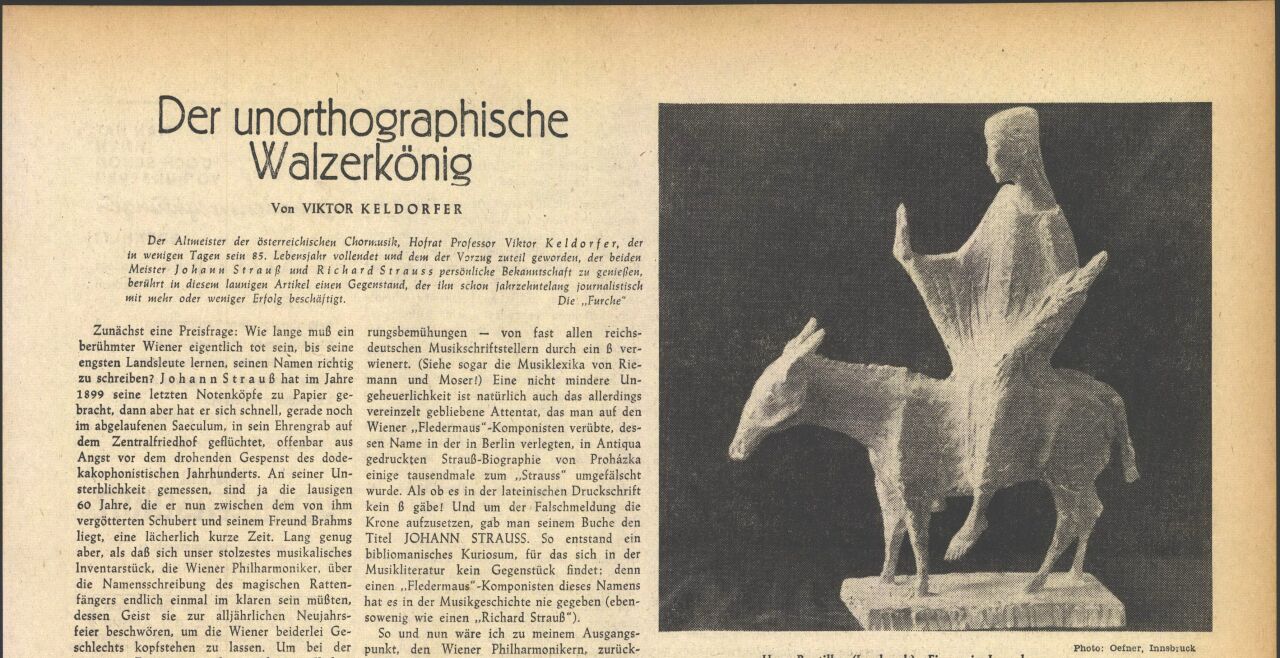
Der unorthographische Walzerkönig
Der Altmeister der österreichische Chorn-.usik, Hofrat Professor Viktor Keldorfer, der in wenigen Tagen sein 85. Lebensjahr vollendet und dem der Vorzug zuteil geworden, der beiden Meister Johann Strauß und Richard Strauss persönliche Bekanntschaft zu genießen, berührt in diesem launigen Artikel einen Gegenstand, der ihn schon jahrzehntelang journalistisch mit mehr oder weniger Erfolg beschäftigt. Die „Furche“
Der Altmeister der österreichische Chorn-.usik, Hofrat Professor Viktor Keldorfer, der in wenigen Tagen sein 85. Lebensjahr vollendet und dem der Vorzug zuteil geworden, der beiden Meister Johann Strauß und Richard Strauss persönliche Bekanntschaft zu genießen, berührt in diesem launigen Artikel einen Gegenstand, der ihn schon jahrzehntelang journalistisch mit mehr oder weniger Erfolg beschäftigt. Die „Furche“
Zunächst eine Preisfrage: Wie lange muß ein berühmter Wiener eigentlich tot sein, bis seine engsten Landsleute lernen, seinen Namen richtig zu schreiben? Johann Strauß hat im Jahre 1899 seine letzten Notenköpfe zu Papier gebracht, dann aber hat er sich schnell, gerade noch im abgelaufenen Saeculum, in sein Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof geflüchtet, offenbar aus Angst vor dem drohenden Gespenst des dode-kakophonistischen Jahrhunderts. An seiner Unsterblichkeit gemessen, sind ja die lausigen 60 Jahre, die er nun zwischen dem von ihm vergötterten Schubert und seinem Freund Brahms liegt, eine lächerlich kurze Zeit. Lang genug aber, als daß sich unser stolzestes musikalisches Inventarstück, die Wiener Philharmoniker, über die Namensschreibung des magischen Rattenfängers endlich einmal im klaren sein müßten, dessen Geist sie zur alljährlichen Neujahrsfeier beschwören, um die Wiener beiderlei Geschlechts kopfstehen zu lassen. Um bei der weiteren Erörterung jedem mißverständlichen Vorurteil das Genick zu brechen, stelle ich zunächst fest: Der Namenszug Sr. Majestät von der Blauen Donau. lohann IL. ist folgender-
Er hat sich also, wie sein Vater, der hochgepriesene Schöpfer des Radetzkymarsches, zeitlebens mit hs, dem untrüglichen Zeichen für ß, geschrieben, so, wie sich's halt nach einem gedehnten Zwielaut gehört. Sein Bruder, der Hofballmusikdirektor Eduard Strauß, unterstrich seine Vorliebe für den Wüstenvogel sogar durch ein ausdrückliches Kurrent-ß. Ehe ich aber nun gegen mein philharmonisches Angriffsobjekt losschieße, gestatte mir der Leser, einen dringend notwendigen Exkurs in die bayrische, sicherlich auf den Familiengründen der Münchner Pschorr-brauerei angelegten Strauß-Farm zu unternehmen. In dieser Zeit wurde hier, als sein Wiener Namensvetter bereits begann, seinen Kopf mit den pechschwarz gefärbten Bart-und Scheitelhaaren vor seinen unbequemen Konkurrenten Suppe und Millöcker in den Sand zu stecken, ein Exemplar gezüchtet, das aber ganz anders geartet war als sein gutmütiger Artgenosse in der österreichischen Kaiserstadt. Ein störriges, freiheitsbesessenes, eigenwilliges Wesen, das die sonderbare Manier hatte, bei jedem C-dur-Dreiklang sofort die für Damenhüte gewachsenen Federn zu sträuben. Die Aerzte befürchteten eine unheilbare Konsonanzen-Idiosynkrasie. Nicht einmal mit seinem ehrlichen zoologischen Namen war dieser lockere Vogel zufrieden. Er schrieb sich also mit einem Namen, der an sprachlichem Nihilismus nichts zu wünschen übrigläßt. Ein Doppel-ss nach einem gedehnten Diphthong! Trotzdem hat sich die Welt, ob sie will oder nicht, mit dieser Skurrilität abzufinden; ist doch der Name, wie jeder Eigenname, ein Nolimetangere, das auch ein hartgesottener Philologe gehorsamst zu fressen hat. Und auch für den in königlichen Hermelin gehüllten Revolutionär Richard III. („einen zweiten Richard gibt es ja seit Wagner nicht“, so mußte sich der Schöpfer der „Salome“ von Bülow ins Gesicht hineinsagen lassen) ist in der Namensschreibung, wie bei jedem gewöhnlich Sterblichen, doch einzig und allein entscheidend der in der persönlichen Signatur zum Ausdruck kommende Wille des Namensträgers.
So sollte man glauben. Wie aber sieht es in Wirklichkeit aus? Wie respektiert das deutsche Volk dieses Fundamentalgebot seinem letzten ganz großen Musikanten gegenüber? Die zahllosen Biographen von Richard Strauss — man höre und staune — wetteifern in ihren oft mehrbändigen, dem größten Meister unseres Jahrhunderts gewidmeten Lebensbildern geradezu untereinander, seinen Namen falsch zu schreiben. Er, der sich nie im Leben mit fremden, aus Wien importierten Straußfedern geschmückt hat (es wäre denn mit den Dreivierteltakt-Rhythmen im Rosenkavalier), wird heute immer noch — trotz meiner rastlosen journalistischen Aufklärungsbemühungen — von fast allen reichs-deutschen Musikschriftstellern durch ein ß verwienert. (Siehe sogar die Musiklexika von Riemann und Moser!) Eine nicht mindere Ungeheuerlichkeit ist natürlich auch das allerdings vereinzelt gebliebene Attentat, das man auf den Wiener „Fledermaus“-Komponisten verübte, dessen Name in der in Berlin verlegten, in Antiqua gedruckten Strauß-Biographie von Prohäzka einige tausendmale zum „Strauss“ umgefälscht wurde. Als ob es in der lateinischen Druckschrift kein ß gäbe! Und um der Falschmeldung die Krone aufzusetzen, gab man seinem Buche den Titel JOHANN STRAUSS. So entstand ein bibliomanisches Kuriosum, für das sich in der Musikliteratur kein Gegenstück findet; denn einen „FIedermaus“-Komponisten dieses Namens hat es in der Musikgeschichte nie gegeben (ebensowenig wie einen „Richard Strauß“).
So und nun wäre ich zu meinem Ausgangspunkt, den Wiener Philharmonikern, zurückgekehrt. Aus der sträflichen Bagatellisierung der Tatsache, daß die beiden Meister schon zur Zeit, da sie noch in Windeln lagen, einen verschiedenen Familiennamen trugen, bzw. aus der Sanktionierung des falschen Grundsatzes ß = ss, quillt, meine lieben philharmonischen Herzensfreunde, eure Schuld. Eure philologische Weitherzigkeit ließ euch, einem Feldwebel gleich, dazu verleiten, die beiden Edeltypen eures Konzertrepertoires in ein- und dieselbe Uniform zu stecken, sie also trotz ihrer angeborenen Unterschiede zu entindividualisieren. Und zwar teils zu Reklamezwecken auf Konzertplakaten, teils aus graphischen Schönheitsgründen in euren alljährigen Ball-Einladungen, in denen die beiden allerdings, man muß es zugestehen, keine üble Zwillingspferade machen: RICHARD STRAUSS FESTFANFARE JOHANN STRAUSS KAISERWALZER Auf meine Einwendung, daß niemals ein STRAUSS auf der Welt herumlief, der den „Kaiserwalzer“ komponiert hat, polterte mir prompt die zu erwartende Antwort entgegen: „Ja, sind etwa wir schuld daran, daß der Buchdrucker in seinem armseligen Setzkastl kein Groß-Antiqua-Zeichen für ein ß hat?“ Darauf sei erwidert: Ihr irrt, meine lieben Freunde! Ein solches Zeichen gibt es. Habt ihr noch nie etwas von einem SZ gehört? Aber ganz unter uns gesagt: auch für mich ist das SZ eine dualistische Mißgeburt, ein typographisches Scheusal, des-sentwillen unserem Sprachtyrannen Duden wahrscheinlich heute noch im kühlen Grabe von Zeit zu Zeit die Schamröte ins Gesicht schießt. Dieses graphische Brechmittel hat uns Wienern in jenen Tagen ohnedies oft genug den Magen umgedreht, als in der halben Stunde von einer Tramway zur anderen das beleidigte Auge hypnotisiert auf die STRASZENBAHN-Haltestelle-Tafeln stierte. (Die Gemeindeverwaltung empfand Mitleid. Aber durch die spätere kostspielige Umwandlung der STRASZE in STRASSE hat sie freilich den Teufel durch Beelzebub ausgetrieben.) Gibt es also wirklich keinen Ausweg aus diesem Sprachdilemma? Doch! Ich will ihn euch verraten: Insolange kein vernünftiges Zeichen für ß in Großantiqua existiert, bändige man seine Großmannsucht und begnüge sich damit, den Namen des Walzerkönigs bescheiden in Kleinantiqua zu schreiben. Ein Johann Strauß kann sich dies leisten; sein Name kann ja gar nicht so klein auf dem Druckpapier erscheinen, als daß man befürchten müßte, er könnte übersehen werden.
Wenn ich so in der Nähe des Stadtparkes weile, zieht es mich immer mit tausend Fäden zu dem schönen Strauß-Denkmal von Hellmer mit den fast unirdisch hauchzarten Liebespaaren auf der donaubewässerten Marmorpergola. In dieses Denkmal bin ich, ich verkalkter, verkitschter Mummelgreis, verliebt. Bewunderung und Gewöhnung lassen mich daher auch die diesem Ehrenmal anhaftenden Mängel übersehen. So die gleichsam in der Luft schwebende Fiedel, der mangels einer festen Kinnstütze auch der beste Geiger der Welt keinen anständigen Ton entlocken könnte. Ein Lapsus in arte, wie er schon manchem hochberühmten Künstler passiert ist. (Siehe das Beethoven-Denkmal von Zumbusch in der nächsten Nachbarschaft, auf dem als lustiges Gegenstück ein herziger geflügelter „Linkshänder“ zu sehen ist; ein kniender Engel, der mit der gefehlten Hand in die Saiten seiner Lyra greift.) Bedenklicher aber, wie all dies, will mich an Hellmers Meisterwerk freilich die unrichtige Beschriftung JOHANN STRAUSS stimmen, und zwar schon deshalb, weil tiefbedauerlicher-weise jeder Wiener die miserable Namensschreibung seines Lieblings heute schon für die richtige hält.
Da mir mein Leben lang destruktive Kritik als Selbstzweck zuwider war, möchte ich die kurze Spanne Zeit, die mir die Gnade des Himmels noch gewähren mag, schnell zur Aufarbeitung einiger noch unerledigter („vertraulich gesagt“ bis ins 19. Jahrhundert zurückgreifender) Rückstände benützen. Zu diesen Restanten gehören unter anderem auch die Befassung mit unserem typographischen Problem, das durch einen mutigen Axthieb auf das geheiligte Buchdrucker-Axiom: „ß = ss“ unschwer aus der Welt der Großantiqua-Typen zu schaffen wäre. Der erste Anhieb ist bereits erfolgt, die österlichen Glocken haben ihn bereits eingeläutet. Und wenn dann bis zum Bimbam der nächstjährigen Osterglocken aus dem Ganzen vielleicht wirklich etwas Gescheites herausgekommen sein soll, werde ich die Leser der „Furche“ als allererste davon verständigen, daß der Walzerkönig von unseren Philharmonikern nichts mehr zu befürchten hat.
