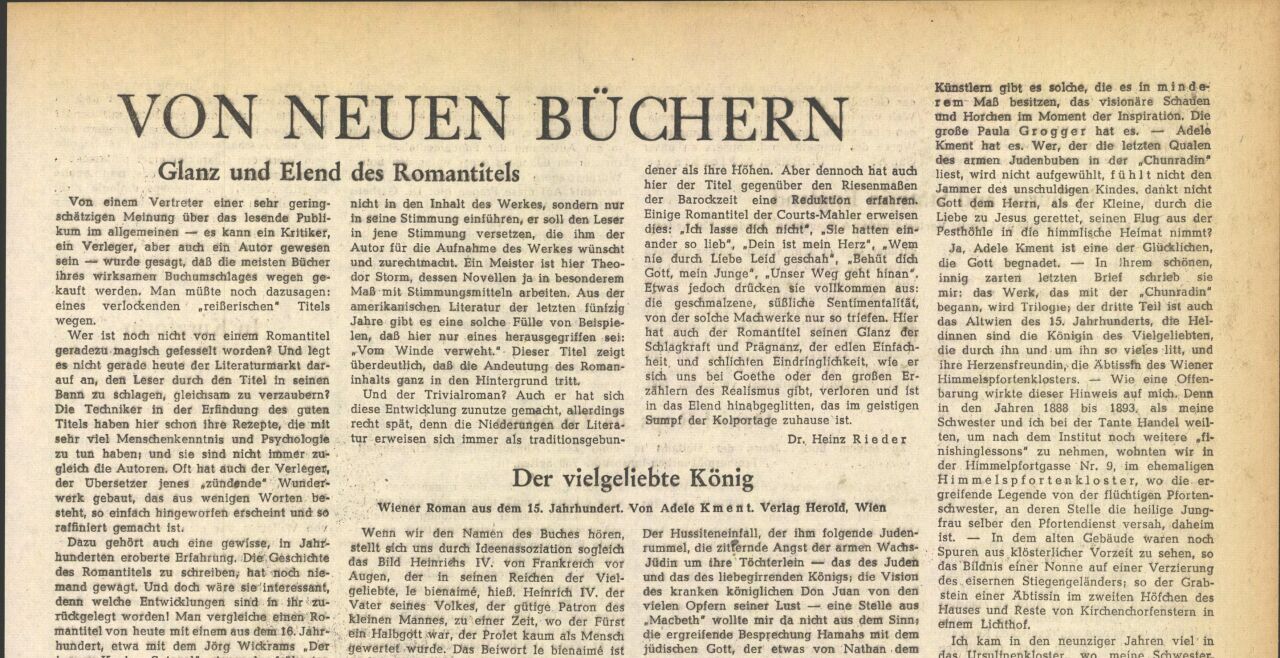
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der vielgeliebte König
Wenn wir den Namen des Buches hören, stellt sich uns durch Ideenassoziation sogleich das Bild Heinrichs IV. von Frankreich vor Augen, der in seinen Reichen der Vielgeliebte, le bienaime, hieß. Heinrich IV. der Vater seines Volkes, der gütige Patron des kleinen Mannes, zu einer Zeit, wo der Fürst ein Halbgott war, der Prolet kaum als Mensch gewertet wurde. Das Beiwort le bienaime ist auslegbar auf zwei Arten, Heinrich IV. der Vater seines Volkes, war auch der Bewunderer und Genießer weiblicher Schönheit, wo immer er sie sah und wo immer sie sein leicht entflammtes Herz entzündete. Das Lied-chen ' „Si le roi m'avait donne Paris la grand'ville“, das in einer Komödie Molicres aufklingt,-gibt Heinrich IV., den Vielgeliebten, so wieder, wie er war: grundgut, grundedel als Herrscher — allzeit verliebt als Mensch.
Wir blättern Adele Kments Buch auf. Wir finden diesen König, der uns das Leben und Lieben Heinrichs, des Vielgeliebten, vor ; Augen zaubert, in einem magyarischen Herrscher aus luxemburgischem Blute, in Sigmund (Zsigrfiond) wieder, mit allen Schwächen, aber auch mit manchem edlen Zug seines französischen Nächfahren.
Es ist Adele K m e n t, die uns diesen König Sigmund schildert, nein, die ihn' uns sehen, -hören, erleben läßt. Damit, ist alles gesagt.
Wir kennen die Künstlerin aus vielen und reizenden Büchern. Aber ihren Glanz, ihre Kraft, die Vollendung ihrer Kunst haben wir •erst mit ihrem „Offmey“, und noch viel stärker mit ihrer „Chunradin“ staunend sich offenbaren gesehen.
Das ist unsere neue Handel-Mazzetti, hieß es, und der Vergleich hat mich stolz und glücklich gemacht. Sie selbst aber schrieb in rührend zarter, echt künstlerischer Bescheidenheit: „Den Vergleich darf Ich nicht gelten lassen, denn die Handel-Mazetti ist einzig.“
Aber auch Adele Kment fst es — einzig in ihrer kostbaren, von tiefster Intuitton getragenen Nachbildung des alten, uralten Wien, das noch keinen Interpreten wie sie gefunden hat.
Energisches, geradezu männliches Erfassen der verwrckeltsten Situationen; feinnervigste Charakterisierungskunst der Gestalten, die plastisch aus dem Buch treten, uns die Hände reichen, uns teilnehmen lassen an all ihrem Leid, an allen ihren Freuden; dazu ein ungemein lieblicher Humor, der die düstere Größe der Handlung anmutsvoll mildert, das sind die Hauptzüge der Kmentschen Dichtkunst. Wer hätte nicht beim Lesen der „Chunradin“ sich angeheimelt gefühlt und für sich hingelacht bei den allerliebsten Nixenidyllen, bei der neckischen Schilderung des welschen Stromkönigs, der sein grünes Haar strählt und seinen Fischschwanz sowie die Flossen auf Glanz putzt, um dem Donauweibchen guten Eindruck zu machen! • Unzählig sind die allerliebsten Einfälle der Künstlerin, mit denen sie uns erfreut, während die Handlung wuchtig und ernst ihre Straße zieht. Sigmunds Königin, sein Prinzeßlein, Kabinettstücke, an denen die künstlerische Sicherheit in jedem Zug aufscheint, sind von größter Ein'druokskraft. — Im „Haus der guten Chunradin“ wird uns das Schicksal der Wiener Juden im 15. Jahrhundert in einem erschütternden Einzelfall vor Augen geführt: ein heranwachsender Judenbub sieht den Fronleichnamsaltar und läßt den Kopf bedeckt, wie es ja Sitte der „Jüdischheit“ bei ihren Gottesdiensten ist. Das Kind, ein kleiner Philosoph — „O denke nicht, mein Kind, sei wie die Blume“, läßt Gutzkow in seinem Drama „Ufiel Acosta“ seinen vierzehnjährigen Spinoza sprechen —,' wird gestellt, ins Gefängnis gesteckt; die Juden sehen in ihm einen Verräter, die Christen einen Spötter und Spion; im verseuohten Kerker, wo ein Pestkranker gestorben ist, wird der Knabe pestkrank und stirbt — nein, das kann man nicht mit dürren Worten nacherzählen, das muß man lesen im Buch der Kment; erschüttert hielt ich das Buch in der Hand — und Sah das Kind sterben, wie es die große, die einzige Künstlerin sah, die uns die „Chunradin“, das prächtigste Wiener Chronikbüch, schenkte. I Genau so ist's im .Vielgeliebten König.
Der Hussiteneinfall, der ihm folgende Judenrummel, die zitternde Angst der armen Wachs-Jüdin um ihre Töchterlem — das des Juden und das des liebegirrenden Königs; die Vision des kranken königlichen Don Juan von den vielen Opfern seiner Lust — eine Stelle aus „Macbeth“ wollte mir da nicht aus dem Sinn; die ergreifende Besprechung Hamahs mit dem jüdischen Gott, der etwas von Nathan dem Weisen an sich hat, und doch viel rührender, viel echter wirkt in seiner trauervollen, gedrückten Güte; Adele Kment ist nicht Philo-semitin und nicht Antisemitin, sie ist Frau, sie ist Mutter, sie ist Künstlerin, und unter diesen drei geheiligten Temperamenten, wenn ich so sagen darf, sieht sie den Juden, sieht sie den Christen, und jedem ist sie als Gestalterin und als Frau Freundin und Anwaltin.
Ich hätte noch viel zu sagen. Doch ich will dem Leser den Genuß nicht vorwegnehmen. Er lange selbst nach dem wunderschönen Buch und bilde sich sein Urteil, das wohl dem meinen ähnlich sein wird.
Nur eines möchte ich noch sagen. Ich habe schon oben vom Sehen und Erleben des Künstlers gesprochen. — Man sagte mir und sagt es mir noch heute, was wohl das Geheimnis ist, das, meine historischen Romane umgibt, warum alles so deutlich, so greifbar ist, daß man mitgerissen wird, ob man wolle oder nicht. — Ich weiß das Geheimnis, ich kenne es gfenau. Jene Kraft der Darstellung kommt vom Schauen, vom Hören alles dessen, WaS der Künstler darstellt, und es ist der höchste Grad der Inspiration, die nicht vom Künstler kommt, sondern von Gott selber, nur von ihm. Wenn ein Gleichnis erlaubt ist, die heiligmäßige Dulderin von Konnersreuth, Therese Neumann, die Gottbegnadete, die wir alle verehren, sieht und erlebt die Passion des Herrn mit allen großen und kleinen Zügen, mit allen Nebensächlichkeiten genau so, als hätte sie des Heilands Kreuzestod selber erlebt. Sie besitzt den höchsten Grad der Inspiration und des Schauens, das bei ihr nicht nur'hochgesteigertes inneres, sondern wahres, greifbares Erlebnis ist. Was sie im höchsten, durch Gottes Gnade ihr verliehenes heiliges Gut besitzt — unter uns
Künstlern gibt es solche, die es in minderem Maß besitzen, das visionäre Schauen tmd Horchen im Moment der Inspiration. Die große Paula Grogger hat es. — Adele Kment hat es. Wer, der die letzten Qualen des armen Judenbuben in der „Chunradin liest, wird nicht aufgewühlt, fühlt nicht den Jammer de unschuldigen Kindes, dankt nicht Gott dem Herrn, als der Kleine, durch die Liebe zu Jesus gerettet, seinen Flug aus der Pesthöhle in' die himmlische Heimat nimmt?
Ja, Adele Kment ist eine der Glücklichen, die Gott begnadet. — In ihrem schönen, innig zarten letzten Brief schrieb sie mir: das Werk, das mit der „Chunradin“ begann, wird Trilogie; der dritte Teil ist auch das Altwien des 15. Jahrhunderts, die Heldinnen sind die Königin des Vielgeliebten, die durch ihn und um ihn so vieles litt, und ihre Herzensfreundin, die Äbtissth des Wiener Himmelspfortenklosters. — Wie eine Offenbarung wirkte dieser Hinweis auf mich. Denn in den Jahren 1888 bis 1893. als meine Schwester und ich bei der Tante Handel weilten, um nach dem Institut noch weitere „fi-nishinglessons“ zu nehmen, wohnten wir In der Himmelpfortgasse Nr. 9, im ehemaligen Himmelspfortenkloster, wo die ergreifende Legende von der flüchtigen Pfortenschwester, an deren Stelle die heilige Jungfrau selber den Pfortendienst versah, daheim ist. — In dem alten Gebäude waren noch Spuren aus klösterlicher Vorzeit zu sehen, so das Bildnis einer Nonne auf einer Verzierung des eisernen Stiegengeländers; so der Grabstein einer Äbtissin im zweiten Höfchen des Hauses und Reste von Kirchenchorfenstern in einem Lichthof.
Ich kam in den neunziger Jahren viel in das Ursulinenkloster, wo meine Schwester, bevor sie im Sacre Coeur den Schleier nahm, Probelektionen gab. Meine besondere Freundin war die liebe alte Mater Wilhelmine. Sie zeigte mir einmal ein allerliebstes barockes Kästchen, eine entzückende Kleinarbeit — nichts Schöneres und Feineres an Barockkunst läßt sich denken als diese minutiös aufs zarteste in gemaltem Pergament, Goldblech, Sil-berspitzchen hergestellten Altärchen, Bilder-chen, Kruzifixchen des winzigen Oratoriums. „Das hat unseren Schwestern eine- Himmelspförtnerin geschenkt, die zu uns gekommen ist, als Kaiser Joseph das Himmelpfortenkloster aufgehoben hat.“
Ich schwärmte zu Hause von diesem barocken Kästchen in heller Begeisterung. „Du, du! Du wirst noch ein Büchel über die Himmelspforte machen, ich seh dich schon“, neckte mich Onkel Toni. — Ich machte keines, ich war damals mit glühendem Eifer daran, meinen „PateT Claudius“ zu vollenden, den man die Jungmädelvorarbeit zu meinem „Meinrad“ genannt hat. — Nicht ahnte mir, daß 57 Jahre später eine große Berufsschwester die Himmelspforte in den Brennpunkt eines historischen Romans stellen würde — nicht ahnte mir, daß, wenn mein Lebenswerk zu Ende ging, wenn
„sull' eterna pagina ' Gadde la stahea man — diese gotterwählte, vom Herrn mit den Seheraugen, die mein Bestes waren, begnadete Künstlerin es neu aufnehmen, zu reinen Höhen führen würde in einer Trilogie, gleichbürtig meinen Trilogien, fn manchem Belang hoch-bürtiger als meine „Stehana“, metin „Sand“ und meine „Frau Maria“. Le roi est mort — vive le roi!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!



































































































