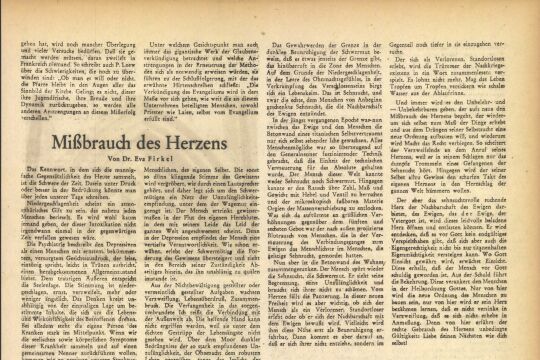Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Weg ins Nichts
Der Zufall hat in der vergangenen Woche zwei Wiener Theaterpremieren — „J o h n Gabriel Borkman“ von Ibsen in der „Insel“ und „Romeo und Jeannette“ von Anouilh im Akademietheater — nebeneinandergestellt, die im Gemeinsamen wie im Unterscheidenden zu ernstem Nachdenken über den Weg anregen, den der europäische Geist in den letzten fünf Jahrzehnten durchmessen hat. Nicht nur gewisse thematische Übereinstimmungen — der Kampf zweier ungleicher Schwestern um einen Mann oder der Gegensatz der Lebensauffassung von Vater und Sohn — verbinden die Werke des großen Norwegers und des modernen Franzosen. Wenn die beiden Stücke auch vielleicht nicht die wirkungsvollsten Schöpfungen der beiden Dramatiker darstellen, so verraten sie doch die Hand des echten Dichters und verkörpern daher jeweils zugleich die besondere nationale Eigenart ihrer Heimat und die geistige Haltung einer bestimmten europäischen Generation. Darüber hinaus stellen beide Stücke — selbst Produkte eines tiefen Nachgrübelns über den Sinn des Lebens — hohe Anforderungen an die Fähigkeit und den Willen zum Mitdenken. Vor allem aber verbindet beide Werke das leidenschaftliche Streben, hinter allen Schleiern des Scheins und der konventionellen Lüge die dämonischen Triebkräfte der menschlichen Seele in ihrer zerstörenden Urgewalt bloßzulegen. In erschreckender Weise wird dieses Ziel erreicht, doch führt kein Weg zu einer Lösung, da im Grunde jene wahre Liebe fehlt, ohne die auch die tiefste Erkenntnis „ein tönend Erz oder eine klingende Schelle“ bleibt. In der vorwiegend analytischen, verneinenden Tendenz aber liegt doch wohl der tiefste Grund dafür, daß uns beide Stücke zwar erregen, doch nicht erwärmen können.
„John Gabriel Borkman“ ist das Drama der grenzenlosen Herrschsucht, der machtgierigen Herzenskälte. Dem Bankdirektor, der um seines Machttraumes willen an der Liebe und an den Menschen gefehlt hat, steht seine hartherzige Frau gegenüber, die das Leben des Sohnes der „Mission“ weihen will, die Reputation des Namens wiederherzustellen. Neben dem Hauptmotiv von der liebetötenden Herzenskälte erklingt noch als Nebenmotiv Ibsens Lieblingsthema von der Lebenslüge, die die Menschen vor sich aufbauen, um der Wahrheit ihrer eigenen Unzulänglichkeit nicht ins AugL sehen zu müssen. Die Gestalt des alten Buchhalters, der in seiner Jugend ein Trauerspiel geschrieben hat und sich jetzt an seinen Dichtertraum klammert, bringt etwas Wärme in das liebearme Stück. Sonst aber weht von der Bühne ein eisigkalter Wind — den man fast für das Husten im Zuschauerraum verantwortlich machen möchte.
So bleibt uns vieles fremd: die von den Darstellern mit Recht stark unterstrichene, verkrampfte Starrheit dieser nordischen Menschen, die sich in ihren Schmerz einwühlen — die durch die Bühnenbilder wirkungsvoll hervorgehobene Düsterkeit des konventionellen Milieus —, nicht minder aber auch die Auflehnung der Jugend, der bürgerlich-romantische Idealismus des Sohnes, der „nicht arbeiten will, sondern leben!“ Wir müssen uns daran erinnern, daß in demselben Jahre 1896, als dieses Werk entstand, die „Jugend“ und der „Simplizissi-mus“ gegründet wurden — und jene Wandervogelbewegung, die die Befreiung der Jugend aus den Fesseln einer verstaubten, erstarrenden Bürgerlichkeit anstrebte. Damals hat Ibsen zusammen mit anderen unter der begeisterten Zustimmung der europäisdien Jugend die Spitzhacke an die falschen Fassaden einer unecht gewordenen Welt gelegt —, mit dem unerwarteten, aber vielleicht unvermeidlichen Ergebnis, daß wir heute vor jener seelischen Ruinenwelt stehen, die uns Anouilh mit einer geradezu selbstquälerischen Freude an Leid und Verzweiflung vor Augen führt.
•
Denn „Romeo und Jeanette“, diese Tragödie vom dämonischen Machtkampf der Geschlechter und von der erstrebenswerten Ruhe der tiefsten Verzweiflung ist ein bis zur letzten Konsequenz „modernes“ Stück — weshalb das Knusperhäuschen im Vordergrund des Bühnenbildes und der kitschige Meeresstrand im Hintergrund ebenso fehl am Platze sind, wie das gelegentliche Ausgleiten der Darstellung in die Welt des „Tartarin de Tarascon“. Jede der eindrucksvollen Szenen verrät die innige Verwandtschaft mit dem französischen Existentialismus, mit der Philosophie des „neant“, dem Credo von der Verzweiflung und von der Sinnlosigkeit des Lebens. Es wäre unehrlich, wollten wir uns über den Abgrund, in den unsere Zeit geblickt hat und noch blickt, durch zimperliches „Nicht-Hinschauen“ hinwegtäuschen und die Ruinen mit rosafarbenen Schleiern verhängen. Wie die moderne bildende Kunst uns seit Jahren immer wieder die Zerrissenheit und Fragwürdigkeit unserer Welt vor Augen führt, so tut dies mit derselben Schonungslosigkeit auch Anouilh in diesem anerkennenswert ehrlichen Versuch, die seelische Welt im Zeitalter der Atomzertrümmerung im Gleichnis der Bühne einzufangen. Aus dem Unbehagen der Ibsen-Zeit ist der Ekel geworden, und diese Stimmung des Ekels nach dem schalen Genuß, die Stimmung des großen seelischen Katzenjammers, die die Geistigkeit des heutigen Frankreich ebenso kennzeichnet wie einst die Deutschlands nach dem ersten Weltkrieg, liegt auch über diesem Stück. Gewiß, die falschen Fassaden sind niedergerissen, dahinter aber zeigt sich keine echte Gestalt, sondern nur mehr ein wüster Trümmerhaufen. Es scheint keinen anderen Ausweg mehr zu peben, als den der Flucht in die Primitivität, „an die Elfenbeinküste, wo die Neger am schwärzesten und dümmsten sein sollen“. „Retour ä la nature“ hat ja schon einmal nach einer Epoche äußerster Raffiniertheit ein französi-Philosoph und Bohemien der Welt gepredigt. Nun sind wir soweit, daß die letzten Werte fragwürdig geworden und mit allen Götzen zugleich auch alle G*ötter gestürzt sind. Die Erfahrung hat die Voraussage bestätigt, daß der Mensch, nachdem er Gott in seinem Herzen gemordet hat, aus seinem metaphysischen Urtrieb heraus sich falsche Ersatzgötter schaffen wird. Da sich diese aber der Reihe nach als äußerst problematisch erwiesen haben, ist als letzte Ersatzreligion nur mehr die des „Nichts“ und der „Verzweiflung“ geblieben. In der konsequenten Vollendung dieses vor langer Zeit begonnenen Zerstörungswerkes liegt vielleicht die Funktion der Existentialisten. Sie geben uns keine neue Lösung, sie zeigen keinen Weg, kein Licht in dieser ausweglosen Finsternis. Aber sie helfen uns doch, daß wir die ganze Größe des Zusammenbruches erkennen und sehen können, daß nur mehr ein Wert und eine Beziehung übriggeblieben sind, von denen aus wir eine zerstörte Welt ganz neu aufbauen müssen —, der Mensch an sich und seine Beziehung zu Gott.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!