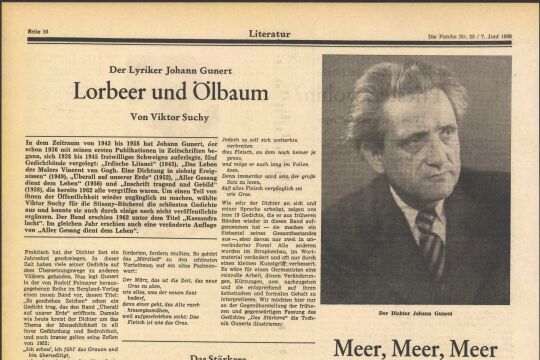Von Rudolf H e n z soll hier die Rede sein, von einer schöpferischen Persönlichkeit also, die in ihrer ausdrucksreichen Wortkunst klar profiliert erscheint und in ihrer vielseitigen Wirksamkeit für unser Kulturleben zu den namhaftesten Trägern des geistigen Österreich zählt. Alles, was dabei mitzuteilen ist, hat eine Bezogenheit auf unsere Zeit, auf unser Schicksal in den jüngstvergangenen Jahren und in dieser Schau wird es zu einer Verpflichtung, von dem Dichter zu sprechen, denn sieben lange Jahre, die gerade die Periode seines reichsten Schaffens darstellen, war es still um Rudolf Henz, fast ganz still.
Der noch nicht fünfzigjährige Dichter gehört der österreichischen Zwei-Kriege-Generation an. Sein Leben hat den zerhackten Rhythmus und den schnellreifenden Tiefgang dieser Zeit, der einen ernstdenkenden Menschen notwendigerweise über sich und die Welt hinausweisen muß. Aus der geregelten Ordnung und umfriedeten Kindheit einer Landschule in Niederösterreich, an der sein Vater verdienstvoll wirkte, wird er fast ohne Übergang in den ersten Weltkrieg hineingerissen. 1918 zieht er den Offiziersrock, in dem er bis nach Albanien gekommen war, wieder aus. Jung genug ist er, um nun erst mit ganze;- Leidenschaft-
lichkeit neben dem Studium an der Wiener Universität den Weg zur Kunst zu suchen und sich zugleich einen festen geistigen Standpunkt zu erkämpfen. Seine Gedichte offenbaren viel von diesem inneren Ringen, das er sich dadurch nicht erleichterte, daß er bei aller Jenseitsverbundenheit bewußt und bereit die Konfrontation mit dem So-Sein der Menschheit und mit der dinglichen Wirklichkeit will. So wuchs in Rudolf Henz das Erspüren und Bejahen des Hineingestelltseins, örtlich And zeitlich genommen.
Aus Wald und Weingebirg' Und Krieg nach Wien verpflanzt, Bin zwischen Stadt und Land Ich wunderlich daheim —
sagt er in seinen „Strophen zu einem Selbstbildnis“. Zwischen Stadt und Land — beiden hingegeben. Wohl erkennt er die Gefährdung und Drohung der Stadt des 20. Jahrhunderts und daher redet er von ihr als von der „großen Mühle Gottes, in der wir zu Ende gemahlen werden“, aber zugleich sieht er auch in seinem schönen Gedicht „Schneemorgen in der großen Stadt“:
Noch gestern ohne Sinn, Voll Aufruhr und Verzicht; Heut' tragen Land und Stadt Des Schöpfers Angesicht.
Und ganz schlicht bekennt en „Wir sagen Ja zu den Formen des gegenwärtigen Lebens, nicht wie zu einer Verirrung, sondern zu einem aus uns und mit uns Gewachsenen.“ Gegenwartsmensch ist Rudolf Henz, Dichter in der Zeit. Im äußeren Typus den Geistigen repräsentierend, ist er dem Wesen nach anpackend, aufbauend, dem Aktuellen, Tatdringlichen auch durch seinen Beruf verpflichtet, der ihn immer wieder in die unmittelbare Nachbarschaft zum öffentlichen Leben, führt. Nach Promotion und Abschluß seiner Studien ist er durch mehrere Jahre Leiter der Bildungsstelle des Volksbundes der österreichischen Katholiken. Dann wird er als Direktor der wissenschaftlichen Abteilung in die Ravag berufen, deren Leitung er seit Mai 1945 wieder als Programmdirektor angehört, nachdem er 1938 fristlos entlassen worden war, denn der Nationalsozialismus hatte für Rudolf Henz selbstverständlich keine Verwendung. Seine Reaktivierung als Offizier war nur eine kurze Episode. Auch der Wehrmacht galt er nichts.
Henz blieb dennoch in Wien und wie so viele stellenlose Österreicher nach 1938 wurde auch er durch eine kurze Zeit Versicherungsagent, denn die Notdurft des Tages, die Sorge um die Familie verlangten ihr Teil und er wäre nicht der Mensch unserer vieltätigen Zeit, hätte er jemals vor dem Leben kapituliert. Bald fand er dann pine ihm gemäßere Beschäftigung: er wurde Mitarbeiter der Tiroler Glasmalereianstalt und viele Fahrten zu stillen Dorfkirchen führten ihn hinaus nach Niederösterreich, Steiermark und Kärnten. Wieder war er „zwischen Stadt und Land daheim“ und wo er hinkam, war Österreich mit ihm, war er der heimliche Botschafter des Glaubens an das Wiedererstehen unseres Vaterlandes. Henz ist nicht'nur Dichter, er ist auch ein begabter Maler. In jungen Jahren hat er vorübergehend auch an der Wiener Kunstakademie studiert. Ein paar Gemälde, die während des Krieges entstanden sind, eine schneeverhangene Winterlandschaft und eine barocke Distelstudie schmücken sein Döb-linger Heim. Von dieser Seite seines musischen Wesens öffnet sch zwanglos der Zugang zu seiner Beschäftigung mit der Glasmalerei, die ihm gegen Ende des Krieges, als in Wien schon Bomben fielen, einen außergewöhnlichen Auftrag vermittelte: er durfte die herrlichen gotischen Scheiben der Klosterneuburger Stiftskirche, die in einem Keller gegen Fliegergefahr geborgen waren, restaurieren. Diese Arbeit mit kleinen Glasscherben und großen Kartons, auf denen er schadhafte Scheiben ergänzend nachzeichnete, war ihm mehr als Lebensunterhalt, war ihm feierliches, an verflossene Fernen verlorenes Tun, das zu einem Zyklus gebetsinniger und holzschnitt-starker Gedichte wurde:
O Gnade solcher Pflicht, o reines Brot! Das Deine Hände, Herr, mir neu bereiten. Den Ausgestoß'nen hebst Du aus der Not Und stellst ihn mitten in die Herrlichkeiten.
Denn Rudolf Henz war und blieb vor allem Dichter, wenn er auch in seiner Heimat kaum noch gehört wurde. Die Wiener Zeitungen verschwiegen ihn nach dem März 1938. Nur das „Neuigkeits-Welt-blatt“ brachte in dep ersten Jahren neben der Besprechung seiner Bücher noch einige Feuilletons und kleine Novellen von ihm, darunter die Geschichte eines bäuerlichen Sternsuchers, ein erstes Anklingen des späteren Peter-Anich-Motivs, und eine Jugenderinnerung „Gretl, die Schildkröte“, die humorvoll und feinsinnig das köstliche Gedicht „An die Schale einer Schildkröte“ untermalt. Aber dem Gaupresseamt gefiel der Autor nicht. Die Zeitung erhielt strikten Auftrag, ihn nicht mehr zu berücksichtigen. Als später der Priester-Dichter Heinrich Suso Waldeck starb und Henz ihm einen kurzen, gehaltvollen Nachruf — den einzigen in der österreichischen Presse — widmete, durfte dasselbe Blatt den Namen nicht mehr nennen. Aber in den sieben Jahren seines Ausgestoßenseins wuchs das epische Werk von Rudolf Henz um fünf Bücher an, fünf Romane, die in Österreich wenig bekannt und nie gewürdigt wurden. Katholische Verlage Deutschlands konnten Ihr Erscheinen durchsetzen: „Die Hundsmühle“ (1939), eine schlichte Erzählung aus dem Volk; „Begegnung im September“ (1939), die Geschichte eines Malers, der spät wieder zu seiner Kunst findet; „Der Kurier des Kaisers“ (1941), der den Kampf der Türken gegen das Abendland und seine Metropole Wien in buntbewegten Fahrten außerhalb des Belagerungsringes erlebt; „Der große Sturm“ (1942), das bisher reifste und
männlichste Werk des Dichters, das in Form
eines mitreißenden Selbstbekenntnisses Leben und Ziel Walters von der Vogelweide und sein geheimnisvolles Entschwinden von der Welt darstellt; endlich „Ein Bauer greift an die Sterne“ (1943), der große Peter-Anich-Roman, der sich jetzt den Lesern dieser Zeitschrift wieder entrollt. Alle diese Buchschöpfungen kommen aus der ganz persönlichen Wesenheit ihres Dichters. Das Motiv der Verpflanzung und Wanderschaft aus einem Lebensraum in den anderen bricht immer wieder durch. Das Mädchen aus der „Hundsmühle“ kommt wie Peter Anich vom Land in die Stadt, der Maler in der „Begegnung“ geht den umgekehrten Weg und
den Kurier verschlägt es aus dem niederösterreichischen Hainburg sogar bis Konstantinopel. Die Fahrt vom rauhen Waldland herunter nach dem sonnigen Weinland von Spitz in der „Begegnung“ oder die noch viel eindringlicher gestaltete Reise des alten Minnesängers vom Würzburgischen her an die österreichische Donau im „Großen Sturm“ schließen diesen thematischen Kreis. In seiner Lyrik, in der unmittelbarsten Aussage des Dichters, weisen ebenfalls immer wieder Worte und Bilder auf dieses Bewegungsmotiv hin: „Ausfahrt“, „Unrast nach Wechsel und Welt“, „Aus Weltnot eingeholt“. Es darf daraus geschlossen werden: Rudolf Henz begreift sich und die Menschheit in dieser Welt nur auf einer Durchfahrt und dieses Hereingelassensein und Hinweggerufenwerden, das bezeichnenderweise gerade im Walter-Buch seine stärkste, ins Übersinnliche vortastende Gestaltung erfährt, spiegelt sich sinnbildhaft in jedem Menschenleben. Das Überraschende und absolut Moderne dabei aber ist, daß alle Menschen der Dichtung von Rudolf Henz darum nicht weltflüchtig und weltuntreu werden. Sie sagen Ja zum Leben, zu ihrem Leben, ob sie nun unserer Zeit angehören oder ein historisches Gewand tragen, sie lieben und leiden, grübeln und handeln und bekennen und verteidigen ihr Tun mit starker seelischer Hingabe, sind also so wie ihr Dichter: Menschen in der Zeit. Auch das spürt man bei Rudolf Henz, daß zu dieser Durchfahrt durch die Zeit noch ein Vorher und Nach-
her dazugehört. Aber das dichtet Herne
nicht. Er weiß davon oder glaubt daran, aber er faßt nur die Wegspur auf Erden.' Mit diesen Werken, deren positive Geistigkeit und Darstellungskraft von Buch zu Buch ebenso wächst wie die Meisterschaft ihrer Prosa, die vor allem im Vogelweider Buch von geschliffenster Prägnanz und Sentenz ist, hat sich Rudolf Henz in die vorderste Reihe österreichischer Dichter gestellt.
Aber die fünf Romane sind noch nicht alles, was er seiner Schaffenskraft in den Jahren seit 1938 abgefordert hat. Der jüngst erschienene Gedichtband „Wort in der Zeit“ (Amandus-Edition, Wien 1946) sammelt seine ganze, bisher erst zum Teil
gedruckte Lyrik, in der er sich und die Zeit bedingungslos ausspricht. Henz kennt kein Kompromiß mit dem Publikumsgeschmack, aber das Publikum versteht ihn doch, wie erst vor kurzem eine Vorlesung im Volksbildungsheim Ottakring wieder bewiesen hat, ob er nun eines seiner verhaltenen, zuchtvollen Stimmungsgedichte vorträgt, ob er aus den „Sprüchen bei der Arbeit an den Klosterneuburger Scheiben“ wie aus einem alten, von Untergangsgewittern durchleuchteten Buche vorliest oder ob er aus der von schwerster geistiger Verantwortung erfüllten „Ballade vom Wort“ her ruft:
Erschrick nicht! Jedes Wort ist göttlich.
Keins,
Das er uns nicht nachjagt wie einen Pfeil. Deshalb erschauert unser Blut, wenn eins Uns schmerzlich trifft. Doch nah ist dann
das Heil.
Solche Verse stammen aus der Zeit der furchtbarsten Wortentwertung upd Wort-verkehrung. Rudolf Henz, der Dichten stets für einen ehrfürchtigen Dienst am Worte gehalten hatte, mußt* auf diese Zeit spontan noch wortheiliger reagieren als vordem. In dem Zeitepos, das ihm unter der Feder liegt, strafft und spannt er daher auch die Form zu Terzinen. Über dieser Arbeit, die ihn bedrängt/, die ihn wieder ganz zum Dichter in der Zeit macht, ist seine dramatische Paulus-Trilogie, von der kleinere Kreise schon einige packende Szenen kennen, vorübergehend in den Hintergrund ge-
treten. Vielleicht auch einige anüere Pläne,
denen er in den letzten Jahren nachhing. Das wird er zuerst aus den Tiefen seiner Seele zu dichterischer Gestalt emporheben, wozu sein Hineingestelltsein in die Zeit hilft oder was das über die Zeit Gestellte, das Ewige, aus ihm abruft. Weiß man es bei einem Dichter, auch wenn er so sehr der Gegenwart und Wirklichkeit gehört wie Rudolf Henz, ob er selbstwillige Vorsätze oder außerwillentliche Eingebungen ausführt, ob er ein Eigener ist oder ein „Knecht Gottes“?
Professor Joseph Skoda hat sowohl der
Perkussion als auch der Auskultation den wissenschaftlichen Abschluß gegeben. Zusammen mit Rokitansky erklärte er durch genaue physikalische Beobachtung sowohl an Lebenden als auch an Leichen alle für die krankhaften Veränderungen charakteristischen Schallphänomene in solcher mustergültiger Weise, daß sie heute noch fast unverändert in der modernen Medizin ihren Wert behalten. Das berühmte Werk Skodas über Perkussion und Auskultation erschien im Jahre 1839 in Wien. Es feierte in der damaligen ärztlichen Welt einen
wahre Triumph. Aus alten Teilen der
Welt strömten Ärzte und Studenten nach Wien, um bei Skoda die Perkussion und Auskultation gründlich zu erlernen. Die Lehren Skodas sind heute noch zum größten Teil gültig und es ist ein besonderes Verdienst der Wiener medizinischen Schule, auf diesem Gebiet Großartiges geleistet zu haben. Die Arbeiten Skodas waren ohne Auenbrug-ger und ohne Corvisart und Laennec vorbereitet gewesen. Daß hier zwei Österreicher und zwei Franzosen in friedlicher Zusammenarbeit der ganzen Welt das wertvolle Gut der modernen physikalischen Kranken-
nntersuchung geschenkt haben, offenbart die Bedeutung des friedlichen Wetteifers auf dem Gebiete der Wissenschaft für die Menschheit. Jedes Volk der Erde ist hier auf die anderen Völker angewiesen, denn die Wissenschaft ist und bleibt international.
Die Stadt Wien hat den bescheidenen Forscher Auenbrugger geehrt, indem sie eine Gasse nach ihm benannt hat; es ist ein Gäßchen neben dem Rennweg bei der polnischen Kirche, aber wie viele kennen noch die Bedeutung dieses Namens? Und doch verdient dieser Österreicher nie erlöschenden Dank,