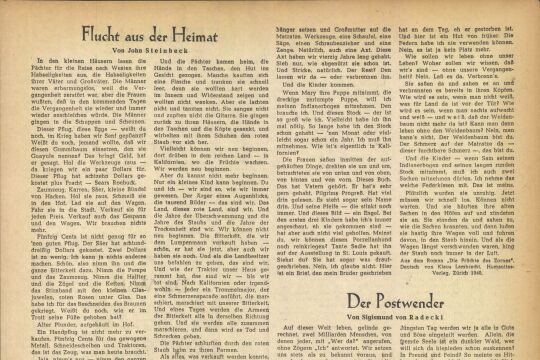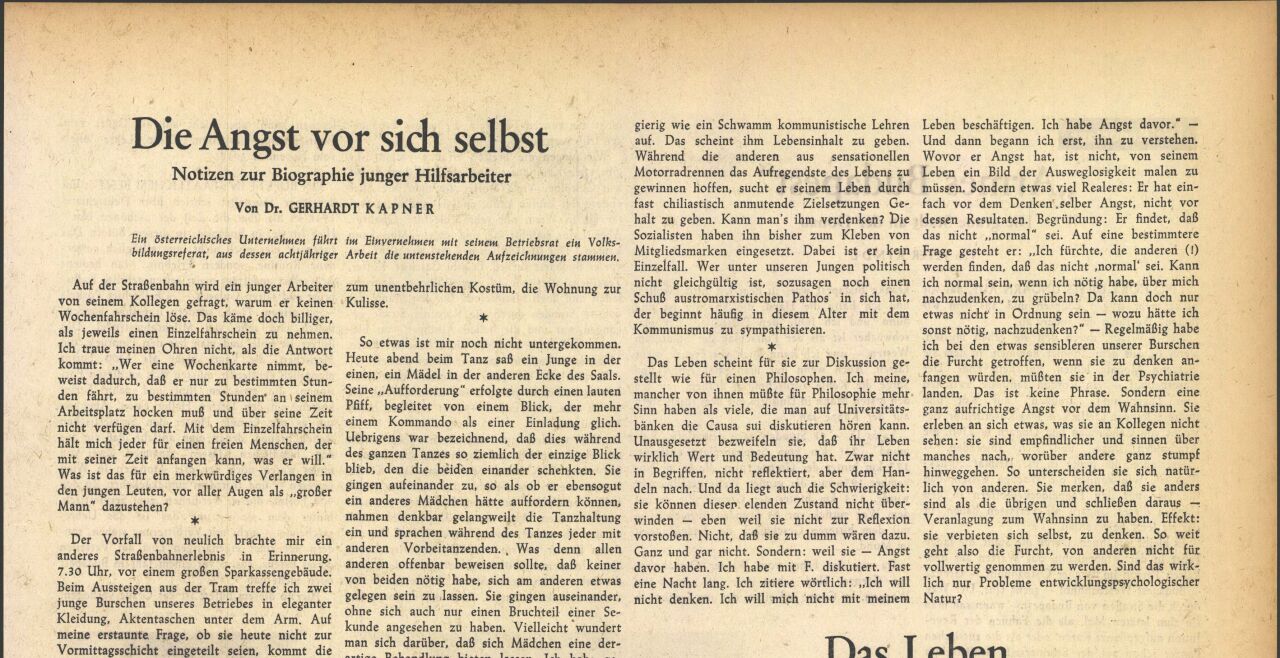
Ein österreichisches Unternehmen führt im Einvernehmen mit seinem Betriebsrat ein Yolks-bildungsreferat, aus dessen achtjähriger Arbeit die untenstehenden Aufzeichnungen stammen.
Auf der Straßenbahn wird ein junger Arbeiter von seinem Kollegen gefragt, warum er keinen Wochenfahrschein löse. Das käme doch billiger, als jeweils einen Einzelfahrschein zu nehmen. Ich traue meinen Ohren nicht, als die Antwort kommt: „Wer eine Wochenkarte nimmt, beweist dadurch, daß er nur zu bestimmten Stunden fährt, zu bestimmten Stunden“ an seinem Arbeitsplatz hocken muß und über seine Zeit nicht verfügen darf. Mit dem Einzelfahrschein hält mich jeder für einen freien Menschen, der mit seiner Zeit anfangen kann, was er will.“ Was ist das für ein merkwürdiges Verlangen in den jungen Leuten, vor aller Augen als „großer Mann“ dazustehen?
Der Vorfall von neulich brachte mir ein anderes Straßenbahnerlebnis in Erinnerung. 7.30 Uhr, vor einem großen Sparkassengebäude. Beim Aussteigen aus der Tram treffe ich zwei junge Burschen unseres Betriebes in eleganter Kleidung, Aktentaschen unter dem Arm. Auf meine erstaunte Frage, ob sie heute nicht zur Vormittagsschicht eingeteilt seien, kommt die souveräne Antwort: „Wir sind überhaupt nicht mehr im Schichtdienst. Wir arbeiten nicht mehr im Werk. Wir sind jetzt bei der Sparkasse — besuche uns doch einmal im Büro.“ Ich erfuhr, daß sie bei der Sparkasse Hilfsarbeiter geblieben waren, wie in unserem Betrieb. Nicht einmal der Lohn war besser. Im Gegenteil. Aber das Gefühl, morgens sauber gekleidet zur Straßenbahn gehen zu können, statt wie bisher im verschmutzten Arbeitsanzug in die Fabrik, das mußte ihnen offenbar die Genugtuung verschafft haben, etwas „Besseres“ — wie sie sich ausdrückten — geworden zu sein. Was geht da vor? Ich habe darnach im Betrieb festgestellt, daß von etwa fünfzehn mir persönlich bekannten jungen Leuten fast keiner mehr da ist. Dabei handelt es sich gerade um die Intelligentesten. Einer ging zur Post, ein anderer zur Bahn, der entschied sich für Sparkasse oder „' ram“, jener für den Gemeindedienst oder ein Unternehmen mit klingendem Namen. Im Gespräch mit ihnen sie wohnen janoch alle erreichbar in unseren Wkswehntmgen5-**- habe ich entdeckt, daß durchaus nicht immer die „Sicherheit des Arbeitsplatzes“ das Verlockende des Stellenwechsels war, sondern der Ruf, den die Firma besaß, in die sie wechselten. Der Glanz des Firmennamens schien ihrer Existenz erhöhte Bedeutung zu geben. Nun verstehe ich auch, warum sich seit einiger Zeit so sehr die Fälle häufen, in denen um „Ernennung“ — wie es einmal wörtlich hieß — in den Angestelltenstand ersucht wird. Sie wollen dabei nicht die Schulen absolvieren, die dazu nötig sind, aber „ernannt“ wollen sie sein, offiziell als etwas „Besseres“ bestätigt. Woher diese Minderwertigkeitsgefühle?
Der „hundertjährige Aufstieg einer Klasse“ erinnert mich an eine kleine Tiergeschichte von Manfred Kyber. Ein Vogel sitzt gefangen im Käfig und erlebt endlich seinen „großen Tag“, an dem versehentlich die Tür des Bauers offen bleibt. Als er aber aufflattert, merkt er, daß in der langen Zeit seine Flügel lahm geworden sind, und kehrt in die Gefangenschaft zurück. Genau so kommen mir unsere Jungen vor. Wir machten heute auf einer Fahrt in Velden Station. Das herrliche Wetter lockte Scharen von Fremden an den See und auf die Terrassen der Restaurants. Vor unseren Augen stand gewissermaßen leibhaftig eine annähernd luxuriöse Filmwelt. Ich versuchte, mit meiner Gruppe in einem etwas einfacheren Lokal zu essen. Da stellte sich plötzlich heraus, daß sie nicht eintreten wollten., Sie hatten — wörtlich — „Angst vor dem Besteck“. Da haben sich also Generationen abgemüht, ihnen ein „besseres“ Leben zu ermöglichen. Nun ist der „große Tag“ da, die Tür in diese „bessere“ Welt ist aufgestoßen worden. Aber sie treten nicht ein, denn niemand hat ihnen gesagt, wie sie sich in dieser Welt benehmen sollen. Man hat ihnen Mittel in die Hand gegeben, aber keine Zwecke vor Augen gestellt, für die sie sie einsetzen könnten.
„Die Klassengesellschaft im Schmelztiegel“ scheint mir reichlich erfunden. Zumindest in unserem Betrieb. Sie wollen nicht wirklich in diese Gesellschaft eintreten, die sie immerfort als eine „bessere“ bezeichnen. Aber sie wollen vor aller Augen so erscheinen, als lebten sie in ihr. Und zwar dokumentieren sie das vor allem unter sich selbst in Gehaben, Geldausgeben, Anzug und Möbel. So wird die Kleidung zum unentbehrlichen Kostüm, die Wohnung zur Kulisse.
So etwas ist mir noch nicht untergekommen. Heute abend beim Tanz saß ein Junge in der einen, ein Mädel in der anderen Ecke des Saals. Seine „Aufforderung“ erfolgte durch einen lauten Pfiff, begleitet von einem Blick, der mehr einem Kommando als einer Einladung glich. Uebrigens war bezeichnend, daß dies während des ganzen Tanzes so ziemlich der einzige Blick blieb, den die beiden einander schenkten. Sie gingen aufeinander zu, so als ob er ebensogut ein anderes Mädchen hätte auffordern können, nahmen denkbar gelangweilt die Tanzhaltung ein und sprachen während des Tanzes jeder mit anderen Vorbeitanzenden. , Was denn allen anderen offenbar beweisen sollte, daß keiner von beiden nötig habe, sich am anderen etwas gelegen sein zu lassen. Sie gingen auseinander, ohne sich auch nur einen Bruchteil einer Sekunde angesehen zu haben. Vielleicht wundert man sich darüber, daß sich Mädchen eine derartige Behandlung bieten lassen. Ich habe gefunden, daß manche Mädchen derlei geradezu erwarten. Offenbar erscheint ihnen sonst ihr Ritter nicht ritterlich genug. Wobei ritterlich den Beweis bedeutet, was er sich zu leisten traut. Der „Tänzer“ hat mir hinterher erklärt, er würde nie im Leben wagen, in einem Lokal seinem Mädchen etwas zu zahlen. Auf die Frage nach dem Grund gab er zur Antwort, es würde ihn das vor dem Mädchen restlos blamieren, denn sie könne nur lachen über jemand, der so dumm sei. Ohne Zweifel ein eigener Ehrenkodex.
Mit P. in der Direktion gewesen. Wehe dem, der ihn nicht respektiert. Hat er das Gefühl, nicht als gleichwertig, nicht als „Weltmann“ genommen zu werden, dann benimmt er sich so provozierend, daß die Welt, die ihm ihre Achtung versagt, ihm wenigstens ihre Aufmerksamkeit schenken muß. — Wir waren zur Vorsprache für 9 Uhr bestellt. Unglücklicherweise fiel gerade im Augenblick unseres Besuches irgend etwas Wichtiges vor, und der Direktor kam persönlich aus seinem Zimmer, um uns noch um Geduld zu bitten. Die Reaktion des Zwanzigjährigen war verblüffend. Kaum, daß der Chef gegangen war, geriet er dermaßen in Erregung, daß er nur schwer zu beruhigen war. Er erklärte, daß man ihn absichtlich warten lasse, weil er nur ein Arbeiter sei. Es war ihm einfach nicht klarzumachen, daß dies jedermann passieren konnte. Er ging im Warteraum auf und ab, rauchte Zigaretten mit der Miene eines schlecht gelaunten Filmgewaltigen und suchte Vorbeigehenden durch Ausrufe deutlich zu machen, daß er sich derlei nicht bieten lasse. Er drohte sozusagen der ganzen Welt.
Das ist die reinste Anarchie. W. hat heute nacht mit ein paar Burschen die Stationstafeln unserer Autobuslinie verbogen — nur „um ins Gerede zu kommen“. Ich erinnere mich, daß er schon einmal ein Motorrad „stahl“ und erst dann zurückgab, als er sicher sein konnte, daß die Anzeige erstattet worden war. Was ist das für eine grenzenlose Sucht, die Aufmerksamkeit der anderen zu erzwingen? Sie kommen sich vergessen und überflüssig vor, sobald niemand von ihnen spricht. Und dann provozieren sie. Was reden wir von „Halbstarken“? Vielleicht fehlt ihnen nur jemand, der ihnen zuhört oder der sie liebt. Daß hier die Familie fehlt, ist fast schon ein abgedroschenes Schlagwort.
Was wollen sie also eigentlich? Da verblüfft mich heute ein Sechzehnjähriger mit einer Philosophie, die ich hinter dieser „Lederweste“ nicht erwartet hätte: „Man muß etwas unternehmen, solange das Gefühl noch nicht verraucht ist.“ Das erklärt auch das Hektische in ihrem Seelenleben. Wie die Raubtiere sind sie hinter Erlebnissen her. Nicht an dem, was sie erleben, liegt ihnen etwas, sondern daran, daß sie etwas erleben — und womöglich, daß jemand dabei zusieht, der vor Neid und Erstaunen verstummt. Das gibt ihnen Selbstbewußtsein, bestätigt ihnen, nicht umsonst da zu sein. Wie die Könige bei Pascal: man muß Hasenjagden für sie veranstalten, sonst macht ihnen die Sinnlosigkeit ihres Lebens Angst.
L. hat einen wilden Streik inszeniert. Bis jetzt war er ein recht hoffnungsvoller Parteigänger der Sozialisten. Aber seit er mit J. an einem Arbeitsplatz ist, saugt der 21jährige begierig wie ein Schwamm kommunistische Lehren auf. Das scheint ihm Lebensinhalt zu geben. Während die anderen aus sensationellen Motorradrennen das Aufregendste des Lebens zu gewinnen hoffen, sucht er seinem Leben durch fast chiliastisch anmutende Zielsetzungen Gehalt zu geben. Kann man's ihm verdenken? Die Sozialisten haben ihn bisher zum Kleben von Mitgliedsmarken eingesetzt. Dabei ist er kein Einzelfall. Wer unter unseren Jungen politisch nicht gleichgültig ist, sozusagen noch einen Schuß austromarxistischen Pathos' in sich hat, der beginnt häufig in diesem Alter mit dem Kommunismus zu sympathisieren.
Das Leben scheint für sie zur Diskussion gestellt wie für einen Philosophen. Ich meine, mancher von ihnen müßte für Philosophie mehr Sinn haben als viele, die man auf Universitätsbänken die Causa sui diskutieren hören kann. Unausgesetzt bezweifeln sie, daß ihr Leben wirklich Wert und Bedeutung hat. Zwar nicht in Begriffen, nicht reflektiert, aber dem Handeln nach. Und da liegt auch die Schwierigkeit: sie können diesen elenden Zustand nicht überwinden — eben weil sie nicht zur Reflexion vorstoßen. Nicht, daß sie zu dumm wären dazu. Ganz und gar nicht. Sondern: weil sie — Angst davor haben. Ich habe mit F. diskutiert. Fast eine Nacht lang. Ich zitiere wörtlich: „Ich will nicht denken. Ich will mich nicht mit meinem Leben beschäftigen. Ich habe Angst davor.“ — Und dann begann ich erst, ihn zu verstehen. Wovor er Angst hat, ist nicht, von seinem Leben ein Bild der Ausweglosigkeit malen zu müssen. Sondern etwas viel Realeres: Er hat einfach vor dem Denken .selber Angst, nicht vor dessen Resultaten. Begründung: Er findet, daß das nicht „normal“ sei. Auf eine bestimmtere Frage gesteht er: „Ich fürchte, die anderen (!) werden finden, daß das nicht .normal' sei. Kann ich normal sein, wenn ich nötig habe, über mich nachzudenken, zu grübeln? Da kann doch nur etwas nicht' in Ordnung sein — wozu hätte ich sonst nötig, nachzudenken?“ — Regelmäßig habe ich bei den etwas sensibleren unserer Burschen die Furcht getroffen, wenn sie zu denken anfangen würden, müßten sie in der Psychiatrie landen. Das ist keine Phrase. Sondern eine ganz aufrichtige Angst vor dem Wahnsinn. Sie erleben an sich etwas, was sie an Kollegen nicht sehen: sie sind empfindlicher und sinnen über manches nach, worüber andere ganz stumpf hinweggehen. So unterscheiden sie sich natürlich von anderen. Sie merken, daß sie anders sind als die übrigen und schließen daraus — Veranlagung zum Wahnsinn zu haben. Effekt: sie verbieten sich selbst, zu denken. So weit geht also die Furcht, von anderen nicht für vollwertig genommen zu werden. Sind das wirklich nur Probleme entwicklungspsychologischer Natur?